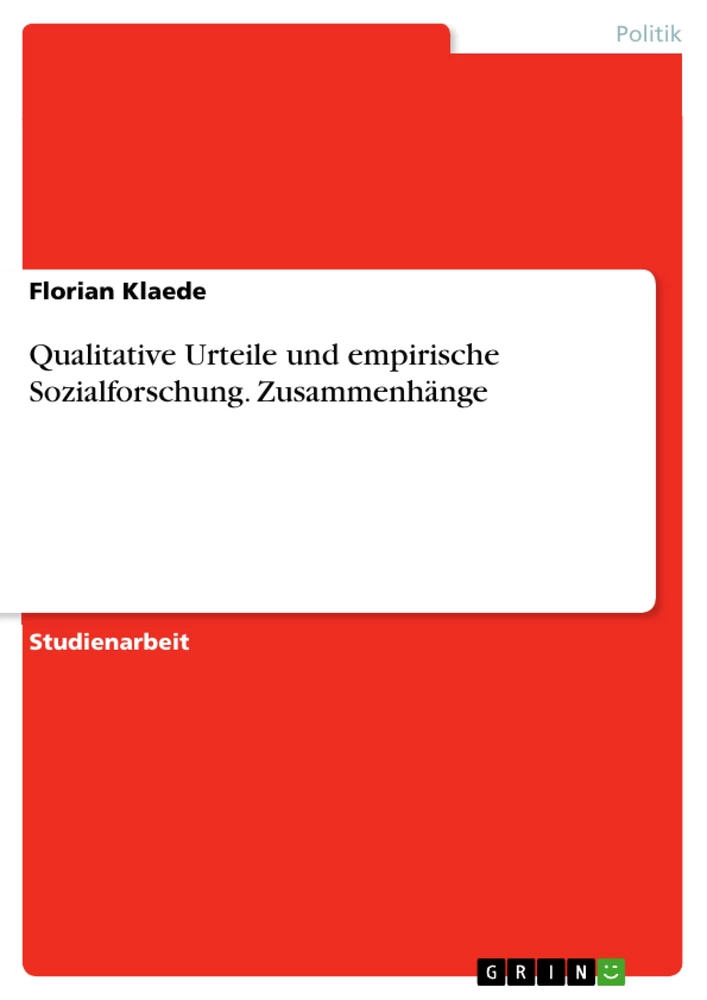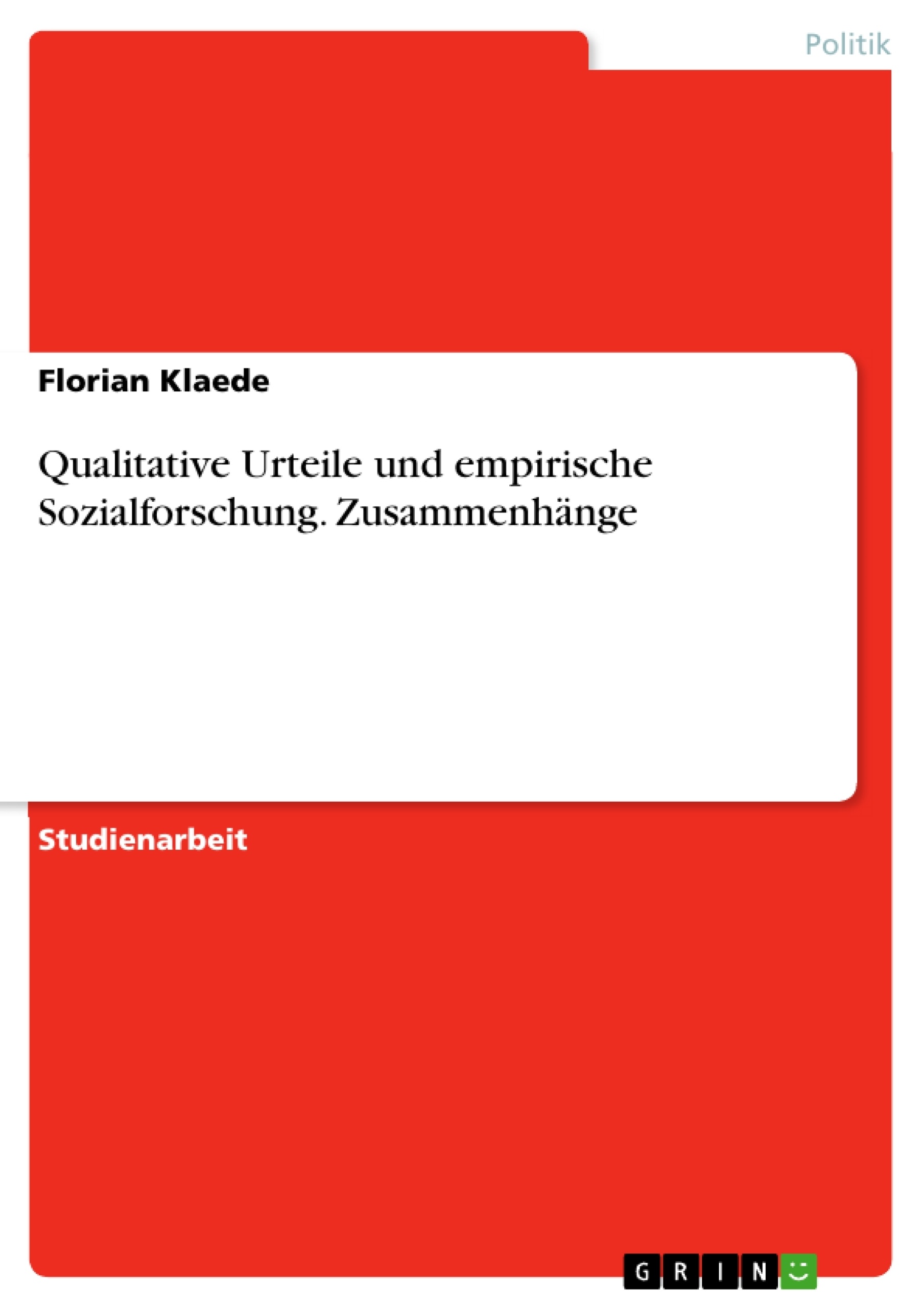Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage der Werturteilsfreiheit bzw. Werturteilslastigkeit empirischer Sozialforschung. Insbesondere versucht sie Interdependenzen zwischen Sozialforschung und Werturteilen aufzudecken. Hierbei wird ein Bogen von Max Weber bis hin zu heutigen Erkenntnissen der Hirnforschung gezogen.
Am Ende steht die Frage, inwieweit gesellschaftliche Tendenzen zur Bildung einer "Expertokratie" durch populäre Missverständnisse über die Werturteilsfreiheit empirischer Sozialforschung begünstigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Zu Hintergrund, Begriffen und Methodik der Arbeit.
- Hintergrund und methodische Vorgehensweise
- Der Begriff des Werturteils- Trennung von präskriptiven und deskriptiven Aussagen
- Der Begriff der empirischen Sozialforschung
- Wissenschaftstheoretische Überlegungen und empirische Forschungsergebnisse zur Möglichkeit der Werturteilsfreiheit empirischer Sozialforschung.
- Aktuelle Stimmen in der Werturteilsdiskussion.
- Kontexte empirischer Forschung und Werturteile.
- Empirie und Empirismus- Wahrnehmung als Voraussetzung empirischer Erkenntnis.
- Wertung und Wahrnehmung aus Sicht der Gehirn- und Bewusstseinsforschung.
- Intersubjektive Nachvollziehbarkeit als Merkmal wissenschaftlichen Vorgehens
- Intersubjektivität als Lösung des Wertfreiheits-Dilemmas?
- Fazit und Ausblick: Von der Mystifizierung zur „,Expertokratie\"- Gefahren einer missverstandenen Werturteilsfreiheit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage der Werturteilsfreiheit in der empirischen Sozialforschung. Sie analysiert die historischen und gegenwärtigen Debatten um diese Thematik, insbesondere die Rolle von Werturteilen in der Forschung und die Möglichkeit einer objektiven und wertfreien Analyse sozialer Phänomene. Die Arbeit untersucht, wie sich die Werturteilsfrage auf die methodischen Ansätze der Sozialforschung auswirkt und welche Auswirkungen eine missverstandene Werturteilsfreiheit auf die Gesellschaft haben kann.
- Historische Entwicklung der Werturteilsdebatte in der Sozialforschung
- Bedeutung von Werturteilen in der empirischen Forschung
- Die Möglichkeit einer Werturteilsfreiheit
- Methodologische Implikationen der Werturteilsfrage
- Gesellschaftliche Auswirkungen einer missverstandenen Werturteilsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einführung in die Thematik der Werturteilsfreiheit und legt den grundlegenden Rahmen für die weitere Analyse. Es werden zentrale Begriffe wie Werturteil, präskriptive und deskriptive Aussagen sowie empirische Sozialforschung definiert und in den Kontext der historischen Debatte um die Werturteilsfreiheit eingebettet.
Kapitel 2 beleuchtet aktuelle Positionen in der Werturteilsdiskussion und untersucht, wie sich die Frage der Werturteilsfreiheit auf verschiedene Kontexte der empirischen Forschung auswirkt. Es werden wichtige Aspekte wie die Rolle der Wahrnehmung, die Bedeutung der Intersubjektivität und die Erkenntnisse der Gehirn- und Bewusstseinsforschung in Bezug auf Werturteile behandelt.
Schlüsselwörter
Werturteilsfreiheit, Empirische Sozialforschung, Werturteil, Präskriptive Aussage, Deskriptive Aussage, Objektivität, Subjektivität, Wahrnehmung, Intersubjektivität, Gehirnforschung, Bewusstseinsforschung, Methodologie, Gesellschaftliche Auswirkungen.
- Quote paper
- Florian Klaede (Author), 2014, Qualitative Urteile und empirische Sozialforschung. Zusammenhänge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275840