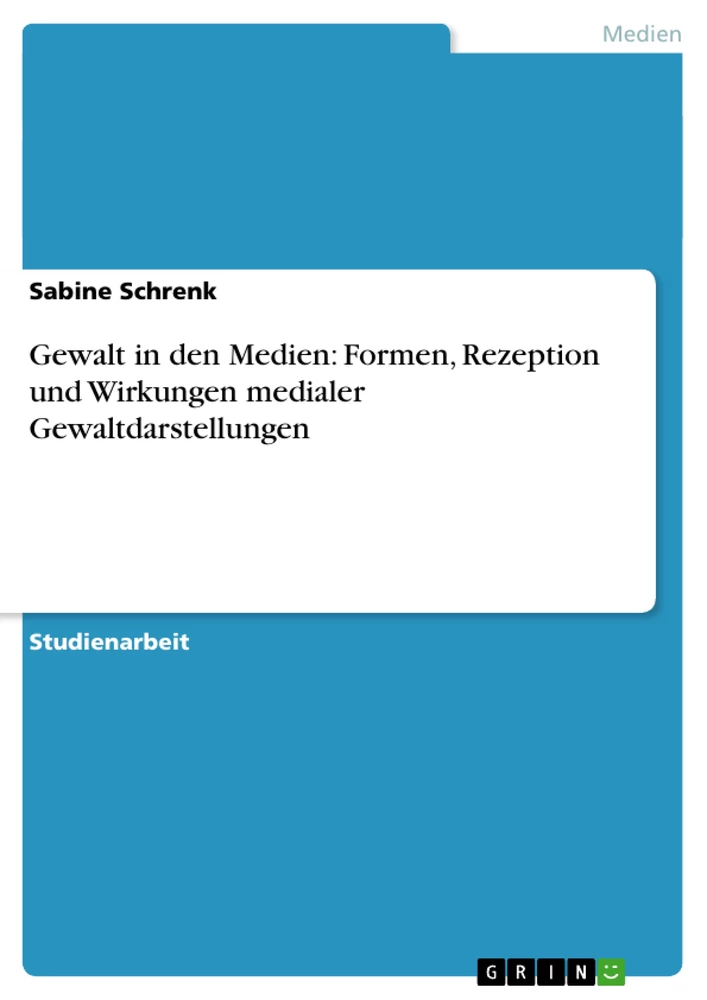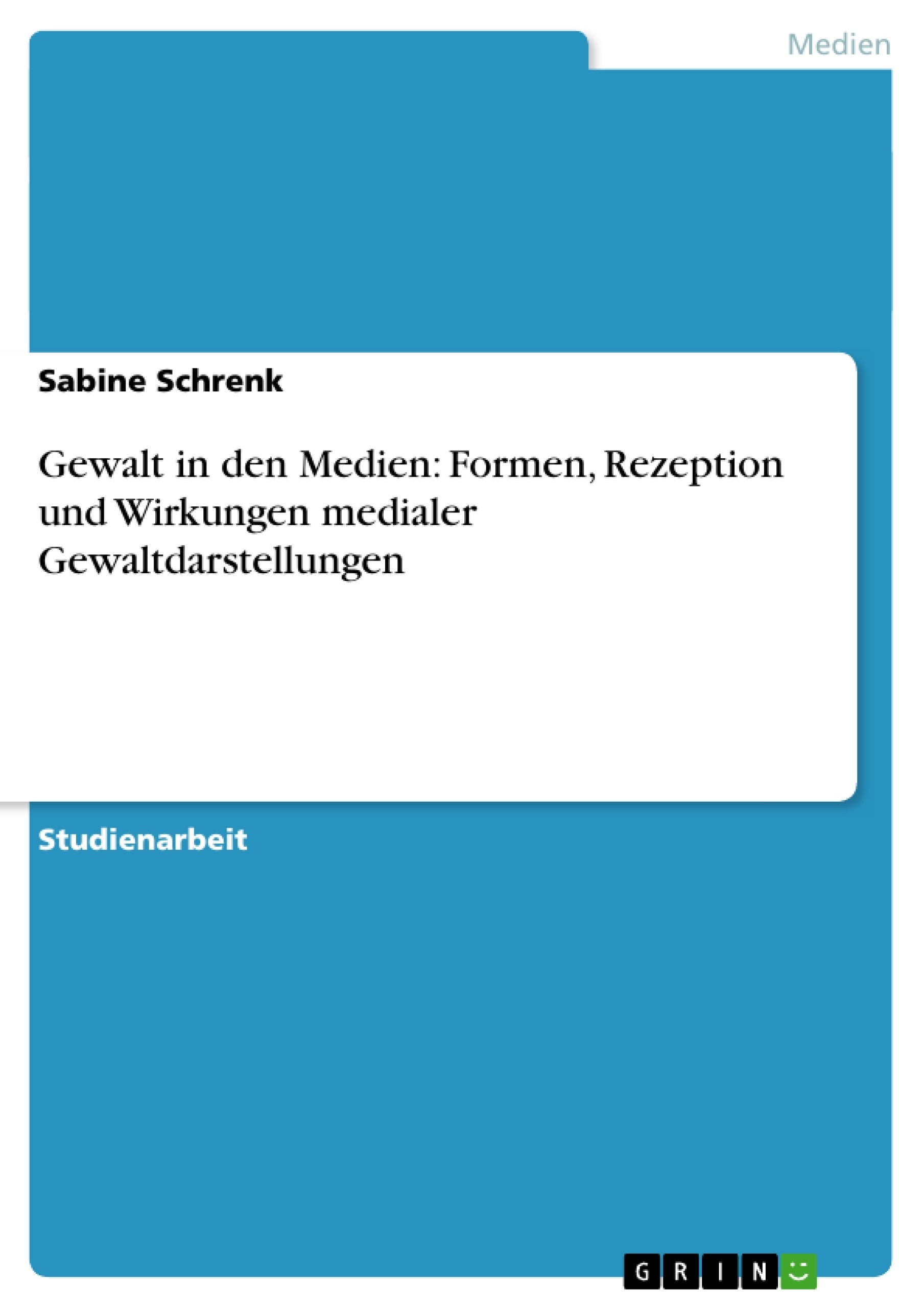Entsteht Gewalt in der Gesellschaft durch Gewalt im Fernsehen? Diese Frage erscheint, betrachtet man zumindest den öffentlichen Diskurs und die oft allzu vorschnellen Forderungen von Politikern hierzu, längst beantwortet und hiermit überflüssig. Denn immer wieder in Fällen, in denen reelle Gewalt – vor allem bei jugendlichen Tätern, wie etwa in Littleton oder Erfurt – auftritt, ist der nach Meinung der Öffentlichkeit eigentliche Täter schnell ausgemacht: die Medien und die in ihnen vorkommenden Gewaltdarstellungen.
Immer wieder haben Kommunikationswissenschaftler versucht, die Frage nach der Wirkung von Mediengewalt zu beantworten – allerdings noch keineswegs zufriedenstellend. Bislang beschränkten sich die durchaus zahlreichen Forschungsansätze hauptsächlich auf die Untersuchung der Wirkung von Gewalt auf die Rezipienten, dabei wurde in den meisten Fällen die fiktionale Unterhaltungsgewalt in den Mittelpunkt gestellt. Aus einem einfachen Grund: Vordringliches Interesse galt den Kindern und Jugendlichen, die in besonderer Weise den massenmedial vermittelten Leitbildern und Verhaltensmodellen ausgesetzt sind.
Die Präsentation von realer Gewalt dagegen ist erst in den vergangenen Jahren in den Vordergrund des Interesses getreten. Dabei hat diese massenmediale Gewaltdarstellung, wie etwa in Nachrichtensendungen, meines Erachtens einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Gewaltwahrnehmung durch die Rezipienten: Wie unter anderem Kunczik betont, wirkt als real eingeschätzte Gewalt emotional wesentlich erregender als Gewalt, die als fiktiv wahrgenommen wird.
Darüber hinaus wurde in den meisten Studien bislang ein weiteres Problem nicht ausreichend beachtet: Inwiefern stimmt die von den Forschern bestimmte Gewalt überhaupt mit der Gewalt überein, die das Publikum wahrnimmt? Gewalt kann nicht als unmittelbar gegebene Realität verstanden werden. Denn, so Merten: „Gewalt ist kein Beobachtungsterminus, sondern ein soziales Unwerturteil, welches durch Zuschreibung [...] entsteht und von bestimmten soziostrukturellen Faktoren beeinflußt [sic!] wird.“ Die Bedeutungszuweisung unterscheidet sich von Rezipient zu Rezipient. Bevor man sich also den möglichen Wirkungen von medialen Gewaltdarstellungen widmen kann, muss zunächst die Rezeption der Medienbotschaft untersucht werden. Die Forschungsfrage, die die Basis dieser Untersuchung bildet, lautet daher: „Wie nehmen Rezipienten Kriegsberichterstattung in den Massenmedien wahr?“
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist Gewalt?
- 3 Differenzierung des Gewaltbegriffs
- 4 Thesen zur Wirkung von Gewaltdarstellungen
- 4.1 Katharsis-These
- 4.2 Inhibitions-These
- 4.3 Frustrations-Aggressions- bzw. Stimulationsthese
- 4.4 Habitualisierungsthese
- 4.5 Imitationsansatz bzw. Lerntheorie
- 4.6 These der „Allgemeinen Erregung“
- 4.7 These der Wirkungslosigkeit
- 5 Untersuchungsanlage
- 5.1 Gegenstand der Untersuchung
- 5.2 Untersuchungszeitraum
- 5.3 Analyseinstrument
- 6 Untersuchungsergebnisse
- 6.1 Deskriptive Analyse der Stichprobe
- 6.2 Gewalthaltige Sequenzen
- 6.3 Wahrnehmungsreaktionen der Testpersonen
- 6.3.1 Zustandsangst vor und nach der Rezeption
- 6.3.2 Angsterregende Sequenzen
- 6.3.3 Schreckliche Sequenzen
- 6.3.4 Tolle bzw. faszinierende Sequenzen
- 6.3.5 Interessante Sequenzen
- 7 Zusammenfassung und Fazit
- 8 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Wahrnehmung von Kriegsberichterstattung in den Massenmedien. Ziel ist es, die Rezeption von Medienbotschaften im Kontext von Gewaltdarstellungen zu analysieren und die Frage zu beleuchten, inwiefern die vom Forscher bestimmte Gewalt mit der vom Publikum wahrgenommenen übereinstimmt. Die Studie hinterfragt gängige Thesen zur Wirkung medialer Gewalt und betrachtet die subjektive Interpretation von Gewalt als zentralen Aspekt.
- Definition und Differenzierung des Gewaltbegriffs
- Wirkungstheorien zu Gewaltdarstellungen in Medien
- Rezeption von Kriegsberichterstattung
- Subjektive Wahrnehmung von Gewalt
- Analyse der Beziehung zwischen wahrgenommener und definierter Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wirkung von medialer Gewalt ein und problematisiert die vereinfachte Zuschreibung von gesellschaftlicher Gewalt an die Medien. Sie hebt die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Rezeption von medialer Gewalt hervor, insbesondere im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen fiktionaler und realer Gewalt und die subjektive Interpretation des Gewaltbegriffs. Die Arbeit fokussiert sich auf die Wahrnehmung von Kriegsberichterstattung und stellt die Forschungsfrage nach der Rezeption dieser durch das Publikum.
2 Was ist Gewalt?: Dieses Kapitel beleuchtet die Vielschichtigkeit und die fehlende eindeutige Definition von Gewalt. Es zeigt, wie unterschiedlich der Begriff von Individuen und in verschiedenen Kontexten interpretiert wird, von der physischen Gewalt bis hin zu subtileren Formen von Macht und Herrschaft. Der Text betont die subjektive Zuschreibung des Begriffs und seinen situativen Charakter.
3 Differenzierung des Gewaltbegriffs: (Annahme: Dieses Kapitel existiert, da es im Inhaltsverzeichnis auftaucht, jedoch ohne Textbeispiel im Provided Text. Daher eine hypothetische Zusammenfassung) Dieses Kapitel würde voraussichtlich eine detaillierte Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des Gewaltbegriffs bieten, verschiedene Formen von Gewalt (physisch, psychisch, strukturell) differenzieren und möglicherweise unterschiedliche Gewalttypen im Kontext medialer Darstellungen kategorisieren. Der Fokus läge wahrscheinlich darauf, ein differenziertes Verständnis des Gewaltbegriffs zu schaffen, um die spätere Analyse der medialen Rezeption fundiert zu gestalten.
4 Thesen zur Wirkung von Gewaltdarstellungen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Theorien über die Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Medien. Es werden verschiedene Thesen wie die Katharsis-These, die Inhibitions-These, die Frustrations-Aggressions-These, die Habitualisierungsthese, der Imitationsansatz, die These der Allgemeinen Erregung und die These der Wirkungslosigkeit behandelt und kritisch hinterfragt. Der Text beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Zusammenhang zwischen medialer Gewalt und realer Gewalt.
5 Untersuchungsanlage: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten Studie. Es erläutert den Gegenstand der Untersuchung, den Untersuchungszeitraum und die verwendeten Analyseinstrumente. Hier würden Details zur Auswahl der Stichprobe, den eingesetzten Methoden zur Datenerhebung und -auswertung, sowie die Limitationen der Studie präsentiert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt wahrscheinlich auf der Operationalisierung des Gewaltbegriffes innerhalb der Untersuchung.
6 Untersuchungsergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie. Es beinhaltet eine deskriptive Analyse der Stichprobe und eine detaillierte Auswertung der Wahrnehmung von Gewaltdarstellungen in Kriegsberichten. Die Ergebnisse betreffen die Reaktionen der Testpersonen auf gewalthaltige, angsterregende, schreckliche, tolle/faszinierende und interessante Sequenzen und analysieren den Zusammenhang zwischen der Rezeption und der emotionalen Reaktion der Teilnehmer.
Schlüsselwörter
Mediengewalt, Gewaltrezeption, Kriegsberichterstattung, Wirkungsforschung, Katharsis, Inhibition, Frustration-Aggression, Habitualisierung, Imitation, Wahrnehmung, Rezipient, Subjektivität, Medienwirkung, Analyse, Empirie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wahrnehmung von Kriegsberichterstattung in den Massenmedien
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Wahrnehmung von Kriegsberichterstattung in den Massenmedien und analysiert die Rezeption von Medienbotschaften im Kontext von Gewaltdarstellungen. Ein zentraler Aspekt ist die Frage, inwieweit die vom Forscher definierte Gewalt mit der vom Publikum wahrgenommenen übereinstimmt. Die Studie hinterfragt gängige Thesen zur Wirkung medialer Gewalt und konzentriert sich auf die subjektive Interpretation von Gewalt.
Welche Theorien zur Wirkung von Gewaltdarstellungen werden behandelt?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Theorien zur Wirkung von Gewaltdarstellungen, darunter die Katharsis-These, die Inhibitions-These, die Frustrations-Aggressions-These, die Habitualisierungsthese, den Imitationsansatz (Lerntheorie), die These der „Allgemeinen Erregung“ und die These der Wirkungslosigkeit. Diese Theorien werden kritisch beleuchtet und im Kontext der Studie bewertet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Einleitung, Definition von Gewalt, Differenzierung des Gewaltbegriffs, Thesen zur Wirkung von Gewaltdarstellungen, Untersuchungsanlage (Methodologie), Untersuchungsergebnisse, Zusammenfassung und Fazit sowie Literaturverzeichnis. Der Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Kapitel und Unterkapitel.
Welche Methodik wurde in der Studie angewendet?
Das Kapitel „Untersuchungsanlage“ beschreibt detailliert die Methodik der Studie, einschließlich des Gegenstands der Untersuchung, des Untersuchungszeitraums und der verwendeten Analyseinstrumente. Es werden Informationen zur Stichprobenauswahl, den Methoden der Datenerhebung und -auswertung sowie zu den Limitationen der Studie bereitgestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Operationalisierung des Gewaltbegriffs.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie werden im Kapitel „Untersuchungsergebnisse“ präsentiert. Diese umfassen eine deskriptive Analyse der Stichprobe und eine detaillierte Auswertung der Wahrnehmung von Gewaltdarstellungen in Kriegsberichten. Die Analyse betrachtet die Reaktionen der Testpersonen auf verschiedene Arten von Sequenzen (gewalthaltig, angsterregend, schrecklich, toll/faszinierend, interessant) und den Zusammenhang zwischen Rezeption und emotionaler Reaktion.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet: Inwiefern stimmt die vom Forscher definierte Gewalt mit der vom Publikum wahrgenommenen Gewalt in der Kriegsberichterstattung überein? Die Studie untersucht die subjektive Interpretation und Rezeption von Gewalt in Medien, insbesondere im Kontext von Kriegsberichterstattung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter, die die Arbeit prägnant beschreiben, sind: Mediengewalt, Gewaltrezeption, Kriegsberichterstattung, Wirkungsforschung, Katharsis, Inhibition, Frustration-Aggression, Habitualisierung, Imitation, Wahrnehmung, Rezipient, Subjektivität, Medienwirkung, Analyse, Empirie.
Wie wird der Gewaltbegriff in der Arbeit definiert und differenziert?
Die Arbeit betont die Vielschichtigkeit und die fehlende eindeutige Definition von Gewalt. Sie zeigt die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs in verschiedenen Kontexten und von verschiedenen Individuen auf, von physischer Gewalt bis hin zu subtileren Formen von Macht und Herrschaft. Die subjektive Zuschreibung und der situative Charakter des Begriffs werden hervorgehoben. Ein eigenes Kapitel ist der detaillierten Differenzierung des Gewaltbegriffs gewidmet.
- Arbeit zitieren
- Sabine Schrenk (Autor:in), 2004, Gewalt in den Medien: Formen, Rezeption und Wirkungen medialer Gewaltdarstellungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27565