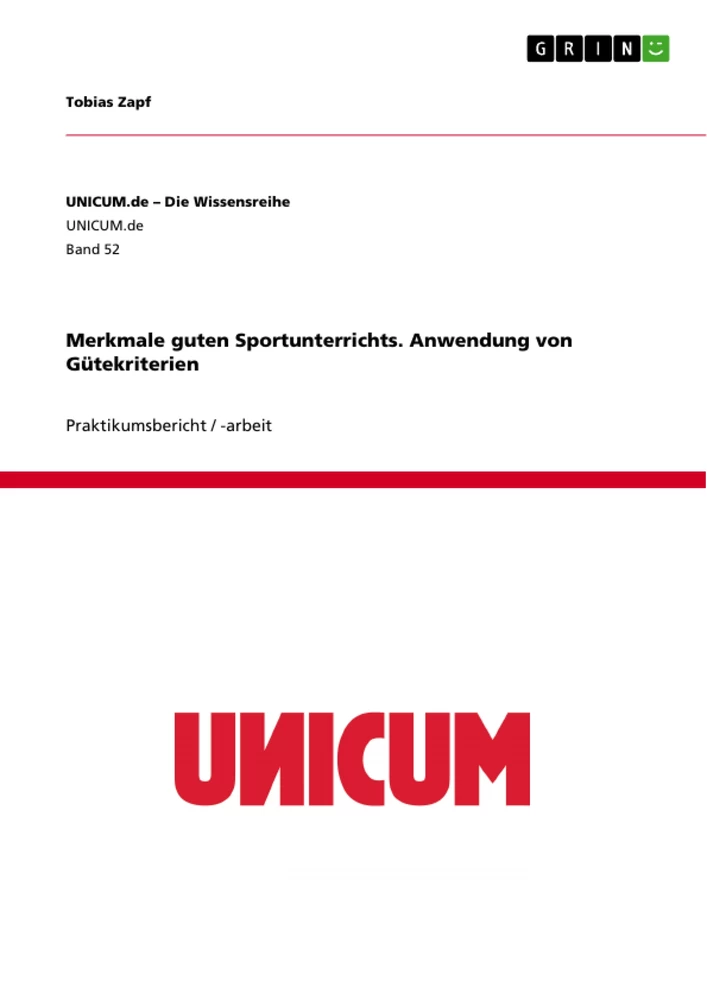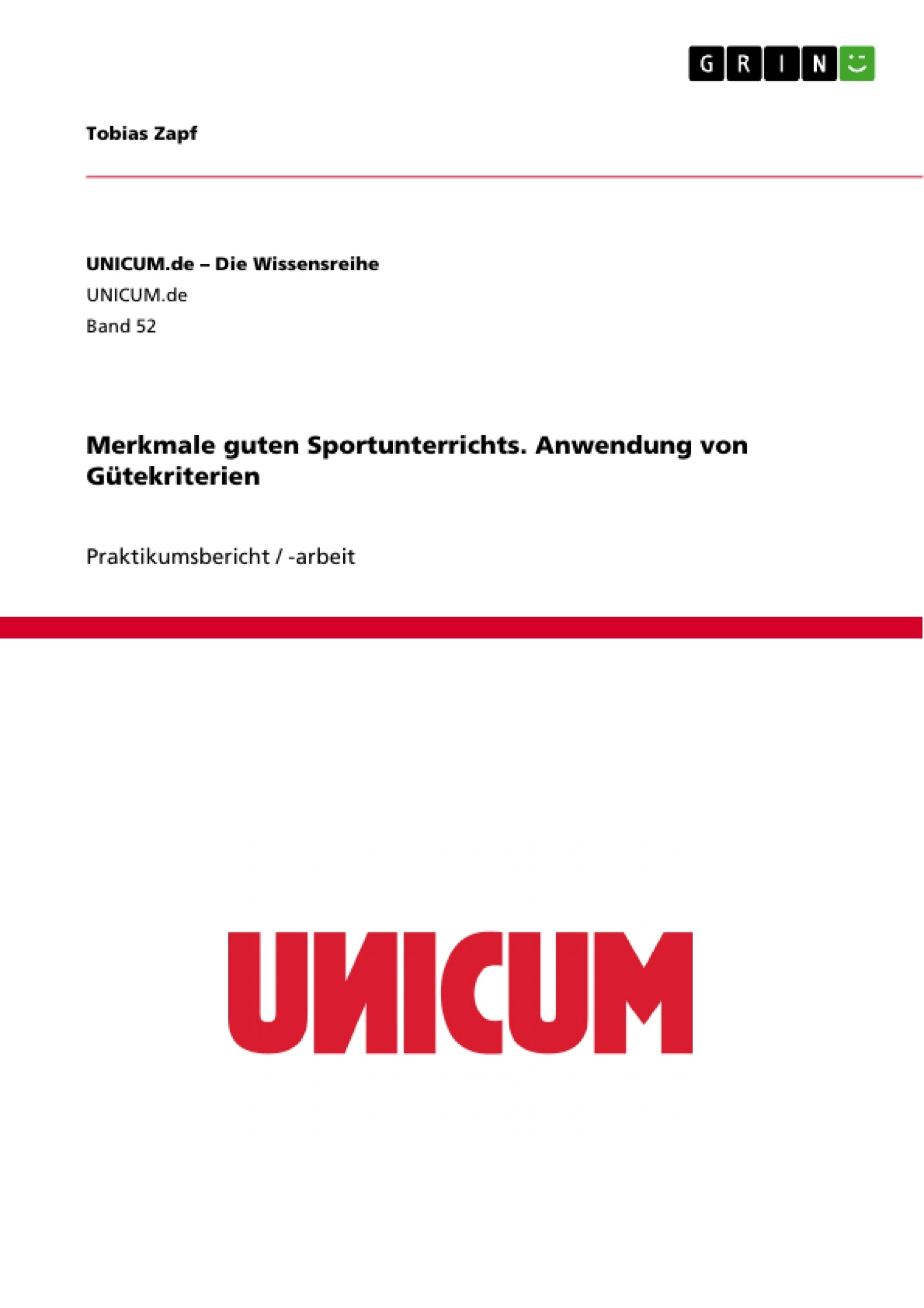Anfang der 80er Jahre lag in der Sportdidaktik eine sehr einseitige Sportorientierung vor, die sich nur sehr wenig mit pädagogisch relevanten Fragestellungen beschäftigte.
Dieses Konzept wird auch die pragmatische Sportdidaktik genannt. Dieses Konzept geriet unter den nächsten Jahren immer mehr unter Kritik, welches unter Dieter Lenzens verstärkt wurde, der die Berechtigung des Schulfaches Sport anzweifelte. Dieses führte zu einer großen Diskussion und Infragestellung des
damaligen Konzeptes des Sportunterrichts. Dadurch, dass die Kritik immer mehr an dem pragmatischen Konzept zunahm, kam es zu einer Umgestaltung des bisher vorherrschenden Models.
Ende der 90er Jahre entwickelte sich das vorangegangene Konzept in den erziehenden Sportunterrichts.
Unter einem erziehenden Unterricht versteht man einen sogenannten Doppelauftrag des Sportunterrichts, der eine Erziehung zum Sport und eine Erziehung durch Sport
gewährleisten. In diesem Zusammenhang stellt sich also die zentrale Frage im schulischen Alltag, was denn überhaupt guter Sportunterricht ist. Hierzu dienen sog. Gütekriterien, die sich auf
den praktischen Unterricht anwenden lassen und so Auskunft über die Qualität des tatsächlich erfolgten Unterricht geben können. In seiner Begrifflichkeit ist der Sportunterricht sehr komplex und fordert daher zur Bildung von Kriterien heraus. Diese Kriterien wiederum dienen der Zergliederung in die
Merkmale guten Unterrichts. In diesem Zusammenhang ist der Entwurf von Gütekriterien eine Möglichkeit den Begriff „guter zielführender Sportunterricht“ aus der individuellen in eine verbindliche Erklärung zu überführen. (...)
Die Auswahl der Inhalte des Sportunterrichts und ihre Umsetzung zu gutem Sportunterricht, also Gütekriterien, führt nicht zum entwicklungsförderlichen und bildungsrelevanten Ergebnisses, sondern die Art der didaktischen Thematisierung.
Es stellt sich also die Frage:
Was ist guter Sportunterricht? Und welche Normen und Qualitätsmerkmale sind wichtig für den Sportunterricht?
Die vorliegende Ausarbeitung basiert auf den Erfahrungen meines Sportfachpraktikums an einer Grundschule mit einer 4 Klasse. Ziel dieser Arbeit ist es eine der in der Literatur gebildeten Gütekriterien, die von mir ausgewählt und zu Beginn vorgestellt werden, darzustellen. Die Kriterien wurden beachtet bei dem entwerfen meiner Unterrichtsstunde und wurden anhand dessen analysiert und bewertet.nde und wurden anhand dessen analysiert und bewertet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gütekriterien des Sportunterrichts
- 2.1 Strukturierung des Unterrichts
- 2.2 Optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit
- 2.3 Lange motorische Aktivitäten
- 2.4 Methodenvielfalt
- 2.5 Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen
- 2.6 Förderliches Unterrichtsklima
- 2.7 Bewusstes Fördern und Üben
- 2.8 Schülerfeedback
- 2.9 Klare Leistungserwartungen und Kontrollen
- 2.10 Sinnstiftendes Unterrichtsgespräch
- 3. Die Anwendung der Gütekriterien auf die Unterrichtsstunde vom 16.12.11
- 3.1 Klare Strukturierung der Unterrichtsstunde „Schlagball“
- 3.2 Optimale Zeitnutzung der Unterrichtsstunde
- 3.3 Lange motorische Aktivitäten der Schülerinnen
- 3.4 Angewandte Vielfalt der Methoden
- 3.5 Stimmigkeit der Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidung in der analysierten Sportstunde
- 3.6 Förderliches Unterrichtsklima während meiner Unterrichsstunde
- 3.7 Sinnstiftende Unterrichtsgespräche
- 3.8 Bewusstes Fördern und Üben in Gruppen bzw. individuell
- 3.9 Schüler-Feedback innerhalb meiner Sportstunde
- 3.10 Klare Leistungserwartungen ohne Benotungskontrolle in diesem Sportunterricht
- 4. Reflexion der Unterrichtsstunde vom 21.06.12
- 5. Kritische Betrachtung der Gütekriterien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung basiert auf den Erfahrungen des Sportfachpraktikums an einer Grundschule mit einer 4. Klasse. Ziel ist es, die in der Literatur gebildeten Gütekriterien des Sportunterrichts, die im Text vorgestellt werden, zu analysieren und zu bewerten. Die Kriterien wurden bei der Gestaltung einer Unterrichtsstunde beachtet und anhand derer analysiert und bewertet.
- Entwicklungsförderung der Schülerinnen und Schüler im Bereich von Bewegung, Spiel und Sport
- Qualitätsmerkmale des Sportunterrichts: Lernen, Leisten und Reflektieren
- Strukturierte Gestaltung von Sportunterricht
- Anwendung und Bewertung von Gütekriterien in der Praxis
- Reflexion der eigenen Unterrichtsstunde und der angewandten Gütekriterien
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Merkmale guten Sportunterrichts“ ein und beleuchtet die historische Entwicklung des Sportunterrichts und die Notwendigkeit von Gütekriterien. Kapitel 2 stellt die Gütekriterien des Sportunterrichts vor, die von Gebken (2003) definiert wurden. Diese umfassen Aspekte wie Strukturierung, Zeitnutzung, lange motorische Aktivitäten, Methodenvielfalt, Stimmigkeit von Zielen, Inhalten und Methoden, Unterrichtsklima, Förderhaltung, Schülerfeedback, Leistungserwartungen und sinnstiftende Unterrichtsgespräche. Kapitel 3 analysiert die Unterrichtsstunde vom 16.12.11 anhand der zuvor genannten Gütekriterien. Kapitel 4 reflektiert die Unterrichtsstunde vom 21.06.12 und Kapitel 5 widmet sich einer kritischen Betrachtung der Gütekriterien.
Schlüsselwörter
Gütekriterien, Sportunterricht, Strukturierung, Zeitnutzung, Methodenvielfalt, Stimmigkeit, Unterrichtsklima, Förderhaltung, Schülerfeedback, Leistungserwartungen, Sinnstiftendes Unterrichtsgespräch, Reflexion, Entwicklungsförderung, Lernen, Leisten, Reflektieren.
- Quote paper
- Bachelor of Arts (B.A.) Tobias Zapf (Author), 2012, Merkmale guten Sportunterrichts. Anwendung von Gütekriterien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275548