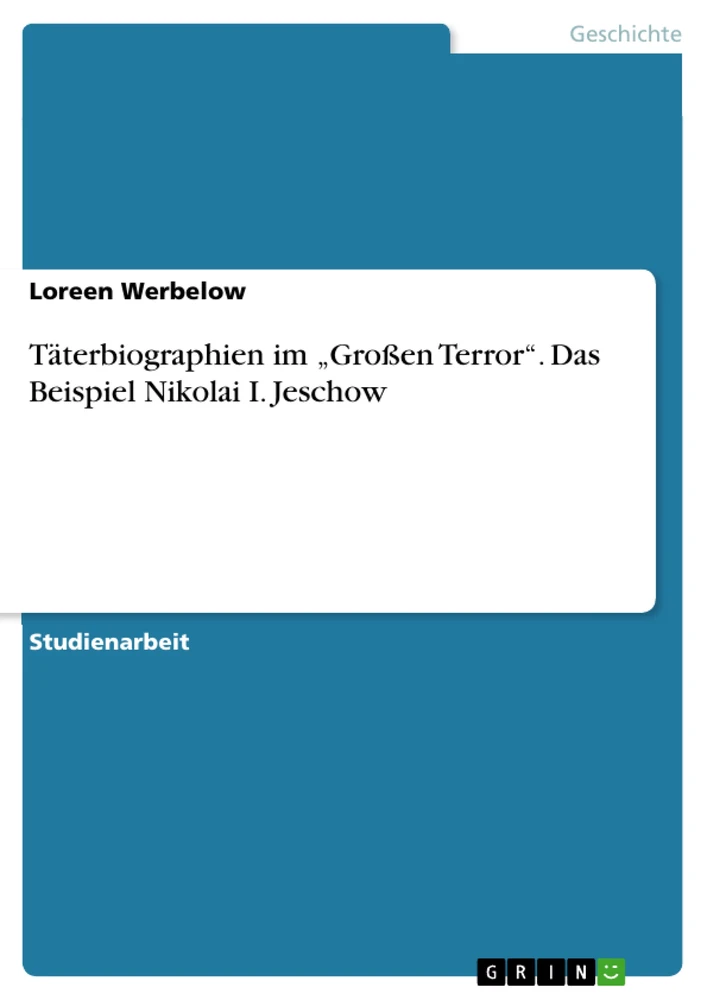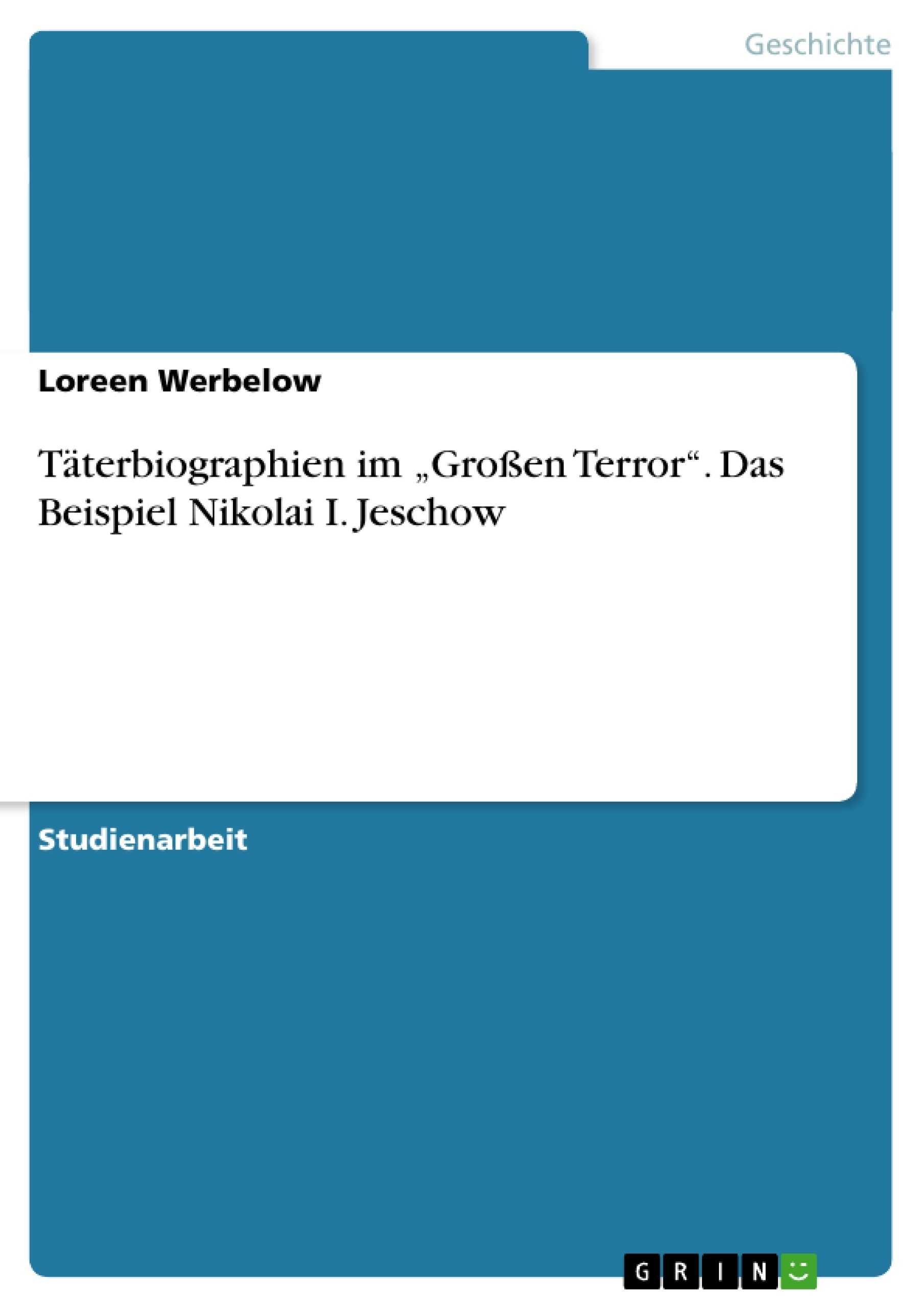Während die Säuberungen in den zwanziger Jahren im Stalinismus den Ausschluss der Oppositionellen sowie aller Abweichler der vorherrschenden Ideologie bedeutete, deren Isolierung bis hin zur sozialen Deklassierung reichte, begann im Jahr 1936 in der Sowjetunion eine Zeit, die sich grundlegend von der voran gegangenen unterschied: Die „Säuberungen“ bedeuteten nun Verbannung und Tod und wandelten sich in eine physische Vernichtung. Doch nicht nur die russische Bevölkerung war die Zielscheibe dieser Vorhaben ‐ bereits seit 1919 wurden auch Mitglieder des Politbüros liquidiert.
Die Person Nikolai Iwanowitsch Jeschow ist zu dieser Zeit hervorzuheben ‐ er bildete die neue Führungskraft des NKWD, in welcher der Terror in der Sowjetunion in den Jahren 1937/38 unvorstellbare Ausmaße annahm und zahlreiche Menschenleben forderte. Ziel war die Vernichtung aller Kräfte, die in irgendeiner misslichen Situation, wie einer Krise oder einem Krieg, einen Gegenpol zur Stalin‐Herrschaft hätten bilden können
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Archivalien und Forschungsstand
- Historischer Kontext - Der Weg in den Terror
- Die „kleine Brombeere“ - Ein biographischer Exkurs
- Die neue Täterforschung - eine neue Perspektive auf den „Großen Terror“ in den Jahren 1936-1938
- Grundlegende Erkenntnisse der neueren Täterforschung
- Die biographischen und generationellen Aspekte im Kontext des Nikolai I. Jeschow
- Jeschows institutionell geformte Handlungspraxis
- Die situativen und sozialpsychologischen Aspekte im Falle Jeschow
- Zusammenfassung und Schlussbemerkung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Persönlichkeit Nikolai Iwanowitsch Jeschows im Kontext des „Großen Terrors“ in der Sowjetunion von 1936-1938 und analysiert sein Handeln vor dem Hintergrund der neueren Täterforschung. Die Arbeit strebt danach, zu verstehen, welche Faktoren zur Ausübung von Gewalt durch Jeschow geführt haben, und ob er von ideologischen Motiven oder eher von sozialpsychologischen und situativen Aspekten beeinflusst wurde.
- Der „Große Terror“ in der Sowjetunion 1936-1938
- Die Rolle von Nikolai Iwanowitsch Jeschow als Führungskraft des NKWD
- Die neue Täterforschung und ihre Anwendung auf den Stalinismus
- Die Bedeutung von biographischen, generationellen und institutionellen Faktoren für die Tätermotivation
- Der Einfluss von situativen und sozialpsychologischen Aspekten auf das Handeln von Jeschow
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung erläutert die spezifische Situation in der Sowjetunion nach 1936, in der der Terror eine neue Dimension erreichte. Sie stellt die Person Nikolai Iwanowitsch Jeschow als zentrale Figur in dieser Zeit vor und führt die Frage nach den Motiven der Täter ein.
- Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über die relevanten Archivalien und den aktuellen Forschungsstand zum „Großen Terror“ in der Sowjetunion.
- Im dritten Kapitel wird der historische Kontext des „Großen Terrors“ in der Sowjetunion dargestellt.
- Das vierte Kapitel bietet einen biographischen Einblick in die Person Nikolai Iwanowitsch Jeschow.
- Im fünften Kapitel wird die neue Täterforschung vorgestellt und ihre Anwendung auf den „Großen Terror“ diskutiert. Der Fokus liegt auf den biographischen, generationellen und institutionellen Aspekten von Jeschows Handeln sowie auf den situativen und sozialpsychologischen Aspekten.
Schlüsselwörter
Der „Große Terror“, Nikolai Iwanowitsch Jeschow, NKWD, Täterforschung, Stalinismus, Sowjetunion, 1936-1938, biographische Faktoren, generationelle Aspekte, institutionelle Handlungspraxis, situative Aspekte, sozialpsychologische Aspekte.
- Citar trabajo
- Loreen Werbelow (Autor), 2014, Täterbiographien im „Großen Terror“. Das Beispiel Nikolai I. Jeschow, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275547