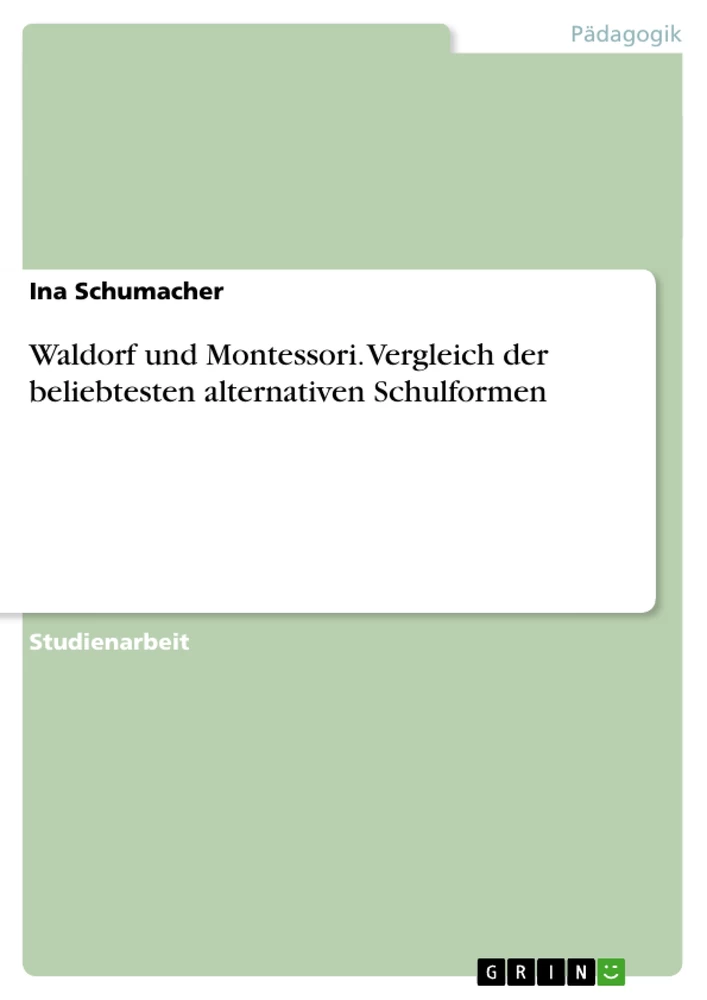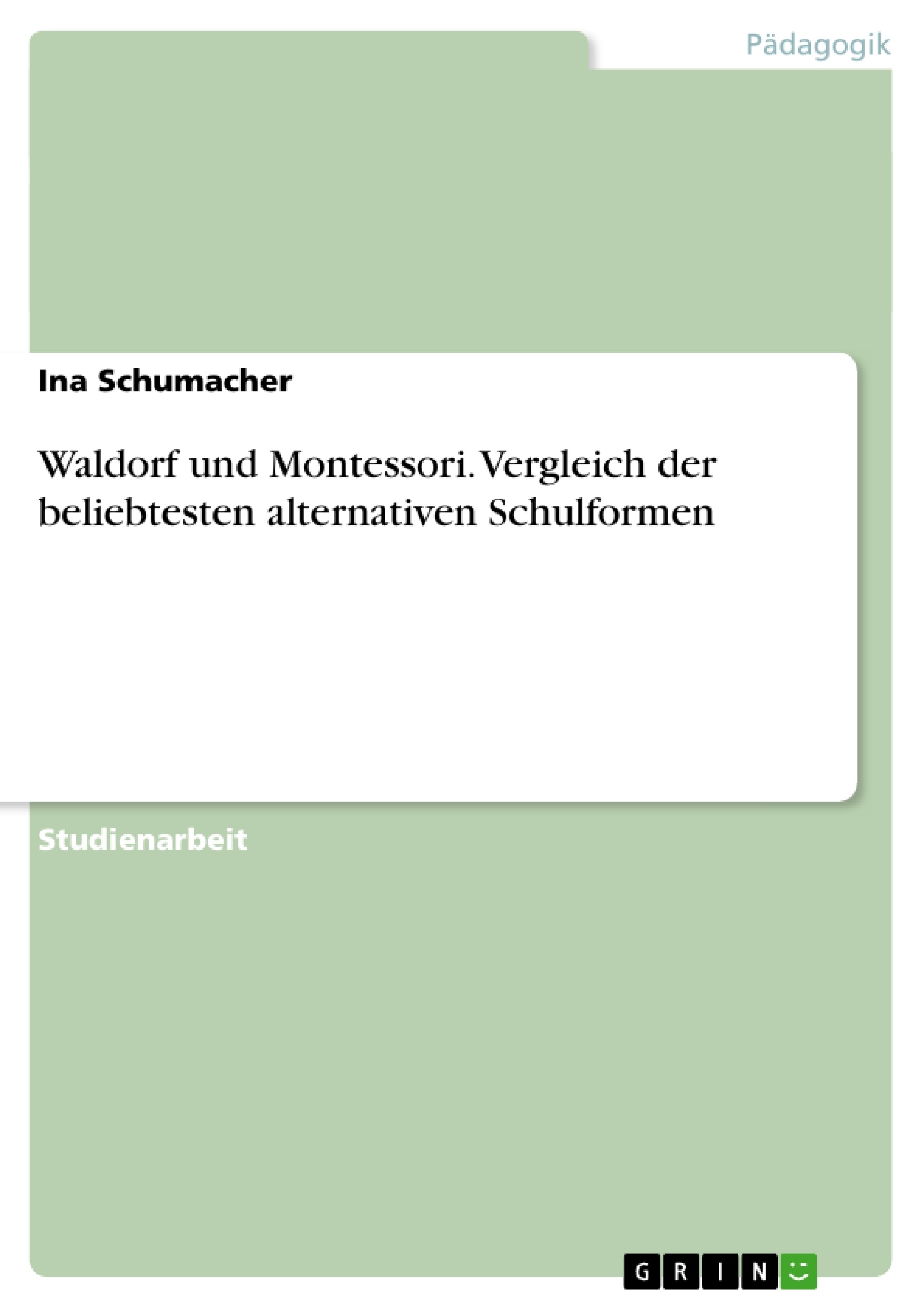Ein Grund, warum Waldorfschulen und Montessorischulen so häufig in einem Kontext thematisiert werden, ist der, dass diese beiden Schulformen die beliebtesten alternativen Schulformen darstellen. Insgesamt gestaltet sich ein direkter Vergleich jedoch schwieriger, als man meint.
Um einen Überblick zu liefern, soll im Verlauf dieser Arbeit, anhand der als wichtig erachteten Aspekte, ein Vergleich der Reformkonzepte Montessoris und Waldorf angestellt werden. Hierbei wirdfin verkürzter Form auf die Grundprinzipien der beiden eingegangen. Innerhalb dieses Aspekts soll auf das Menschenbild, die Rolle des Lehrers und auf charakteristische Merkmale der Unterrichtsgestaltung eingegangen werden. Hier sollen vor allem praktische/unterrichtliche Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Die theoretischen Bezüge sollen lediglich dem Verständnis dienen und werden, aufgrund ihrer Komplexität (insbesondere bei der Steiner-Theorie), reduziert dargestellt. Desweiteren soll eine kompakte Gegenüberstellung erfolgen, bei der auch zuvor nicht berücksichtigte Aspekte erwähnt werden sollen. Mit einem abschließendem Fazit soll noch einmal resümierend dargestellt werden, dass beide Konzepte, sofern man ihren theoretischen Überbau berücksichtigt, nicht so leichtfertig in einem Atemzug genannt werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zu den Personen
- Kurzbiographie von Maria Montessori: (1870-1952)
- Kurzbiographie von Rudolf Steiner: 1861-1925
- Blick auf das Kind vor Montessori
- Grundprinzipien
- Montessoris Bild vom Kind (S.17-24)
- Das anthroposophische Menschenbild bei Steiner
- Die Rolle des Erziehers (Montessori)
- Die Rolle des Erziehers (Steiner)
- Didaktik
- Vorbereitete Umgebung (Montessori)
- Das Lernen (Waldorf)
- Die Materialien (Montessori)
- Unterricht/Klassen/Methode (Waldorf)
- Vergleichspunkte im Überblick
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die pädagogischen Konzepte von Maria Montessori und Rudolf Steiner in einem umfassenden Vergleich zu betrachten. Im Fokus stehen die Grundprinzipien, die Rolle des Erziehers und die didaktischen Ansätze beider Schulformen.
- Das Menschenbild in der Montessori- und Waldorf-Pädagogik
- Die Rolle des Erziehers in beiden Schulformen
- Didaktische Ansätze und Unterrichtsmethoden
- Vergleichende Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden
- Relevanz der beiden Konzepte für die heutige Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz eines Vergleichs zwischen Montessori- und Waldorf-Pädagogik. Die Kurzbiografien von Maria Montessori und Rudolf Steiner beleuchten die Lebenswege der beiden Pädagogen und ihre prägenden Erfahrungen, die ihre pädagogischen Konzepte beeinflusst haben. Im Kapitel "Blick auf das Kind vor Montessori" wird die Sichtweise auf das Kind im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert dargestellt und Montessoris Kritik an den bestehenden Erziehungsmethoden aufgezeigt.
Das Kapitel "Grundprinzipien" behandelt die zentralen Ansätze der beiden Pädagogen. Montessoris Bild vom Kind als "absorbierender Geist" und "Baumeister des eigenen Ichs" wird erläutert, während Steiners anthroposophisches Menschenbild mit seinen vier Wesensgliedern vorgestellt wird. Die Rolle des Erziehers wird in beiden Kapiteln detailliert betrachtet, wobei Montessoris passive Rolle und Steiners stärkere Vorbildfunktion im Vordergrund stehen.
Das Kapitel "Didaktik" beleuchtet die didaktischen Ansätze beider Schulformen. Montessoris Konzept der vorbereiteten Umgebung und die Bedeutung der Sinnesmaterialien werden erläutert. Der klassische Frontalunterricht in der Waldorfpädagogik sowie die Epochenmethode und die Bedeutung der Bewegung und der künstlerisch-musischen Bildung werden vorgestellt.
Das Kapitel "Vergleichspunkte im Überblick" fasst die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Montessori- und Waldorf-Pädagogik zusammen. Die beiden Schulformen werden hinsichtlich ihrer Ansätze zur Entwicklungsphasen, dem Anlage-Konzept, dem Unterricht und der Finanzierung verglichen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Montessori-Pädagogik, die Waldorfpädagogik, das Menschenbild, die Rolle des Erziehers, die Didaktik, die vorbereitete Umgebung, die Sinnesmaterialien, der Frontalunterricht, die Epochenmethode, die Bewegungserziehung, die künstlerisch-musische Bildung und den Vergleich beider Schulformen.
- Quote paper
- Ina Schumacher (Author), 2011, Waldorf und Montessori. Vergleich der beliebtesten alternativen Schulformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275243