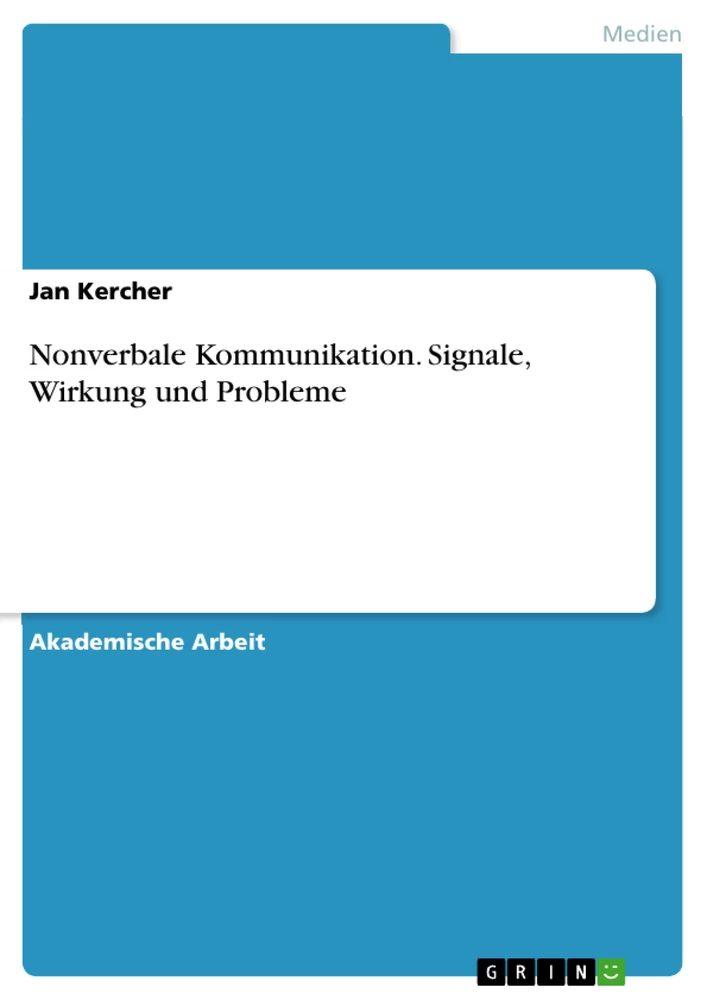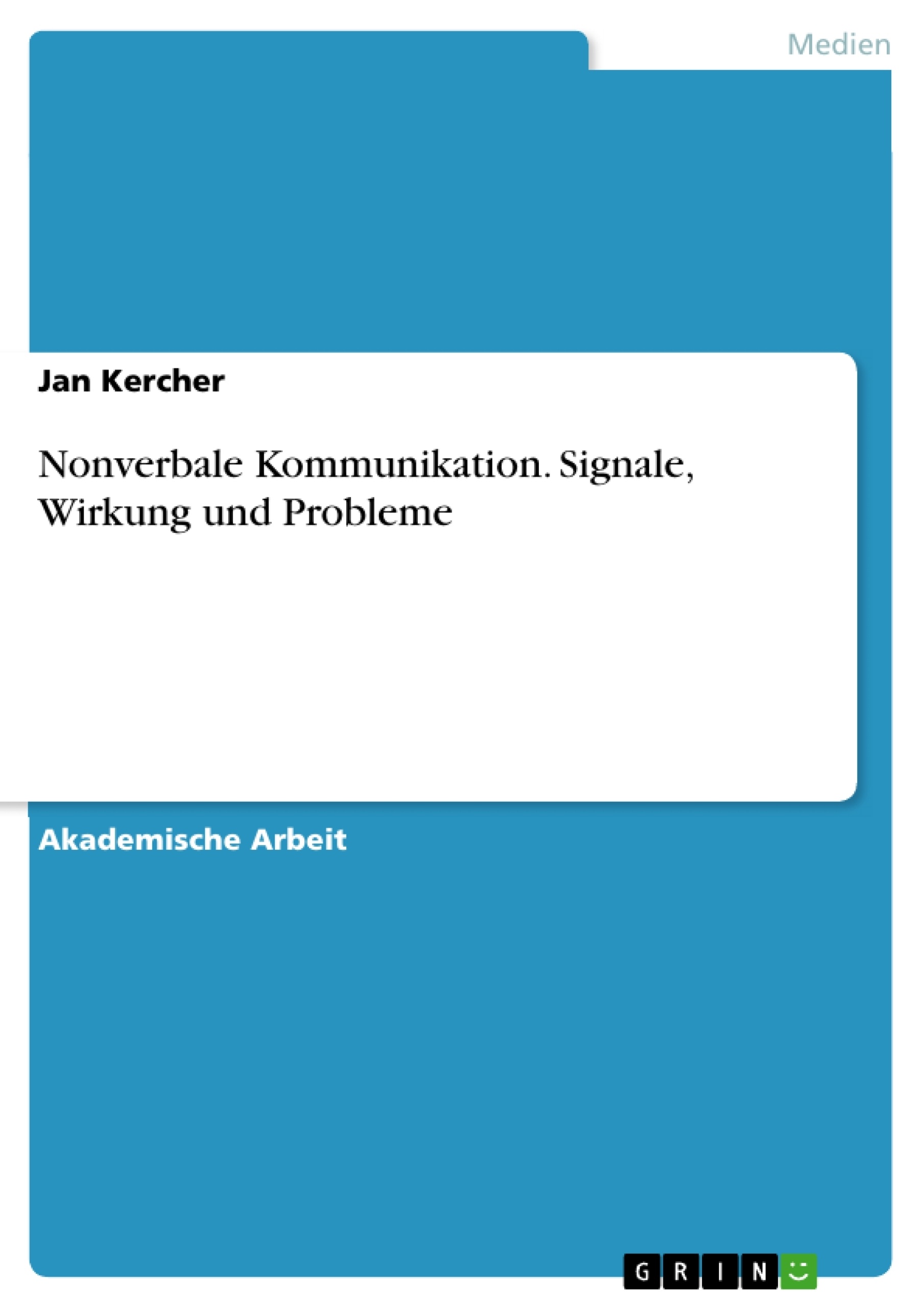Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Funktionieren, aber auch mit den möglichen Störungen und Problemen der zwischenmenschlichen Verständigung. Hierbei werden wir uns vorwiegend auf die nonverbale Kommunikationsebene konzentrieren, wobei es sich aber nicht verhindern läßt, teilweise zur Erklärung verbale Aspekte mit einzubeziehen.
Es gibt verschiedene Ansätze zur Klärung der verschiedenen Ebenen oder Funktionen zwischenmenschlicher ‚Nachrichtenübermittlung‘. Der bekannteste ist sicherlich der Ansatz Watzlawicks mit seinen vier pragmatischen Axiomen und den zwei Ebenen der Kommunikation.
Es gibt jedoch noch einige andere Ansätze, von denen hier mindestens zwei erwähnenswert scheinen. Der älteste Ansatz von Bühler unterscheidet „drei Aspekte der Sprache“:
Darstellung, Ausdruck und Appell. Der neueste Ansatz stammt von Friedemann Schulz von Thun und verbindet die beiden älteren Ansätze Bühlers und Watzlawicks. Hierbei verlagert er gleichzeitig den Fokus von der Makro-Ebene (= Kommunikation/Sprache) auf die Mikro-Ebene (= einzelne Nachricht): unterschieden werden „vier Seiten einer Nachricht“ : Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Da dieser Ansatz unserer Meinung nach besonders gut geeignet ist, um Funktionen und Funktionieren menschlicher Kommunikation zu erklären, liegen unseren nachfolgenden Ausführungen verstärkt Erklärungsansätze Schulz von Thuns zu Grunde.
aus dem Inhalt:
- Funktionen nonverbaler Kommunikation;
- bewusste und unbewusste Signale;
- Wirkungen und Probleme
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Funktionen und Funktionieren nonverbaler Kommunikation
- Die Ebenen der nonverbalen Kommunikation
- Bewußte Signale
- Unbewusste Signale
- Der Gesichtsausdruck - auch eine Form der Kommunikation
- Territorialität — Der Umgang mit Raum
- Wirkungen und Probleme der nonverbalen Kommunikation
- Der erste Eindruck
- Der Pygmalion-Effekt
- Das Feedback
- Kongruentes und inkongruentes Verhalten
- Ein Problem des Empfängers — die Vielfalt der möglichen Ursachen
- Schluss
- Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Funktionsweise der nonverbalen Kommunikation und beleuchtet gleichzeitig die möglichen Störungen und Probleme der zwischenmenschlichen Verständigung. Sie konzentriert sich dabei hauptsächlich auf die nonverbale Kommunikationsebene, wobei es jedoch notwendig ist, teilweise verbale Aspekte mit einzubeziehen, um die Funktionsweise der nonverbalen Kommunikation zu erklären.
- Die verschiedenen Ebenen und Funktionen der nonverbalen Kommunikation
- Die Bedeutung von bewussten und unbewussten Signalen in der nonverbalen Kommunikation
- Die Auswirkungen der nonverbalen Kommunikation auf den ersten Eindruck und die Beziehung zwischen Menschen
- Die Herausforderungen und Probleme der nonverbalen Kommunikation, wie z.B. Fehlinterpretationen und Inkongruenzen
- Die Bedeutung von Metakommunikation und der bewussten Nutzung nonverbaler Signale für eine effektive Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der nonverbalen Kommunikation ein und skizziert die verschiedenen Ansätze zur Klärung der Ebenen und Funktionen der zwischenmenschlichen Kommunikation. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem Ansatz von Schulz von Thun gewidmet, der die „vier Seiten einer Nachricht" - Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell - hervorhebt. Dieser Ansatz wird als besonders geeignet angesehen, um die Funktionen und das Funktionieren menschlicher Kommunikation zu erklären.
Kapitel 2 beleuchtet die Funktionsweise der nonverbalen Kommunikation und betont, dass es nicht um reine Informationsübermittlung geht, sondern um die Übermittlung von „Nachrichten", die auch ausschließlich nonverbal übermittelt werden können. Jede Nachricht hat vier Seiten: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Die letzten drei Seiten werden überwiegend nonverbal übermittelt, während der Sachinhalt überwiegend digital übermittelt wird.
Kapitel 3 befasst sich mit den Ebenen der nonverbalen Kommunikation und stellt fest, dass es unmöglich ist, ein „Wörterbuch" der Körpersprache zu erstellen, da Körpersprache immer mehrdeutig und deshalb auch immer mißverständlich ist. Die Interpretation nonverbaler Signale hängt von vielen Faktoren ab, wie z.B. der Situation, der Stimmung, der Persönlichkeit der Beteiligten, der sozialen Schicht, dem Geschlecht, der Nationalität oder dem Kulturkreis. Die Kapitel gliedert die nonverbalen Kommunikationsformen in verschiedene Kategorien, wie z.B. kinästhetische, visuelle, auditive, olfaktorische und gustatorische Signale.
Kapitel 4 unterscheidet zwischen bewussten und unbewussten Gesten. Zu den bewussten Gesten zählen technische, mimische, schematische, symbolische und kodierte Gesten. Diese Gesten sind relativ eindeutig und werden im Alltag oft als Sprachersatz eingesetzt. Im Gegensatz dazu stehen die affektiven und unbewussten Signale, bei deren Deutung oft Mißverständnisse entstehen.
Kapitel 5 konzentriert sich auf unbewusste Signale, insbesondere den Gesichtsausdruck und die Territorialität. Der Gesichtsausdruck ist zwar oft mit Emotionen verbunden, doch wie Versuche gezeigt haben, ist es nicht möglich, anhand von fotografierten Gesichtsausdrücken die zugehörige Emotion eindeutig zu ermitteln. Unterbewußte körpersprachliche Signale sind zu einem großen Teil sozial bedingt und können je nach Situation beim selben Menschen vollkommen unterschiedlich ausfallen. Der Umgang mit dem Raum, die Territorialität, ist ein weiteres Beispiel für zumeist unterbewußte körpersprachliche Regeln. Jeder Mensch hat eine Intimzone, eine persönliche Zone, eine soziale Zone und eine öffentliche Zone, die von verschiedenen Faktoren abhängen und kulturell unterschiedlich ausgeprägt sind.
Kapitel 6 beleuchtet die Wirkungen und Probleme der nonverbalen Kommunikation. Da Metakommunikation immer mehrdeutig ist, kann sie vom Empfänger anders interpretiert werden, als vom Sender geplant. Der erste Eindruck, der von einem Menschen vermittelt wird, wird zu 95% von nonverbalen Signalen bestimmt und kann leicht falsch sein, wenn diese Signale fehlinterpretiert werden. Dies kann zum Pygmalion-Effekt führen, bei dem ein falscher erster Eindruck dazu führt, dass der andere nach dem eigenen Bild von ihm verändert wird. Die Qualität einer Kommunikation wird stark durch das Feedback auf die Signale des Gesprächspartners beeinflusst. Kongruentes Verhalten, bei dem verbale und nonverbale Botschaften übereinstimmen, erleichtert die Kommunikation. Inkongruentes Verhalten, bei dem verbale und nonverbale Botschaften widersprüchlich sind, kann zu Missverständnissen und Konflikten führen. Die Probleme der nonverbalen Kommunikation liegen oft auf der Empfangsseite, da der Empfänger als interpretierende und reagierende Instanz über den Verlauf der Kommunikation entscheidet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die nonverbale Kommunikation, die Funktionen und das Funktionieren nonverbaler Kommunikation, die Ebenen der nonverbalen Kommunikation, bewusste und unbewusste Signale, der Gesichtsausdruck, Territorialität, Wirkungen und Probleme der nonverbalen Kommunikation, der erste Eindruck, der Pygmalion-Effekt, Feedback, kongruentes und inkongruentes Verhalten, Metakommunikation, Fehlinterpretationen, Missverständnisse, Konflikte und die Bedeutung der nonverbalen Kommunikation im Alltag.
- Quote paper
- Jan Kercher (Author), 2001, Nonverbale Kommunikation. Signale, Wirkung und Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275226