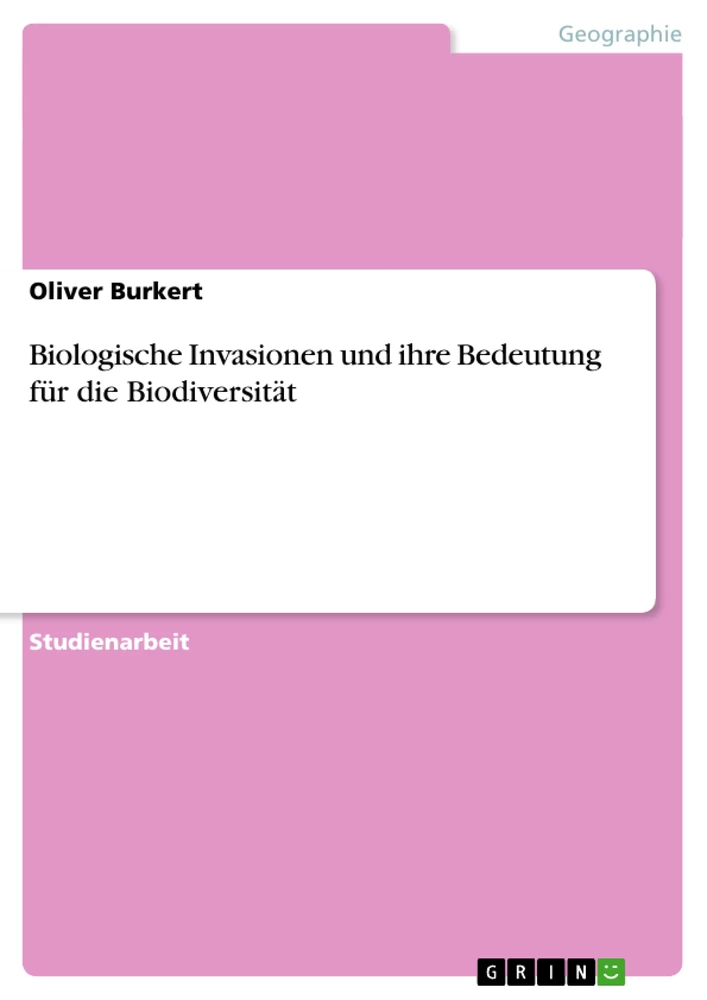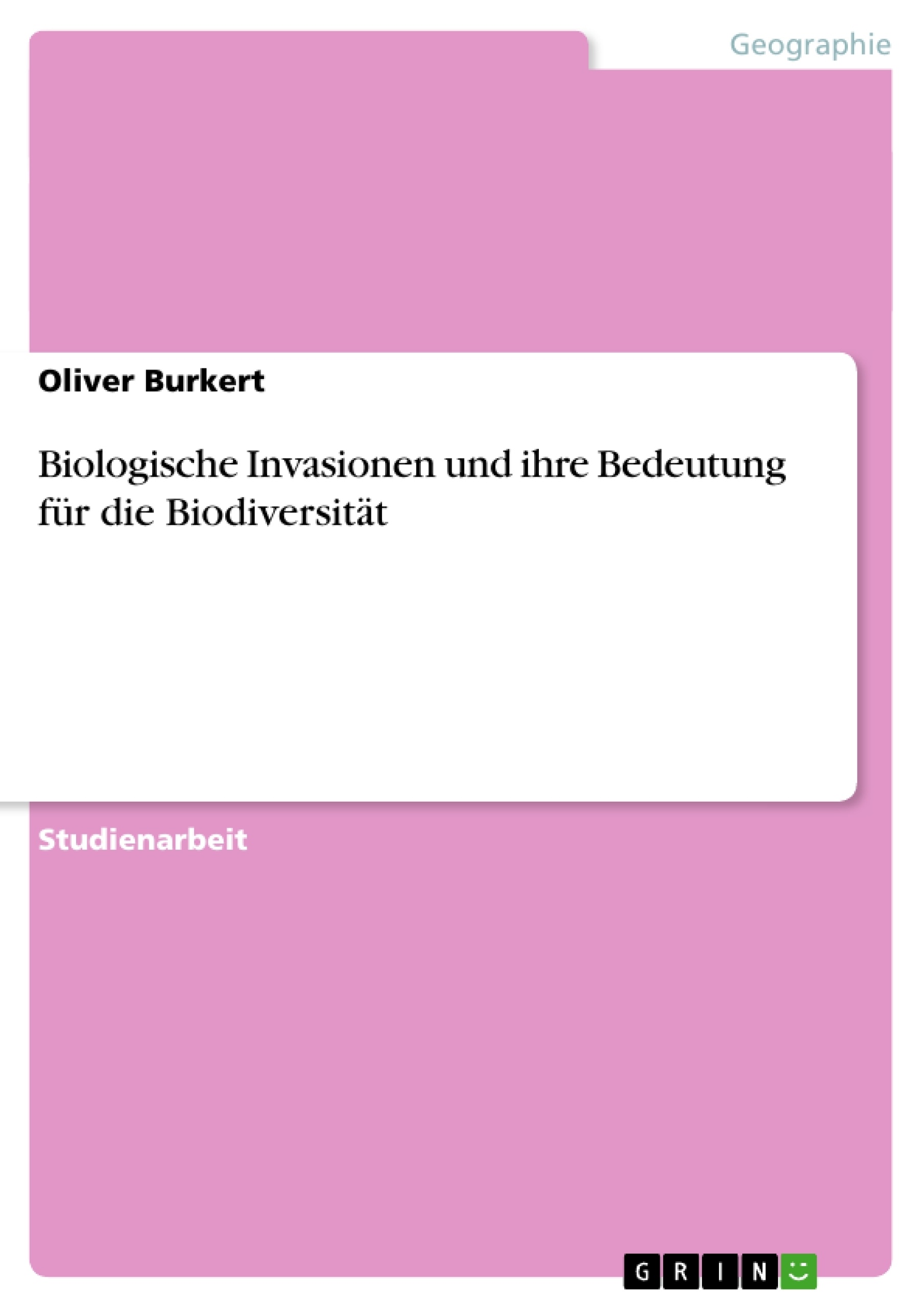In den Medien werden sie meist als „Aliens, Eindringlinge, Kolonisten [oder] Fremdlinge“ (MERTENS, 23.07.2003) betitelt und mit überwiegend negativen Eigenschaften versehen: Pflanzen und Tiere, die durch direkte oder indirekte Hilfe des Menschen Gebiete außerhalb ihres ursprünglichen Verbreitungsareals besiedeln und sich dort ausbreiten. Diese Form der Arealerweiterung nennt man biologische Invasionen.
Sie wirken sich auf die „räumliche (...) Erscheinung der Lebensgemeinschaften von Tieren und/oder Pflanzen sowie deren funktionellem Mitwirken im (...) Ökosystem“ (LESER 1997: 87) aus und sind daher Thema im Rahmen der Biogeographie und der vorliegenden Abhandlung.
Meine Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Während in Kapitel 1 die Terminologie zum Thema dargestellt wird, zeigt das zweite Kapitel Möglichkeiten der Einführung bzw. Einschleppung gebietsfremder Arten und die Rolle des Menschen dabei auf. Kapitel 3 setzt sich mit dem Ablauf des Invasionsprozesses und einigen seiner Einflussfaktoren auseinander. Abschließend werden im vierten Kapitel die Auswirkungen biologischer Invasionen auf die Biodiversität diskutiert.
Da diese Arbeit nicht das ganze Spektrum des The mas abdecken kann, beschränkt sie sich in ihren Beispielen - trotz des globalen Auftretens von biologischen Invasionen - auf Pflanzen und Tiere, die in den mitteleuropäischen Raum eingeführt und eingeschleppt wurden.
Den Literaturschwerpunkt bilden das im Jahr 2003 erschienene Werk „Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa“ des Berliner Ökologen Ingo Kowarik sowie zwei Publikationen des Rostocker Zoologen Ragnar Kinzelbach.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Terminologie
- Von einheimischen und nicht-einheimischen Organismen
- Sonderfall: Bundesnaturschutzgesetz
- Biologische Invasionen und die Rolle des Menschen
- Absichtliche Einführungen
- Unabsichtliche Einschleppungen
- Sekundäre Ausbringungen
- Der Invasionsmechanismus
- Der Invasionsprozess als Modell
- Time-Lags
- Erfolg und Prognose biologischer Invasionen
- Auswirkungen biologischer Invasionen auf die Biodiversität
- Biodiversitätskonvention
- Bereicherung oder Gefahr?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen biologischer Invasionen, die Ausbreitung von Pflanzen und Tieren außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebietes mit Hilfe des Menschen. Die Zielsetzung besteht darin, die Terminologie zu klären, die Mechanismen der Invasion zu beleuchten und die Auswirkungen auf die Biodiversität zu diskutieren. Der Fokus liegt dabei auf Beispielen aus dem mitteleuropäischen Raum.
- Definition und Abgrenzung von einheimischen und nicht-einheimischen Organismen
- Rolle des Menschen bei der absichtlichen und unabsichtlichen Einführung gebietsfremder Arten
- Der Invasionsprozess: Modell, Time-Lags und Erfolgsfaktoren
- Auswirkungen biologischer Invasionen auf die Biodiversität: Bereicherung oder Gefahr?
- Relevanz des Bundesnaturschutzgesetzes im Umgang mit eingebürgerten Arten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema biologische Invasionen ein, definiert den Begriff und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Sie betont die negative Konnotation, die diese Arten in den Medien häufig erfahren, und kündigt die vier Kapitel an, die sich mit Terminologie, Einführungswegen, dem Invasionsprozess und den Auswirkungen auf die Biodiversität befassen. Die Arbeit fokussiert auf Beispiele aus Mitteleuropa und benennt die wichtigsten Literaturquellen.
Terminologie: Dieses Kapitel klärt zentrale Begriffe wie Neobiota, Neozoen, Neophyten, Archäozoen und Archäophyten. Es differenziert zwischen einheimischen und nicht-einheimischen Organismen, etablierten und unbeständigen Taxa, sowie Agriophyten/ -zoen und Epökophyten/ -zoen. Besonderes Augenmerk wird auf die Definitionen im Kontext des Bundesnaturschutzgesetzes gelegt, welches eingebürgerte nicht-einheimische Arten unter bestimmten Bedingungen als heimisch einstufen kann. Die Bedeutung dieser unterschiedlichen Definitionen für den Umgang mit gebietsfremden Arten wird hervorgehoben. Das Kapitel illustriert die Anzahl der Neozoen und Neophyten in Deutschland mit statistischen Daten und einer Abbildung.
Biologische Invasionen und die Rolle des Menschen: Dieses Kapitel analysiert die Rolle des Menschen bei der Verbreitung gebietsfremder Arten. Es unterscheidet zwischen absichtlichen Einführungen (z.B. zur landwirtschaftlichen Nutzung oder als Zierpflanzen), unabsichtlichen Einschleppungen (z.B. durch den Welthandel) und sekundären Ausbringungen (z.B. durch Ausbreitung aus Gärten). Die verschiedenen Wege der Verbreitung werden detailliert dargestellt, wobei der Schwerpunkt auf dem anthropogenen Einfluss liegt. Die Kapitel beleuchtet den Einfluss des Menschen als entscheidenden Faktor für die Überwindung räumlicher Ausbreitungsbarrieren durch die Organismen.
Der Invasionsmechanismus: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Prozess der biologischen Invasion. Es präsentiert ein Modell des Invasionsprozesses, das verschiedene Phasen von der Ankunft bis zur Etablierung umfasst. Der Begriff "Time-Lags" wird eingeführt und erklärt, d.h. die Zeitverzögerung zwischen der Einführung und dem Beginn einer erfolgreichen Ausbreitung. Der Einflussfaktoren auf den Erfolg einer biologischen Invasion werden analysiert, um die Vorhersagbarkeit von Invasionen zu diskutieren. Das Kapitel verbindet die verschiedenen Aspekte des Invasionsprozesses und diskutiert die Herausforderungen, die mit der Prognose des Erfolgs von biologischen Invasionen verbunden sind.
Auswirkungen biologischer Invasionen auf die Biodiversität: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen von biologischen Invasionen auf die Biodiversität. Es bezieht sich auf die Biodiversitätskonvention und diskutiert die Frage, ob biologische Invasionen eine Bereicherung oder eine Gefahr für die Biodiversität darstellen. Das Kapitel wird sich mit den komplexen Interaktionen zwischen invasiven und einheimischen Arten auseinandersetzen und die potenziellen positiven und negativen Folgen beleuchten. Es wird wahrscheinlich unterschiedliche Perspektiven und mögliche Folgen im Detail vorstellen.
Schlüsselwörter
Biologische Invasionen, Neobiota, Neozoen, Neophyten, Biodiversität, Bundesnaturschutzgesetz, Invasionsmechanismus, anthropogener Einfluss, Gebietsfremde Arten, Einbürgerung, Mitteleuropa.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Biologische Invasionen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über das Thema biologische Invasionen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Klärung der Terminologie, der Analyse der Invasionsmechanismen und der Diskussion der Auswirkungen auf die Biodiversität, insbesondere im mitteleuropäischen Raum.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Die Einleitung führt in das Thema ein. Das Kapitel "Terminologie" klärt wichtige Begriffe wie Neobiota, Neozoen und Neophyten und deren Bedeutung im Kontext des Bundesnaturschutzgesetzes. Das Kapitel "Biologische Invasionen und die Rolle des Menschen" analysiert den menschlichen Einfluss auf die Verbreitung gebietsfremder Arten. "Der Invasionsmechanismus" beschreibt den Prozess der biologischen Invasion, inklusive Time-Lags und Erfolgsfaktoren. Schließlich untersucht das Kapitel "Auswirkungen biologischer Invasionen auf die Biodiversität" die komplexen Interaktionen zwischen invasiven und einheimischen Arten und deren Folgen für die Biodiversität.
Welche Arten von biologischen Invasionen werden betrachtet?
Das Dokument betrachtet sowohl absichtliche Einführungen gebietsfremder Arten (z.B. als Nutzpflanzen oder Zierpflanzen) als auch unabsichtliche Einschleppungen (z.B. durch den Welthandel) und sekundäre Ausbringungen (z.B. Ausbreitung aus Gärten). Der Schwerpunkt liegt auf dem anthropogenen Einfluss als entscheidender Faktor für die Verbreitung.
Welche Rolle spielt das Bundesnaturschutzgesetz?
Das Bundesnaturschutzgesetz spielt eine wichtige Rolle bei der Definition und Einstufung von einheimischen und nicht-einheimischen Arten. Das Dokument beleuchtet, wie das Gesetz eingebürgerte nicht-einheimische Arten unter bestimmten Bedingungen als heimisch einstufen kann und welche Bedeutung dies für den Umgang mit gebietsfremden Arten hat.
Wie wird der Invasionsmechanismus erklärt?
Der Invasionsmechanismus wird anhand eines Modells erklärt, welches die verschiedenen Phasen von der Ankunft bis zur Etablierung einer invasiven Art umfasst. Der Begriff "Time-Lags" (Zeitverzögerung zwischen Einführung und erfolgreicher Ausbreitung) wird erläutert, und es werden Einflussfaktoren auf den Erfolg einer Invasion analysiert, um die Vorhersagbarkeit von Invasionen zu diskutieren.
Welche Auswirkungen haben biologische Invasionen auf die Biodiversität?
Das Dokument diskutiert die komplexen Auswirkungen biologischer Invasionen auf die Biodiversität. Es bezieht sich auf die Biodiversitätskonvention und beleuchtet sowohl potenziell positive als auch negative Folgen, wobei die Frage, ob biologische Invasionen eine Bereicherung oder eine Gefahr darstellen, im Detail behandelt wird.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit biologischen Invasionen relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Biologische Invasionen, Neobiota, Neozoen, Neophyten, Biodiversität, Bundesnaturschutzgesetz, Invasionsmechanismus, anthropogener Einfluss, gebietsfremde Arten, Einbürgerung und Mitteleuropa.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument ist für Personen gedacht, die sich akademisch mit dem Thema biologische Invasionen auseinandersetzen möchten. Es dient als umfassende Informationsquelle und bietet eine strukturierte Darstellung des komplexen Themas.
- Quote paper
- Oliver Burkert (Author), 2003, Biologische Invasionen und ihre Bedeutung für die Biodiversität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27518