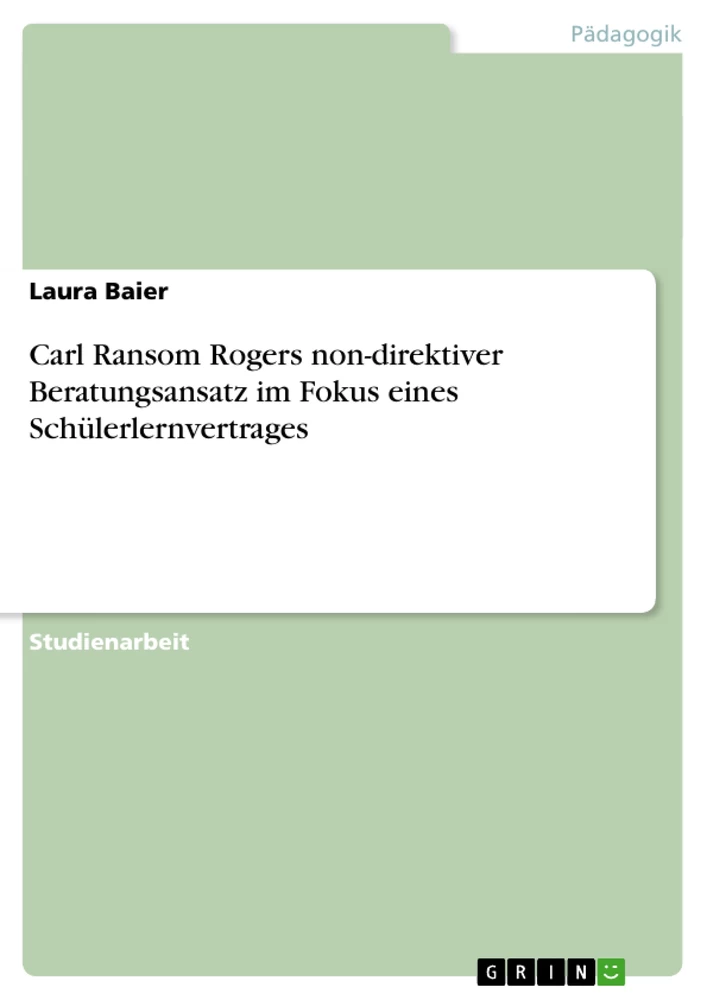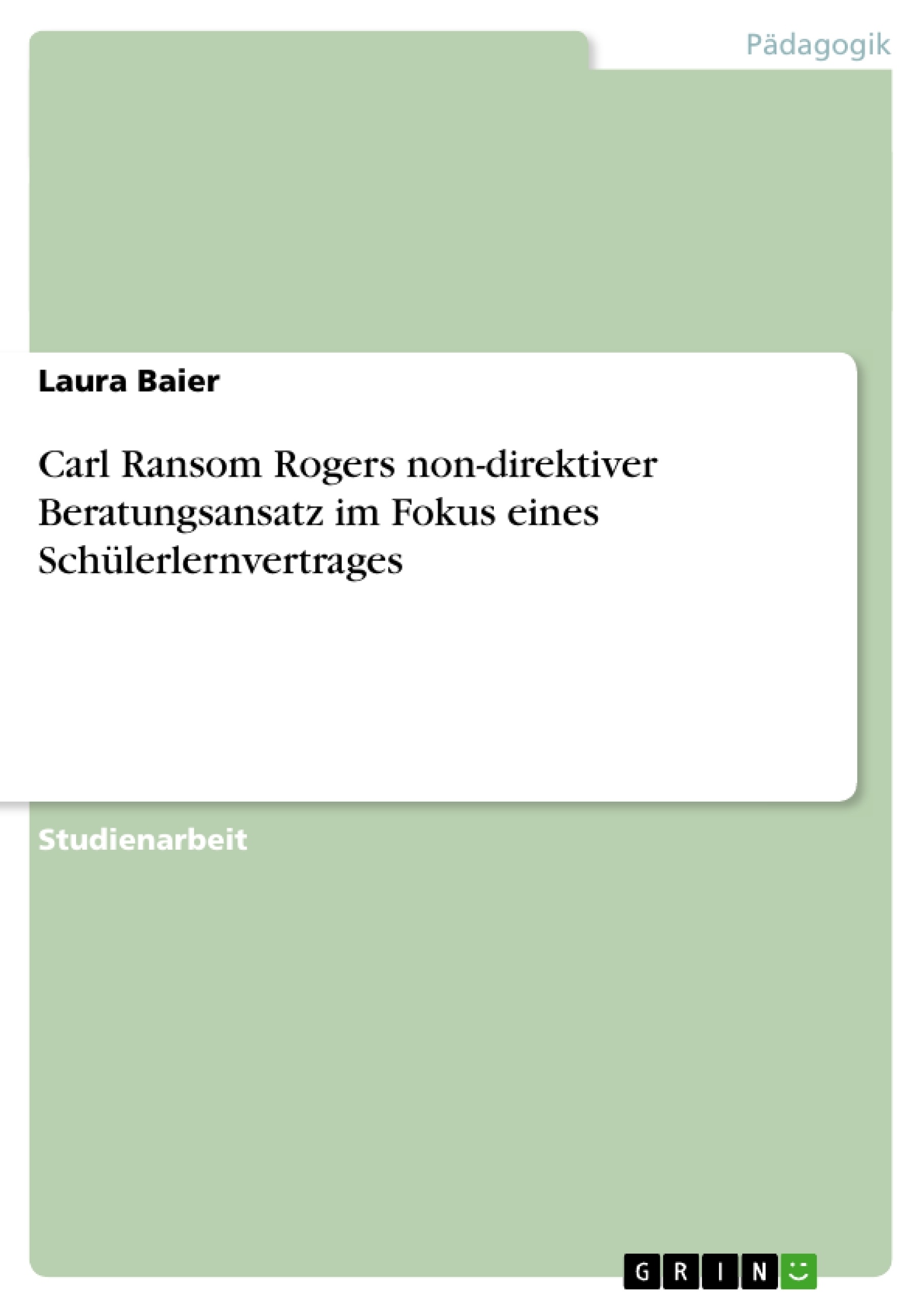Der non-direktive Beratungsansatz geht auf Carl Ransom Rogers, einen in den USA tätig gewesenen Psychologen, zurück. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes stehen im Idealfall der Ratsuchende und sein Potential (klientel- bzw. personenzentrierter Ansatz) , nicht die inhaltliche Ebene des an den Berater herangetragenen Problems oder der Berater selbst. Wie kann man mit diesem zurückhaltenden Gesprächskonzept einen Schülerlernvertrag erstellen? Überlegungen und eigene Erfahrungen als Praktikantin werden in dieser Hausarbeit zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rolle und Ziele des non-direktiven Beratungsansatzes
- Die Entwicklung eines Schülerlernvertrages im Beratungsgespräch
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des non-direktiven Beratungsansatzes nach Rogers in der Entwicklung eines Schülerlernvertrages. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung im Gespräch mit einem Schüler und der Parallele zum biologischen Lernprozess nach Vester. Die Arbeit analysiert die Prozessstruktur des Beratungsgesprächs und die Förderung der Selbstwirksamkeit des Schülers.
- Non-direktiver Beratungsansatz nach Rogers
- Entwicklung eines Schülerlernvertrages
- Förderung der Selbstwirksamkeit
- Parallelen zum biologischen Lernprozess
- Praktische Anwendung der Beratungstechniken
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Bezug zu Vesters Werk „Denken, lernen, vergessen“ her. Sie kündigt die Analyse des non-direktiven Beratungsansatzes und dessen Anwendung bei der Erstellung eines Schülerlernvertrages mit einem 6. Klässler namens Keith an. Der Fokus liegt auf der Parallele zwischen dem iterativen Prozess der Vertragserstellung und Vesters Visualisierungen des Lernprozesses, sowie auf der Förderung von Keiths Selbstwirksamkeit. Die Arbeit verspricht eine Analyse der Prozessstruktur und ihrer Bedeutung für den Lernerfolg.
Rolle und Ziele des non-direktiven Beratungsansatzes: Dieses Kapitel beschreibt den non-direktiven Beratungsansatz nach Rogers, der sich auf den Ratsuchenden und sein Potential konzentriert. Der Begriff „nicht-direktiv“ bezieht sich auf die Haltung des Beraters, die auf Wertschätzung, Empathie und Authentizität basiert. Die Ziele des Ansatzes sind die Selbstexploration des Ratsuchenden und dessen bessere Anpassung an seine Lebenssituation. Der Ansatz fördert die Selbsthilfe durch gezielte Fragen und Reflexion, wobei die Akzeptanz des Ist- und Soll-Zustandes eine wichtige Rolle spielt. Das Kapitel betont die aktivierende Rolle des Ansatzes für den Ratsuchenden und die zurückhaltende Führungsrolle des Beraters, im Einklang mit humanistischen psychologischen Prinzipien.
Die Entwicklung eines Schülerlernvertrages im Beratungsgespräch: Dieses Kapitel dokumentiert ein Beratungsgespräch mit dem 13-jährigen Keith, der Schwierigkeiten im Geschichtsunterricht hat und auffälliges Verhalten im Schulhof zeigt. Das Kapitel beschreibt detailliert den Verlauf des Gesprächs, von der anfänglichen Unsicherheit Keiths bis zur gemeinsamen Entwicklung einer Prozessstruktur für sein Lernen. Die Prozessstruktur, visualisiert auf Kärtchen, ähnelt Vesters Darstellung des biologischen Lernprozesses und berücksichtigt verschiedene Lernkanäle. Das Gespräch gipfelt in der Vereinbarung eines Lernvertrages, der Keiths Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit stärken soll. Der Fokus liegt auf der aktiven Beteiligung Keiths an der Gestaltung der Lösung und der positiven Entwicklung seiner Motivation und seines Selbstvertrauens.
Schlüsselwörter
Non-direktiver Beratungsansatz, Carl Rogers, Schülerlernvertrag, Selbstwirksamkeit, biologisches Lernen, Frederic Vester, Gesprächsführung, Motivation, Reflexion, Selbsthilfe.
Häufig gestellte Fragen zu: Anwendung des non-direktiven Beratungsansatzes nach Rogers in der Entwicklung eines Schülerlernvertrages
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendung des non-direktiven Beratungsansatzes nach Rogers bei der Entwicklung eines Schülerlernvertrages. Im Fokus steht die praktische Umsetzung im Gespräch mit einem Schüler und die Parallele zum biologischen Lernprozess nach Vester. Analysiert werden die Prozessstruktur des Beratungsgesprächs und die Förderung der Selbstwirksamkeit des Schülers.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den non-direktiven Beratungsansatz nach Rogers, die Entwicklung eines Schülerlernvertrages, die Förderung der Selbstwirksamkeit, Parallelen zum biologischen Lernprozess nach Vester und die praktische Anwendung der Beratungstechniken. Ein detailliertes Beratungsgespräch mit einem Schüler (Keith) wird dokumentiert und analysiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Rolle und den Zielen des non-direktiven Beratungsansatzes, ein Kapitel zur Entwicklung des Schülerlernvertrages im Beratungsgespräch und ein Fazit/Ausblick. Die Einleitung stellt den Bezug zu Vesters Werk „Denken, lernen, vergessen“ her und beschreibt den Fall des Schülers Keith. Die Kapitel beschreiben den theoretischen Hintergrund und die praktische Anwendung des Ansatzes.
Was ist der non-direktive Beratungsansatz nach Rogers?
Der non-direktive Beratungsansatz nach Rogers konzentriert sich auf den Ratsuchenden und sein Potential. Die Haltung des Beraters basiert auf Wertschätzung, Empathie und Authentizität. Ziele sind Selbstexploration und bessere Anpassung an die Lebenssituation. Der Ansatz fördert die Selbsthilfe durch gezielte Fragen und Reflexion, wobei die Akzeptanz des Ist- und Soll-Zustandes wichtig ist. Der Berater nimmt eine zurückhaltende Führungsrolle ein.
Wie wird der Schülerlernvertrag entwickelt?
Die Entwicklung des Schülerlernvertrages wird anhand eines Beratungsgesprächs mit dem 13-jährigen Keith dokumentiert. Das Kapitel beschreibt den Gesprächsverlauf detailliert, von Keiths anfänglicher Unsicherheit bis zur gemeinsamen Entwicklung einer Prozessstruktur für sein Lernen. Die Prozessstruktur ähnelt Vesters Darstellung des biologischen Lernprozesses und berücksichtigt verschiedene Lernkanäle. Der Vertrag soll Keiths Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit stärken.
Welche Rolle spielt der biologische Lernprozess nach Vester?
Die Arbeit stellt Parallelen zwischen dem iterativen Prozess der Vertragserstellung und Vesters Visualisierungen des biologischen Lernprozesses her. Die Prozessstruktur, die im Beratungsgespräch mit Keith entwickelt wird, ähnelt Vesters Darstellung und soll das Verständnis des Lernprozesses verbessern und die Wirksamkeit des Lernvertrages erhöhen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Non-direktiver Beratungsansatz, Carl Rogers, Schülerlernvertrag, Selbstwirksamkeit, biologisches Lernen, Frederic Vester, Gesprächsführung, Motivation, Reflexion, Selbsthilfe.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Wirksamkeit des non-direktiven Beratungsansatzes bei der Entwicklung von Schülerlernverträgen und zur Bedeutung der Förderung der Selbstwirksamkeit. Ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten wird gegeben (im Fazit/Ausblick).
- Quote paper
- Laura Baier (Author), 2013, Carl Ransom Rogers non-direktiver Beratungsansatz im Fokus eines Schülerlernvertrages, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/275140