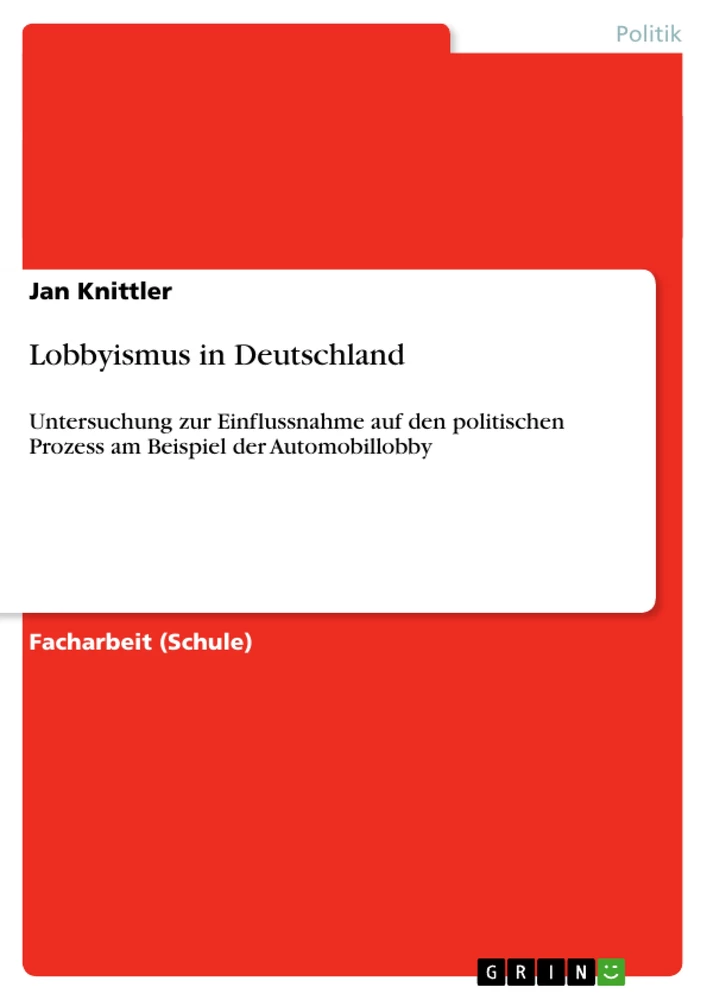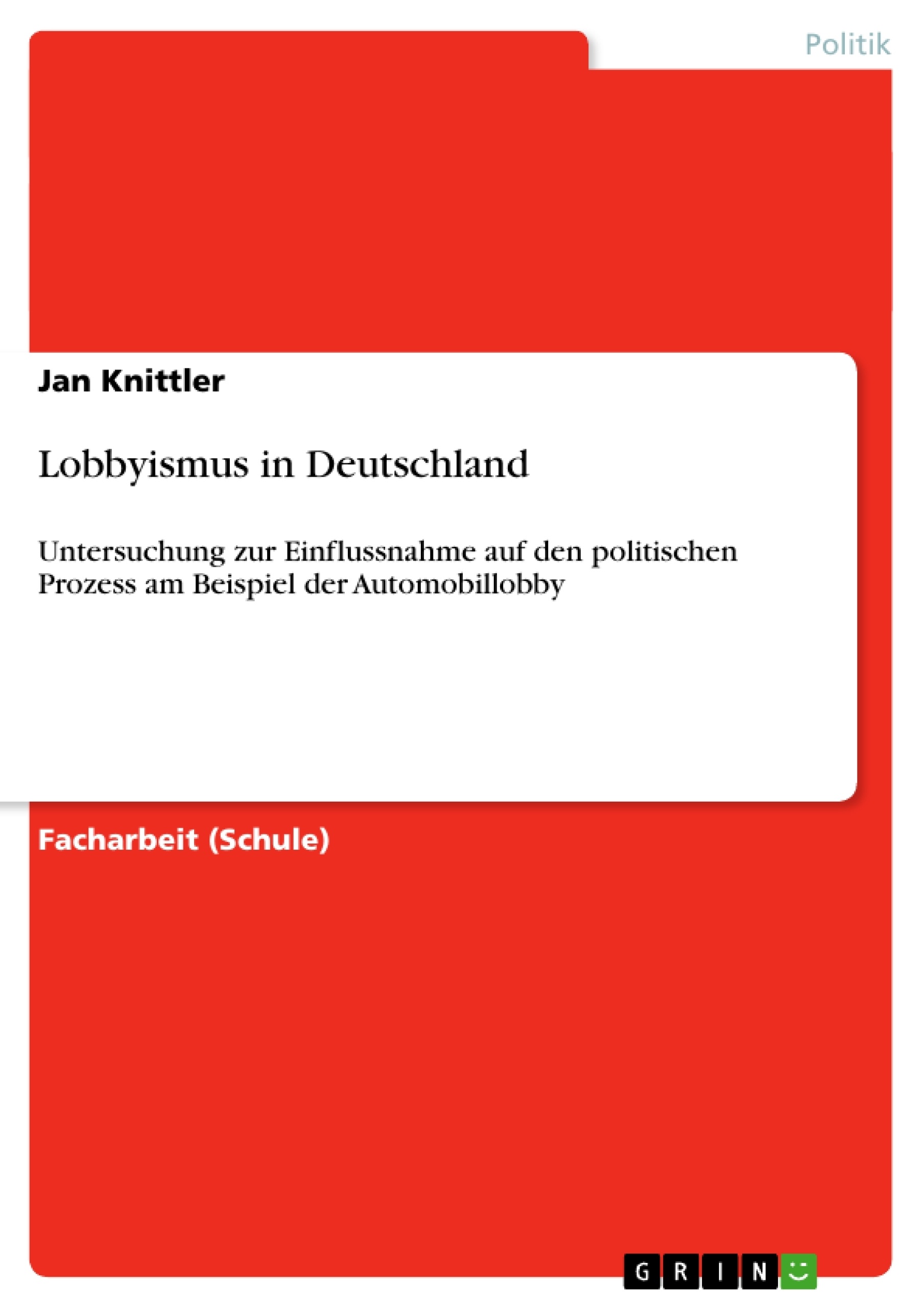Lobbyismus wird in den Medien der BRD (Bundesrepublik Deutschland) oft negativ dargestellt. Die Frage, die daraus natürlich resultiert, ist, ob die Lobbyisten in Deutschland zu viel Einfluss auf den politischen Prozess in der BRD nehmen und wie dieser Einfluss legitimiert wird. In dieser Arbeit werden zuerst einmal der Begriff Lobbyismus und die Vorgehensweisen von Lobbyisten definiert und anhand der Automobillobby überprüft, inwiefern Lobbyismus aus Unternehmersicht erfolgreich sowie bezüglich demokratietheoretischer Aspekte legitim ist.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Der Lobbyismus
- Die Akteure im Lobbyismus
- Aufgaben von Lobbyisten
- Aggregation und Selektion von Interessen
- Interessenartikulation
- Mitwirkung am politischen Prozess
- Methoden und Instrumente von Lobbyisten
- Greenwashing
- Grassrootslobbying
- Mulit-Voice-Lobbying
- Revolving-Door Prinzip und Crossing-over
- Die Automobilindustrie
- Die Interessenvertretung der Automobilindustrie
- Die „Seitenwechsel-Problematik“ - Der Fall Klaeden
- Crossing-over - DaimlerChrysler im Verkehrsministerium
- Parteispenden - Das Arrangement der Familie Quandt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Lobbyismus auf den politischen Prozess in Deutschland. Sie definiert den Begriff Lobbyismus und die Vorgehensweisen von Lobbyisten, anhand des Beispiels der Automobilindustrie. Es wird analysiert, inwieweit Lobbyismus aus Unternehmersicht erfolgreich und im Hinblick auf demokratietheoretische Aspekte legitim ist.
- Definition und Charakterisierung von Lobbyismus
- Analyse der Akteure im Lobbyismus
- Methoden und Strategien von Lobbyisten
- Der Einfluss der Automobilindustrie auf die Politik
- Legitimitätsfragen des Lobbyismus
Zusammenfassung der Kapitel
Fragestellung: Die Arbeit stellt die Frage nach dem Einfluss von Lobbyisten auf den politischen Prozess in Deutschland und der Legitimität dieses Einflusses. Der Fokus liegt auf der Definition von Lobbyismus und der Untersuchung seiner Erfolgsfaktoren und demokratischen Implikationen, exemplarisch betrachtet anhand der Automobilindustrie.
Der Lobbyismus: Dieses Kapitel definiert Lobbyismus als die gezielte Beeinflussung von politischen Entscheidungen durch Interessengruppen. Es differenziert zwischen den Zielen verschiedener Interessengruppen wie Unternehmen, Verbände und NPOs und zeigt die verschiedenen Motivationen hinter Lobbying-Aktivitäten auf, beispielsweise den Erhalt des Status Quo, die Interessenvertretung von Mitgliedern oder die Verfolgung gemeinnütziger Ziele. Die unterschiedlichen Zielsetzungen und die damit verbundenen Handlungsstrategien werden hier umfassend beleuchtet.
Die Akteure im Lobbyismus: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Personen und Organisationen, die aktiv Lobbyismus betreiben. Es beschreibt die Rolle von "in-house Lobbying" und externen Agenturen und beleuchtet die verschiedenen Berufsbezeichnungen, die oft anstelle des Begriffs "Lobbyist" verwendet werden, um die negative Konnotation zu vermeiden. Der Fokus liegt auf der Rolle der Akteure innerhalb der komplexen Dynamik des Lobbyismus.
Aufgaben von Lobbyisten: Dieses Kapitel unterteilt die Aufgaben von Lobbyisten in drei Kernaufgaben: Aggregation und Selektion von Interessen (insbesondere bei Verbänden und NPOs), Interessenartikulation (über verschiedene Kanäle, einschließlich direkter Kommunikation mit politischen Entscheidungsträgern und indirekter Beeinflussung über die Medien) und Mitwirkung am politischen Prozess (beispielsweise durch die Bereitstellung von Informationen und Unterstützung bei der Formulierung von Gesetzesentwürfen). Die Interdependenzen und die Herausforderungen dieser Aufgaben werden im Detail untersucht.
Methoden und Instrumente von Lobbyisten: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Methoden, die Lobbyisten zur Durchsetzung ihrer Interessen einsetzen. Es wird Greenwashing als eine Methode zur Verbesserung des öffentlichen Images erläutert. Die Vielfalt und Komplexität der Lobbying-Methoden wird hervorgehoben, obwohl eine umfassende Auflistung aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht möglich ist. Der Schwerpunkt liegt auf der strategischen Verwendung von Instrumenten zur Einflussnahme.
Die Automobilindustrie: Dieses Kapitel (und die folgenden Kapitel zum Einfluss der Automobilindustrie) bildet den empirischen Teil der Arbeit und analysiert den Lobbyismus in diesem Sektor. Es dient dazu, die zuvor eingeführten theoretischen Konzepte anhand eines konkreten Beispiels zu veranschaulichen und zu analysieren.
Schlüsselwörter
Lobbyismus, Interessenvertretung, politische Einflussnahme, Automobilindustrie, Legitimität, Demokratie, Akteure, Methoden, Greenwashing, Interessenartikulation, Agenda-Setting.
Häufig gestellte Fragen zur Lobbyismus-Arbeit: Einfluss der Automobilindustrie auf den politischen Prozess in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Lobbyismus auf den politischen Prozess in Deutschland, insbesondere den Einfluss der Automobilindustrie. Sie analysiert die Legitimität und den Erfolg von Lobbying-Aktivitäten aus unternehmerischer und demokratietheoretischer Perspektive.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakterisierung von Lobbyismus, die Analyse der Akteure (Unternehmen, Verbände, NPOs, Lobbyisten), deren Methoden und Strategien (Greenwashing, Grassrootslobbying, Multi-Voice-Lobbying, Revolving-Door-Prinzip), den Einfluss der Automobilindustrie auf die Politik, sowie die Legitimitätsfragen des Lobbyismus.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Fragestellung und die Zielsetzung erläutert. Es folgen Kapitel zu Lobbyismus allgemein, den Akteuren, deren Aufgaben und Methoden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Automobilindustrie und konkreten Fallbeispielen wie dem "Seitenwechsel-Problematik" - Fall Klaeden und der Rolle von DaimlerChrysler im Verkehrsministerium sowie den Parteispenden der Familie Quandt. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Was sind die Kernaufgaben von Lobbyisten laut der Arbeit?
Die Arbeit unterteilt die Aufgaben von Lobbyisten in drei Kernaufgaben: Aggregation und Selektion von Interessen, Interessenartikulation und Mitwirkung am politischen Prozess. Diese Aufgaben werden detailliert beschrieben und ihre Interdependenzen analysiert.
Welche Methoden des Lobbyismus werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Methoden, darunter Greenwashing, Grassrootslobbying und Multi-Voice-Lobbying. Sie betont die strategische Verwendung von Instrumenten zur Einflussnahme, wobei eine vollständige Auflistung aufgrund des Umfangs der Arbeit nicht möglich ist.
Welche Fallbeispiele werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Lobbyismus der Automobilindustrie anhand konkreter Fallbeispiele, wie die „Seitenwechsel-Problematik“ – Der Fall Klaeden und Crossing-over – DaimlerChrysler im Verkehrsministerium und die Parteispenden der Familie Quandt. Diese dienen der Veranschaulichung der theoretischen Konzepte.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit der Arbeit wird im Dokument nicht explizit wiedergegeben, aber es ist zu erwarten, dass es die Ergebnisse der Analyse des Einflusses von Lobbyismus auf den politischen Prozess und dessen Legitimität zusammenfasst. Die Arbeit untersucht, inwieweit Lobbyismus aus Unternehmersicht erfolgreich und im Hinblick auf demokratietheoretische Aspekte legitim ist.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe der Arbeit sind: Lobbyismus, Interessenvertretung, politische Einflussnahme, Automobilindustrie, Legitimität, Demokratie, Akteure, Methoden, Greenwashing, Interessenartikulation, Agenda-Setting.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum gedacht, welches sich mit dem Thema Lobbyismus und dessen Einfluss auf den politischen Prozess auseinandersetzt. Der Fokus liegt auf einer strukturierten und professionellen Analyse der Thematik.
- Quote paper
- Jan Knittler (Author), 2014, Lobbyismus in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274959