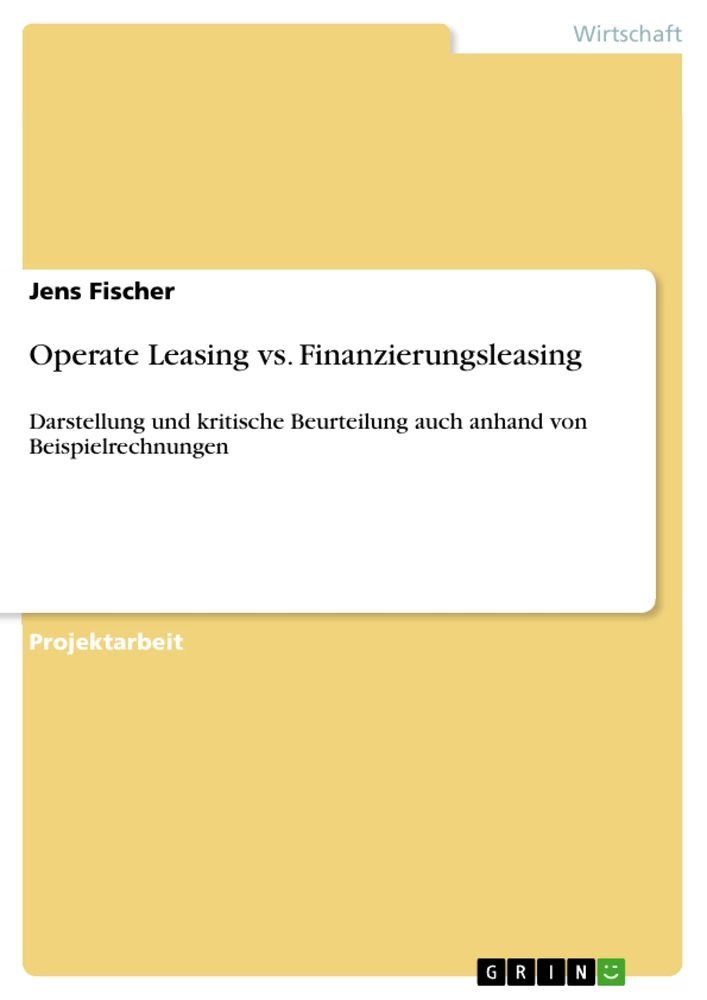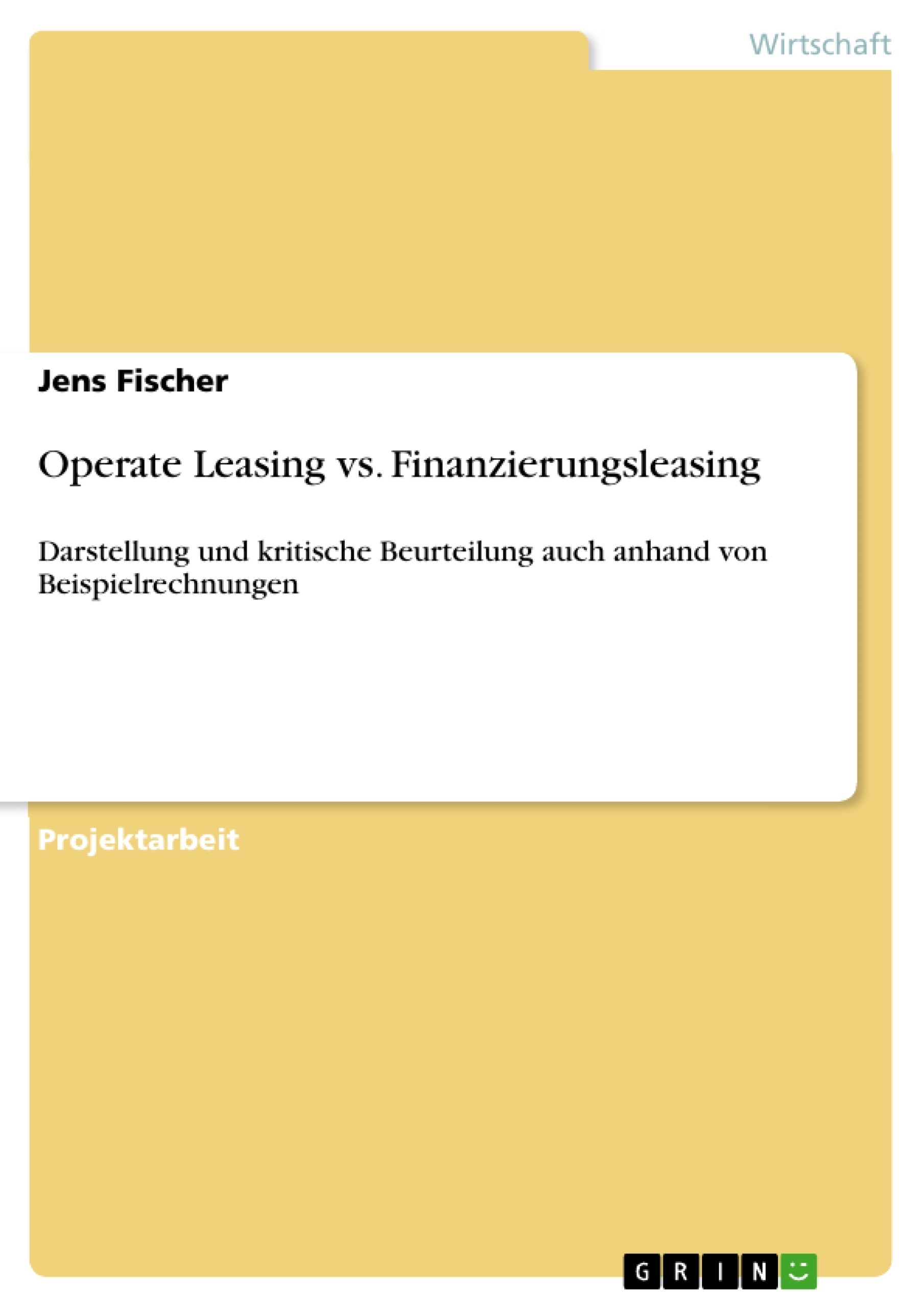Das Thema Leasing wird aktuell kontrovers diskutiert. Unter anderem weil das IASB und das FASB im Rahmen eines gemeinsamen Projekts zur Neuregelung der Leasingbilanzierung nach IFRS am 16. Mai 2013 einen zweiten Exposure Draft (ED) veröffentlichten. Dieser beinhaltet einige Überarbeitungen zum heftig kritisierten ersten Exposure Draft, hält jedoch an der grundlegenden Idee der Abbildung aller mit Leasinggeschäften verbundener Verpflichtungen in der Bilanz des Leasingnehmers über das sogenannte „Right-of-Use“-Modell fest.
Die Änderungen sollen die Bilanzierung von Leasinggegenständen verständlicher und transparenter machen, doch diesem Thema wird sich die Arbeit im Folgenden etwas genauer widmen.
Nun plant ein Unternehmen eine Investition. Es soll eine kleinere Maschine beschafft werden, die im Unternehmen für einen neuen Produktionsschritt benötigt wird. Da das Unternehmen die Investition nicht aus Eigenmitteln tätigen will und es eine durchschnittliche Bonität aufweist, stehen diverse Finanzierungsformen zur Verfügung. Das Unternehmen entschied sich unter diesen Möglichkeiten für Leasing als Finanzierungsform.
Dabei gibt es, unter anderem, das operative Leasing und das Finanzierungsleasing, auch Leasingkauf genannt. Doch welche dieser Formen bringt dem Unternehmen nun mehr Vorteile? Seien sie Kostenvorteile oder Vorteile rechtlicher Natur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Theoretische Grundlagen
- Wie ist Leasing historisch entstanden?
- Welche Leasingformen gibt es?
- Was ist Leasing und wieso ist es für Unternehmen sinnvoll – oder auch nicht - diese Finanzierungsform zu wählen?
- Darstellung des Operate Leasings
- Darstellung des Finanzierungsleasings
- Die bilanzielle Behandlung des Leasings
- Exkurs: Die Bilanzierung von Leasingverhältnissen nach IFRS
- Der kritische Vergleich der beiden Leasingformen
- Der kritische Vergleich von Operate Leasing und Finanzierungsleasing im Bezug auf Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken
- Ausgangslage für die Beispielrechnungen
- Ergebnisse der Beispielrechnungen
- Analyse der Ergebnisse, auch hinsichtlich unterschiedlicher Situationen des Unternehmens
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Projektarbeit zielt darauf ab, Operatives Leasing und Finanzierungsleasing kritisch zu vergleichen und so die in der Problemstellung aufgeworfene Frage nach der vorteilhafteren Finanzierungsform für ein Unternehmen zu beantworten. Der Vergleich umfasst die historische Entwicklung, die rechtlichen und bilanziellen Aspekte sowie Kostenbetrachtungen anhand von Beispielrechnungen. Die steuerliche Behandlung wird nicht berücksichtigt.
- Historische Entwicklung des Leasings
- Rechtliche und bilanzielle Unterschiede zwischen operativem und Finanzierungsleasing
- Kostenvergleich beider Leasingformen anhand von Beispielrechnungen
- Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beider Leasingformen
- Einfluss unterschiedlicher Unternehmenssituationen auf die Wahl der Leasingform
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein, indem es die aktuelle kontroverse Diskussion um die Leasingbilanzierung, insbesondere im Kontext der IFRS-Neuregelung, beleuchtet. Es beschreibt die Problemstellung: Ein Unternehmen möchte eine Maschine finanzieren und muss zwischen operativem und Finanzierungsleasing entscheiden. Die Zielsetzung der Arbeit ist die Klärung dieser Entscheidung durch einen kritischen Vergleich beider Formen. Die Vorgehensweise wird skizziert, welche die theoretischen Grundlagen, den Vergleich und die Analyse von Beispielrechnungen umfasst.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für den Vergleich der Leasingformen. Es beginnt mit einem kurzen historischen Abriss der Entwicklung des Leasings. Es werden verschiedene Leasingformen vorgestellt und die Frage diskutiert, wann und warum Leasing für Unternehmen eine sinnvolle Finanzierungsform darstellt. Im Anschluss werden sowohl operatives als auch Finanzierungsleasing detailliert beschrieben. Die bilanzielle Behandlung nach deutschem Recht wird erläutert, und ein Exkurs beleuchtet die Bilanzierung nach IFRS. Dieser Abschnitt liefert das notwendige Fachwissen für den anschließenden Vergleich.
3 Der kritische Vergleich der beiden Leasingformen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es vergleicht operatives und Finanzierungsleasing umfassend anhand von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Die Ausgangslage für die im Folgenden präsentierten Beispielrechnungen wird definiert. Die Ergebnisse der Beispielrechnungen werden detailliert dargestellt und im Hinblick auf verschiedene Unternehmenssituationen analysiert. Dieser Abschnitt bietet eine fundierte Bewertung der beiden Leasingformen auf Basis konkreter Zahlen und Szenarien.
Schlüsselwörter
Leasing, Operatives Leasing, Finanzierungsleasing, IFRS, Bilanzierung, Kostenvergleich, Stärken-Schwächen-Analyse, Finanzierungsformen, Unternehmen, Beispielrechnungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Projektarbeit: Vergleich Operatives Leasing vs. Finanzierungsleasing
Was ist der Gegenstand dieser Projektarbeit?
Diese Projektarbeit vergleicht operatives und Finanzierungsleasing kritisch, um die vorteilhaftere Finanzierungsform für Unternehmen zu ermitteln. Der Vergleich umfasst historische Entwicklung, rechtliche und bilanzielle Aspekte sowie Kostenbetrachtungen anhand von Beispielrechnungen. Die steuerliche Behandlung wird jedoch nicht berücksichtigt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Leasings, die rechtlichen und bilanziellen Unterschiede zwischen operativem und Finanzierungsleasing, einen Kostenvergleich beider Formen mittels Beispielrechnungen, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beider Leasingformen sowie den Einfluss unterschiedlicher Unternehmenssituationen auf die Wahl der Leasingform.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Abschnitt zu den theoretischen Grundlagen, einen Abschnitt zum kritischen Vergleich der beiden Leasingformen und einen Schlussabschnitt mit Fazit und Ausblick. Die Einleitung beschreibt die Problemstellung und die Zielsetzung. Die theoretischen Grundlagen umfassen die historische Entwicklung des Leasings, verschiedene Leasingformen, die bilanzielle Behandlung nach deutschem Recht und einen Exkurs zur Bilanzierung nach IFRS. Der kritische Vergleich beinhaltet die Analyse von Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken, Beispielrechnungen und die Analyse der Ergebnisse unter Berücksichtigung unterschiedlicher Unternehmenssituationen.
Welche Leasingformen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht detailliert operatives Leasing und Finanzierungsleasing.
Welche Aspekte werden im Vergleich berücksichtigt?
Der Vergleich berücksichtigt die historische Entwicklung, rechtliche und bilanzielle Aspekte (inklusive der Bilanzierung nach IFRS und deutschem Recht), Kostenbetrachtungen anhand von Beispielrechnungen, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beider Leasingformen sowie den Einfluss verschiedener Unternehmenssituationen.
Werden die Ergebnisse der Beispielrechnungen dargestellt?
Ja, die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Beispielrechnungen detailliert und analysiert diese im Hinblick auf unterschiedliche Unternehmenssituationen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit und der Ausblick liefern eine zusammenfassende Bewertung und geben einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen. Die genaue Schlussfolgerung zur vorteilhafteren Finanzierungsform wird im Fazit gezogen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Leasing, Operatives Leasing, Finanzierungsleasing, IFRS, Bilanzierung, Kostenvergleich, Stärken-Schwächen-Analyse, Finanzierungsformen, Unternehmen, Beispielrechnungen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke konzipiert und richtet sich an Leser, die sich mit den Themen Leasing, Finanzierungsformen und Bilanzierung befassen möchten.
- Arbeit zitieren
- Jens Fischer (Autor:in), 2013, Operate Leasing vs. Finanzierungsleasing, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274876