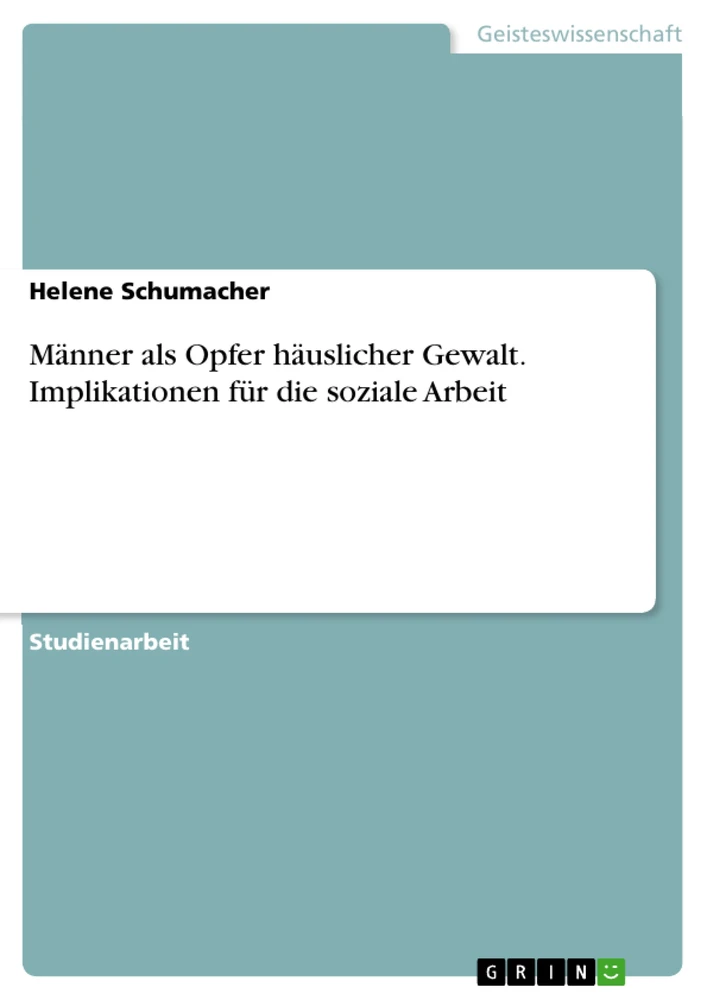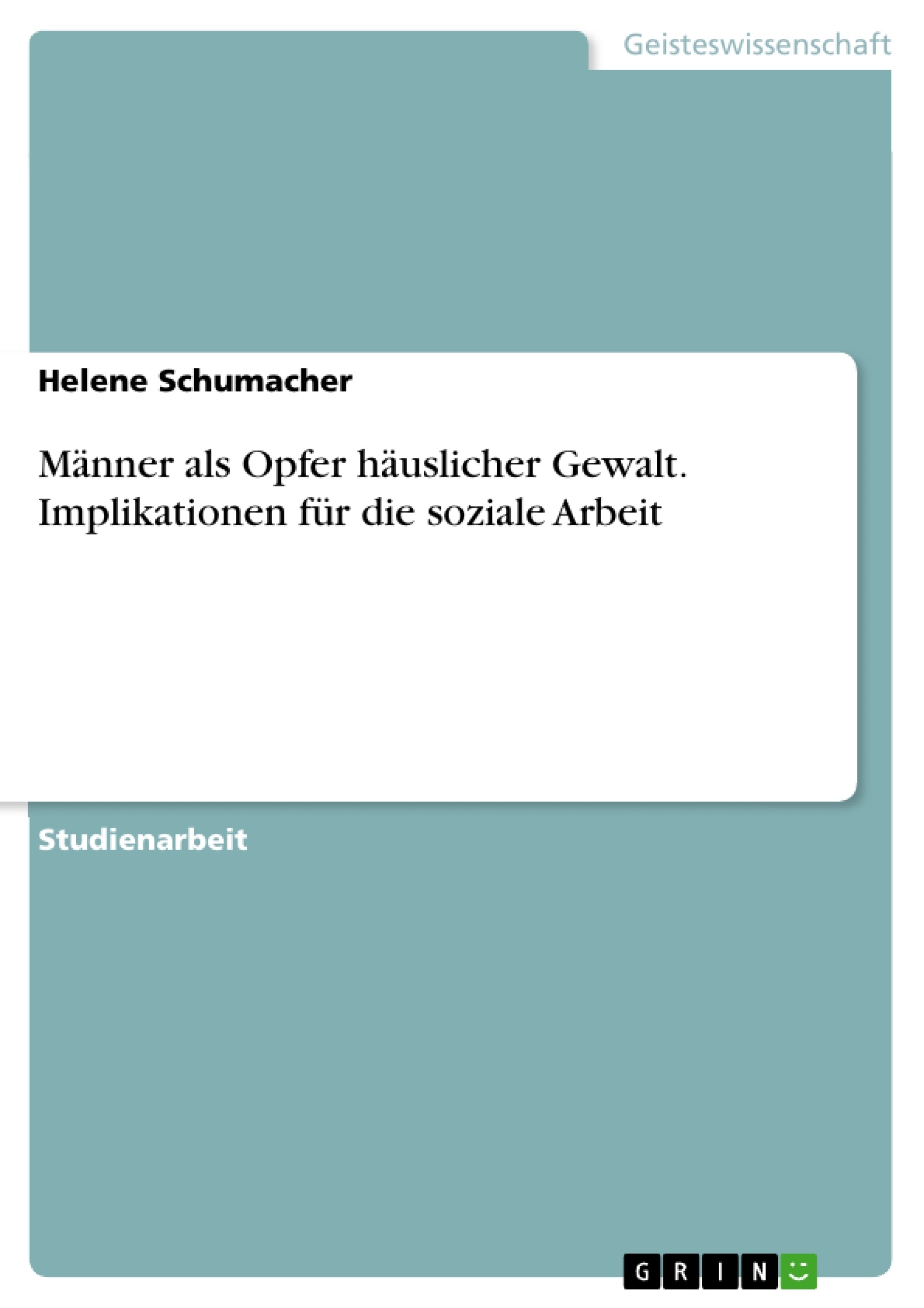Die Problematik das Männer auch Opfer von häuslicher Gewalt sein können, also von ihren Partnerinnen geschlagen werden, ist ein tabuisiertes Thema und ein unerforschtes Feld. Für die Opfer ist es immens mit Scham behaftet, sich zu erkennen zu geben. Von der
Gesellschaft ist es zumeist nicht nachvollziehbar und damit ist der Schritt in die Öffentlichkeit für die Opfer noch schwerer, da sie auf Unverständnis bis hin zu Spott treffen.
Es wird immer wieder angeführt, dass laut polizeilichen Kriminalstatistiken mehr Frauen als Männer Opfer von häuslicher Gewalt werden, aber ist dies wirklich so? Die Zahl der männlichen Opfer steigt von Jahr zu Jahr stetig an und die Dunkelziffer wird hoch eingeschätzt, da es immer noch keine ausreichende Lobby und kein Hilfsnetzwerk für männliche Opfer gibt und dies das Outing noch schwerer gestaltet.
Die Frauenbewegung hat zweifelsohne einen hohen Verdienst an der Aufklärungsarbeit von häuslicher Gewalt aber ist diese vielleicht zu einseitig geworden und wurde dadurch vielleicht zu sehr impliziert, das häusliche Gewalt männliche Gewalt ist? Es tauchen immer mehr kritische Stimmen auf und es wird geforscht ob häusliche Gewalt nicht eher eine menschliche Gewalt ist, die von beiden Geschlechtern ausgeübt und ausgehalten wird. Dies stößt vor allem in feministischen Kreisen auf viel Gegenwehr, doch ist dies nicht ein Paradox, dass man gerade aus dieser Richtung ein Alleinmonopol für die Frau auf den Opferstatus in der häuslichen Gewalt erhebt (vgl. Sticher-Gil 2003: 32f.)?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinition häusliche Gewalt
- Formen der Gewalt
- Unterschiede bei der Ausübung der Gewalt
- Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“
- Dunkelziffer in Bezug auf das Männerbild
- Erklärungsansätze
- Die Gewaltspirale
- Feministische Sichtweise auf die Problematik
- Implikationen für die Soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Tabuthema der häuslichen Gewalt gegen Männer. Ziel ist es, die Problematik aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, insbesondere den hohen Anteil an männlichen Opfern, die Dunkelziffer und die Unterschiede in der Ausübung der Gewalt. Darüber hinaus wird die feministische Sichtweise auf das Thema kritisch hinterfragt. Die Arbeit dient als Grundlage zur Analyse der Implikationen für die Soziale Arbeit.
- Häusliche Gewalt gegen Männer als tabuisiertes Thema
- Unterschiede in der Ausübung der Gewalt zwischen Frauen und Männern
- Dunkelziffer und Männerbild in Deutschland
- Feministische Sichtweise auf die Problematik
- Implikationen für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung befasst sich mit der Tabuisierung der häuslichen Gewalt gegen Männer und der hohen Dunkelziffer. Sie stellt die Frage, ob die Frauenbewegung die Thematik zu einseitig beleuchtet hat und ob häusliche Gewalt nicht eher als menschliche Gewalt anzusehen ist.
- Kapitel 2 legt eine Begriffsdefinition von häuslicher Gewalt fest, wobei der Fokus auf heterosexuelle Partnerschaften liegt. Die Hauptmerkmale häuslicher Gewalt werden erläutert, darunter die emotionale Bindung zwischen Täter und Opfer, das Machtgefälle in der Beziehung und die Verletzung der körperlichen und/oder psychischen Integrität.
- In Kapitel 3 werden fünf verschiedene Formen der häuslichen Gewalt vorgestellt: physische Gewalt, psychische Gewalt, sexuelle Gewalt, ökonomische Gewalt und sozial-interaktive Gewalt.
- Kapitel 4 diskutiert die Unterschiede in der Ausübung der Gewalt zwischen Frauen und Männern. Es wird argumentiert, dass Männer häufiger psychische Gewalt erleben, während Frauen eher physische Gewalt anwenden. Die Gründe hierfür werden im Kontext des Männerbildes und der Scham des Opfers beleuchtet. Die Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“ wird als Beleg für diese These angeführt.
Schlüsselwörter
Häusliche Gewalt, Männer als Opfer, Dunkelziffer, Geschlechterrollen, Feminismus, Soziale Arbeit, Pilotstudie, Machtgefälle, Tabuisierung, Scham, Psychische Gewalt, Physische Gewalt, Sexuelle Gewalt.
- Quote paper
- Helene Schumacher (Author), 2013, Männer als Opfer häuslicher Gewalt. Implikationen für die soziale Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274693