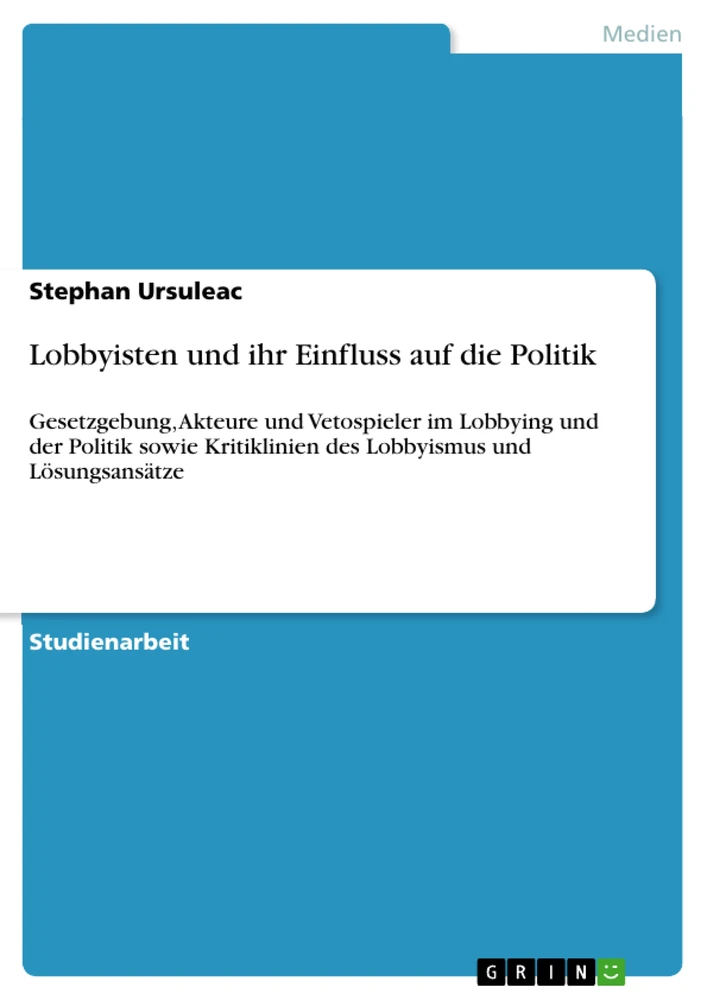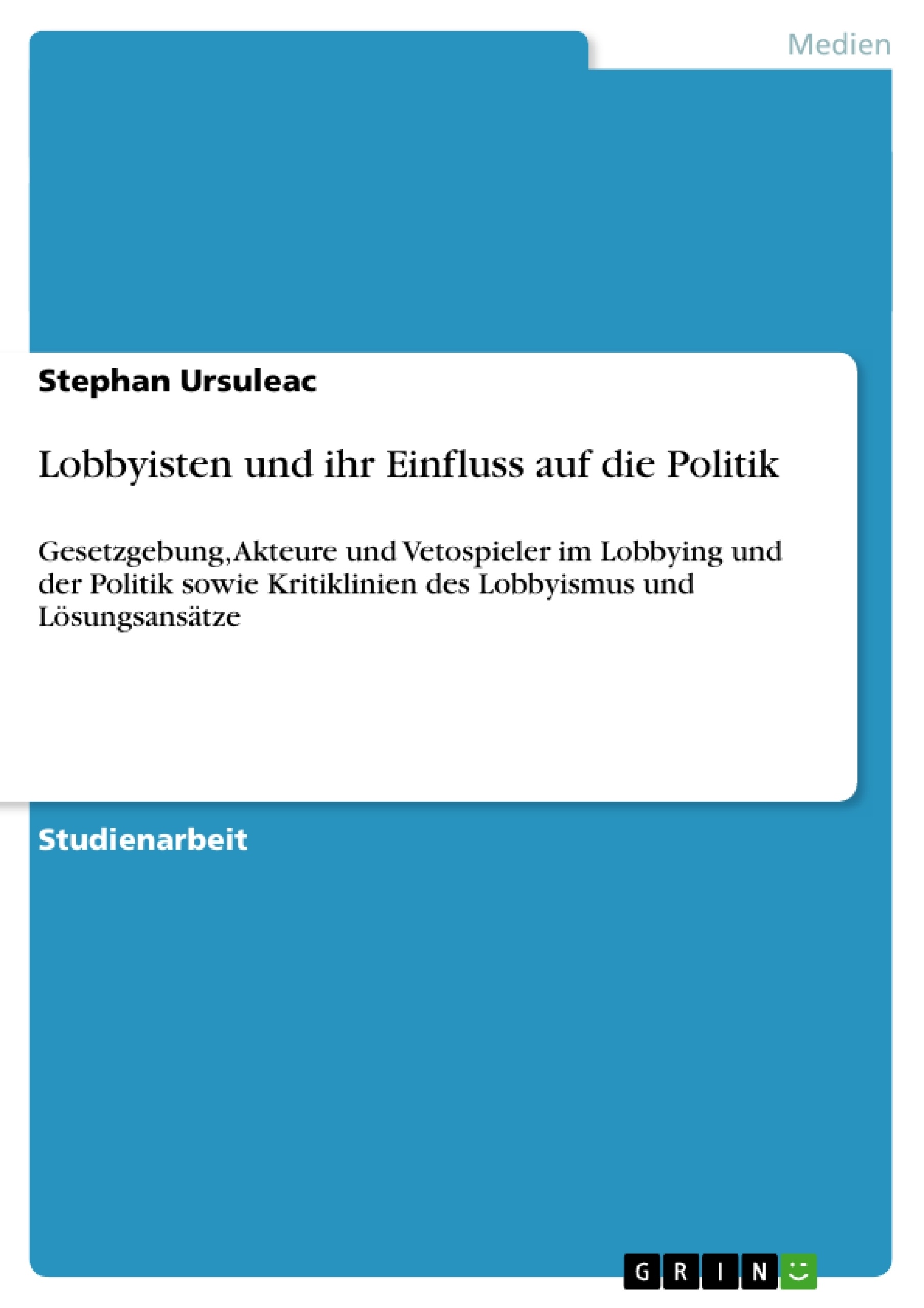Das Verhältnis zum politischen System in Deutschland ist seitens der Bevölkerung durch Misstrauen geprägt. Dies äußert sich darin, dass nur jeder zweite Bundesbürger politischen Institutionen, wie dem Bundestag oder den Parteien, vertraut. Gleichzeitig steigt jedoch der Wunsch nach mehr Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Prozessen. Dabei werden traditionelle Formen, wie das Engagement innerhalb politischer Parteien oder die Teilnahme an Wahlen, immer weniger geschätzt. Dies zeigt sich z. B. durch sinkende Parteimitgliederzahlen und eine stetig abnehmende Wahlbeteiligung. Stattdessen erlangen Beteiligungsmöglichkeiten im vorpolitischen Raum, außerhalb der offiziellen Entscheidungsinstitutionen, immer mehr Bedeutung. Dies äußert sich vor allem an einer immer stärker ausgeprägten Landschaft von Interessenvertretungen im politischen, wirtschaftlichen und sozialem Sinne. Dadurch werden jedoch Entscheidungsprozesse immer intransparenter und es kommen vermehrt Vorwürfe der Vetternwirtschaft auf. Während des Bundestagswahlkampfes 2009 erhielt z. B. die FDP eine Großspende von über einer Millionen Euro durch den Eigentümer der Hotelgruppe Mövenpick. Als die FDP nach der Wahl in der Regierungsverantwortung stand, erfolgte die Verabschiedung eines Gesetzes zur Senkung der Umsatzsteuer auf Hotelübernachtungen von 19 auf sieben Prozent. Darüber hinaus kommt es immer häufiger zu Wechseln von hochrangigen Politikern in die Wirtschaft. Diese verfügen meist über wertvolle Netzwerke zu politischen Entscheidern. Der Wechsel des ehemaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder zum russischen Gasriesen Gazprom ist dafür ein Beispiel, wobei Herr Schröder noch in seiner Amtszeit lukrative Verträge für Gazprom mitverhandelt hatte. Vorwürfe, die Politik würde zunehmend durch einflussreiche Interessenvertreter gelenkt, verstärken sich dadurch.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Fragestellung: „Üben Lobbyisten zu viel Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse aus?“
Dazu sollen zunächst die Prozesse der Gesetzgebung und ihre Akteure betrachtet werden. Im Anschluss werden die Begriffe Lobbyismus sowie die Akteure und Vorgehensweisen untersucht. Abschließend sollen die größten Kritiklinien zum Lobbyismus und mögliche Lösungsansätze diskutiert werden. Dabei wird z. B. ein verpflichtendes Lobbyistenregister gefordert. Die Literaturlage zu diesem Thema ist als ausreichend zu bezeichnen, jedoch wurde eine zusammenhängende Diskussion noch nicht vorgenommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Gesetzgebungsprozess in Deutschland
- Das politische System
- Akteure und Vetospieler
- Lobbying
- Akteure in Deutschland
- Kritiklinien des Lobbyismus
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob Lobbyisten zu viel Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse ausüben. Dazu wird zunächst der Gesetzgebungsprozess in Deutschland und seine Akteure beleuchtet. Anschließend werden der Begriff Lobbyismus sowie die Akteure und Vorgehensweisen im Bereich des Lobbyismus untersucht. Abschließend werden die wichtigsten Kritiklinien zum Lobbyismus und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Die Arbeit erhält damit wissenschaftliche Relevanz, da eine zusammenhängende Diskussion aller hier genannten Aspekte bisher noch nicht stattgefunden hat.
- Der Gesetzgebungsprozess in Deutschland und seine Akteure
- Lobbyismus, Akteure und Vorgehensweisen
- Kritiklinien zum Lobbyismus
- Mögliche Lösungsansätze für die Gestaltung des Lobbyismus
- Wissenschaftliche Relevanz der Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung befasst sich mit dem Misstrauen der Bevölkerung gegenüber dem politischen System in Deutschland, das sich in einer sinkenden Wahlbeteiligung und einer Abnahme von Parteimitgliedschaften zeigt. Im Gegenzug dazu steigt der Wunsch nach mehr Beteiligungsmöglichkeiten an politischen Prozessen. Die Einleitung beleuchtet auch die Rolle von Interessenvertretungen im politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereich und die daraus resultierenden Probleme, wie z. B. die Intransparenz von Entscheidungsprozessen und Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Die Einleitung führt in die Thematik der Hausarbeit ein, die die Frage untersucht, ob Lobbyisten zu viel Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse ausüben.
Der Gesetzgebungsprozess in Deutschland
Dieses Kapitel beschreibt den formalen Prozess der Gesetzgebung in Deutschland, der im Grundgesetz geregelt ist. Es erläutert die Rolle der Bundesregierung, des Bundestags und des Bundesrats bei der Entstehung von Gesetzen. Darüber hinaus werden die Bearbeitungsfristen und das Vorgehen bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen erklärt. Das Kapitel geht auch auf die Rolle anderer Interessenvertreter, wie Verbände, im Vorfeld der Gesetzgebung ein.
Das politische System
Dieses Kapitel befasst sich mit dem politischen System in Deutschland und den Einflüssen, die auf die politischen Akteure wirken. Es beschreibt die Rolle von politischen Parteien, sozialen Bewegungen, Interessenvertretungen, Medien und der Sozialisation der Gesellschaft für die Gesetzgebung und die Bewertung des Regierungshandelns. Das Kapitel betont die Bedeutung von Interessenvertretungen und die Notwendigkeit eines ausgewogenen Systems mit Vetospielern, um einseitige Beeinflussungen zu verhindern.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Hausarbeit sind: Gesetzgebungsprozess, politische Akteure, Lobbyismus, Interessenvertretungen, Kritik am Lobbyismus, Transparenz, Vetternwirtschaft, Vetospieler, wissenschaftliche Relevanz.
- Quote paper
- Dipl. Politologe Stephan Ursuleac (Author), 2014, Lobbyisten und ihr Einfluss auf die Politik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274633