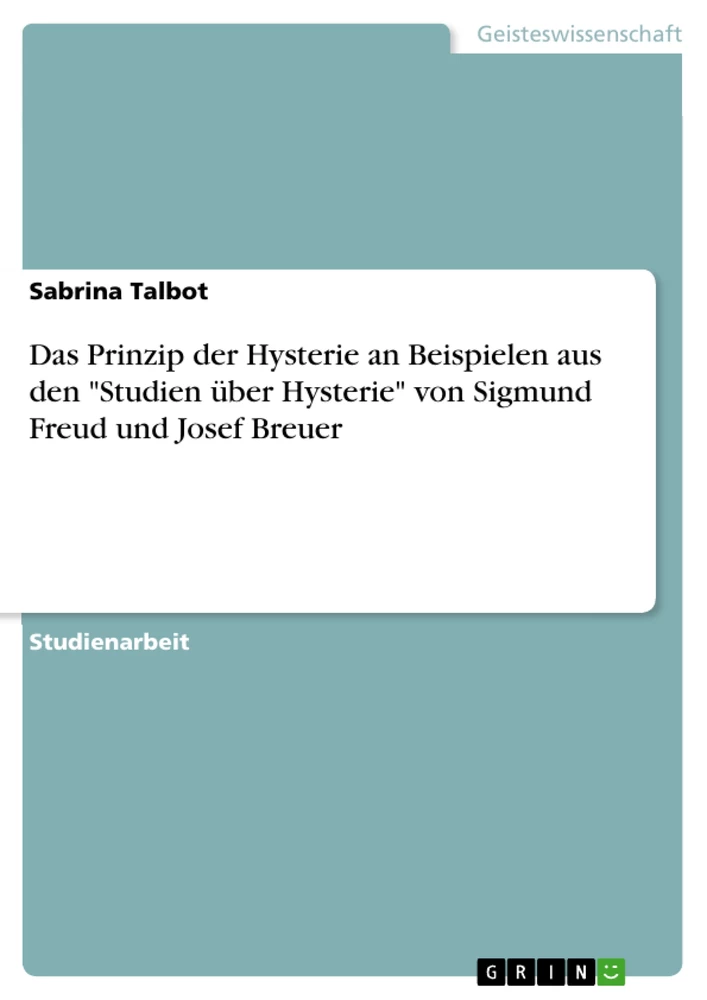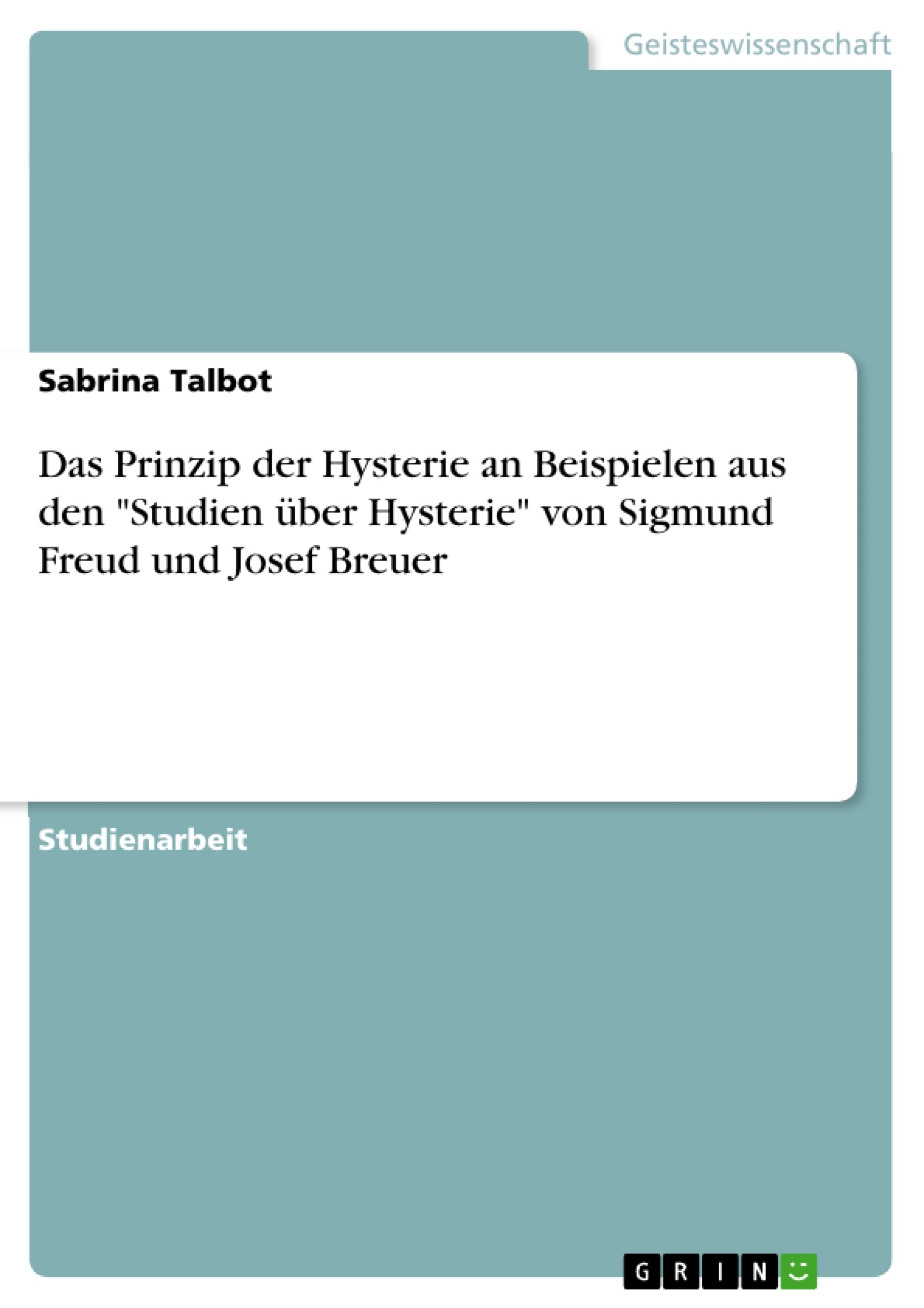Unbeherrschte Tobsuchtsanfälle, laute Weinkrämpfe, panische Ängste – das sind die Indikatoren für die "grande hystérie" im 19. Jahrhundert. "Grande Hystérie", was ist das eigentlich? Der Begriff wird von Jean-Martin Charcot während seiner Zeit als Arzt in der Salpêtrière-Nervenheilanstalt in Paris definiert und geht zurück auf ein jahrhundertealtes Phänomen. Der Begriff bezeichnet den hysterischen Anfall, einen Anfall der "grande mouvements" (der großen Bewegungen). Die folgende Ausarbeitung dient dem Zweck, das Prinzip der Hysterie darzustellen und einen Erklärungsversuch dafür zu wagen, warum es Ende des 19. Jahrhunderts zu einer "Hysterie-Welle" kam, während die Diagnose heute nicht mehr gestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Hysterie bei Frau und Mann im gesellschaftlichen Kontext
- Die Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Hysterie als Schauspiel
- Die Anpassungsbereitschaft der Hysterie am Fallbeispiel Anna O.
- Männliche Hysterie
- Die Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts
- Ursachen, Erscheinung und Behandlung der Hysterie
- Die Rolle des Traumas am Fallbeispiel Emmy v. N.
- Die psychische Konstitution von Hysterikerinnen am Beispiel Emmy v. N.
- Das Erscheinungsbild des hysterischen Anfalls
- Die Behandlungsmethoden Sigmund Freuds
- Die Rolle der psychosexuellen Entwicklungsphasen am Fallbeispiel Katharina C.
- Fazit
- Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit der Hysterie im 19. Jahrhundert und versucht zu erklären, warum es zu einer "Hysterie-Welle" kam, während die Diagnose heute nicht mehr gestellt wird. Dabei wird untersucht, ob die Hysterie eine bewusste Inszenierung oder eine echte Krankheit ist und welche Folgen diese Frage für die Gesellschaft hat. Die Rolle von Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud und Josef Breuer sowie die Frage, ob die Hysterie ausschließlich ein weibliches Symptom ist, werden ebenfalls beleuchtet.
- Die gesellschaftlichen Bedingungen, die zur Entwicklung der Hysterie im 19. Jahrhundert führten
- Die Rolle des Traumas und der psychischen Konstitution bei der Entstehung von Hysterie
- Die verschiedenen Erscheinungsformen und Behandlungsmethoden der Hysterie
- Die Bedeutung der psychosexuellen Entwicklungsphasen für die Entstehung von Traumata
- Die Frage, ob die Hysterie eine bewusste Inszenierung oder eine echte Krankheit ist
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Hysterie ein und stellt die Forschungsfrage nach der Natur der Hysterie im 19. Jahrhundert. Das zweite Kapitel analysiert die Rolle der Frau in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und zeigt, wie die gesellschaftlichen Erwartungen und die Unterdrückung der Frau zur Entwicklung der Hysterie beitragen konnten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die Hysterie eine bewusste Inszenierung oder ein Ausdruck von Unterdrückung und seelischem Leid ist. Der Fall Anna O. wird als Beispiel für die Anpassungsbereitschaft der Hysterie und die Rolle der Suggestion in der Therapie herangezogen. Das Kapitel behandelt auch die männliche Hysterie und zeigt, dass auch Männer unter hysterischen Symptomen leiden können.
Das dritte Kapitel untersucht die Ursachen, die Erscheinung und die Behandlung der Hysterie. Der Fall Emmy v. N. wird als Beispiel für die Rolle des Traumas und der psychischen Konstitution bei der Entstehung von Hysterie herangezogen. Es wird gezeigt, wie Traumata in der Kindheit und im Erwachsenenalter zu hysterischen Symptomen führen können. Die psychische Konstitution von Hysterikerinnen wird anhand von Emmys Fall analysiert. Das Kapitel beschreibt auch das Erscheinungsbild des hysterischen Anfalls nach Charcot und die Behandlungsmethoden von Sigmund Freud. Der Fall Katharina C. wird als Beispiel für die Rolle der psychosexuellen Entwicklungsphasen bei der Entstehung von Traumata und Hysterie herangezogen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Hysterie, die gesellschaftlichen Bedingungen des 19. Jahrhunderts, die Rolle der Frau, die Unterdrückung, das Trauma, die psychische Konstitution, die Behandlungsmethoden von Charcot und Freud, die psychosexuelle Entwicklung und die Frage nach der Natur der Hysterie als Krankheit oder Inszenierung.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Sabrina Talbot (Author), 2012, Das Prinzip der Hysterie an Beispielen aus den "Studien über Hysterie" von Sigmund Freud und Josef Breuer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274626