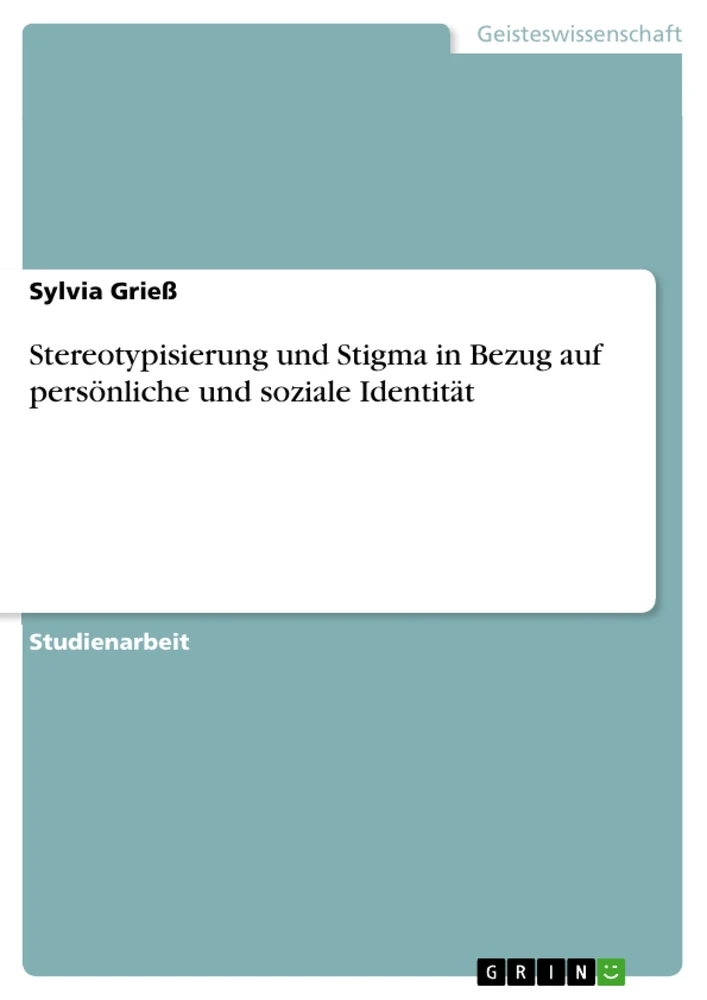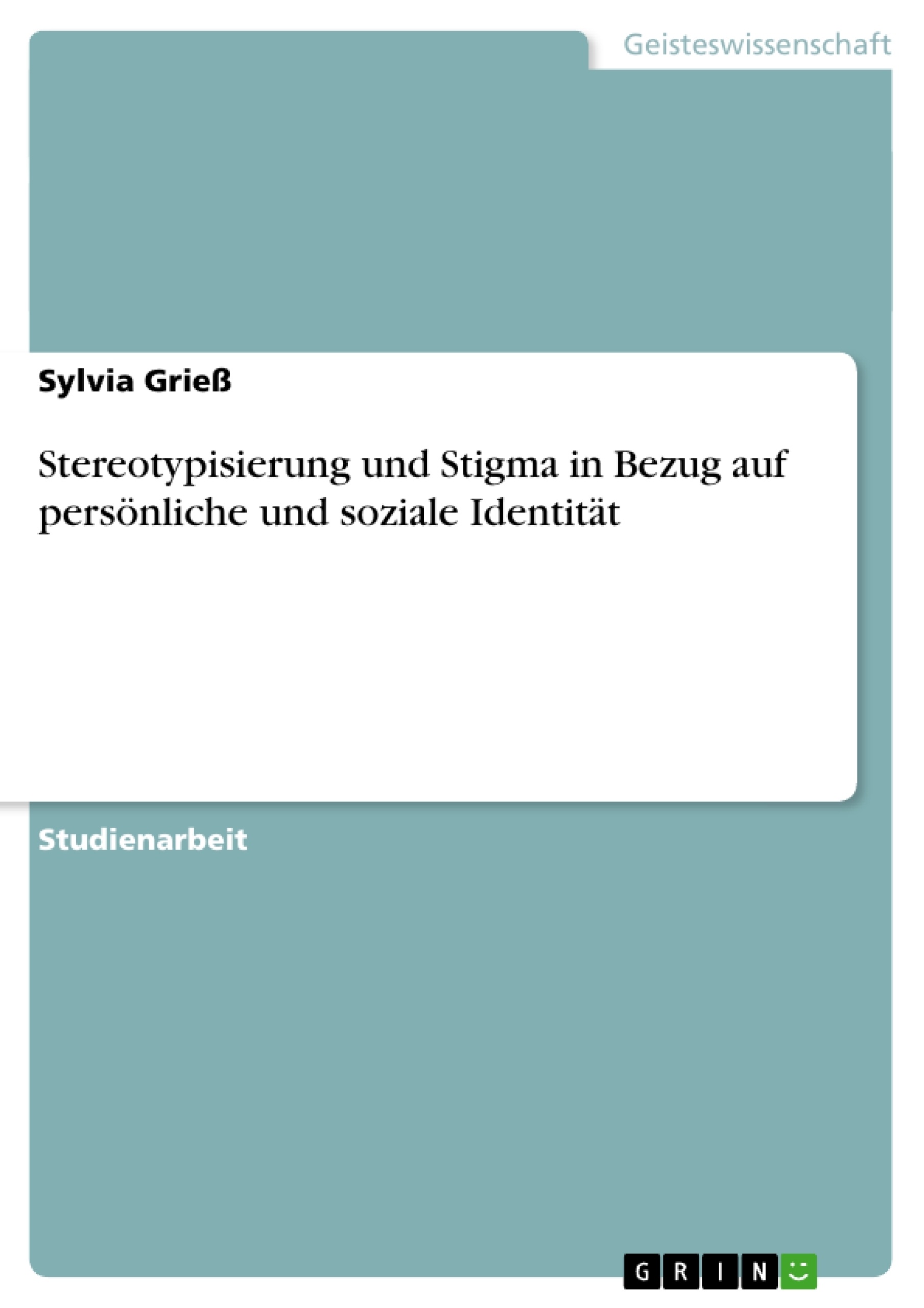In der vorliegenden Arbeit geht es um die Verbindung von Stereotypisierung und Stigma. Hierzu wird zunächst die Ambivalenz von Stereotypisierung erläutert, wobei deutlich wird, dass Stereotypisierung auf der einen Seite Vorteile mit sich bringen kann und auf der anderen Seite einschränkend und verletzend wirken kann.
Daran anschließend wird der Begriff Stigma näher betrachtet und ein Bezug zum Identi-tätsaspekt hergestellt, um danach anhand der drei Identitätsbegriffe von Goffman Stigma zu erklären. Goffman zufolge ist ein Stigma eine spezielle Verbindung von einem Attribut einer Person und den stereotypen Vorstellungen der Menschen, die kein Stigma tragen und als „normal“ gelten (vgl. Hellmann 1991, S. 6). Hier kommt es nach Goffman auch darauf an, ob es sich um angeborene Eigenschaften, von der Norm abweichende, um so-zial vererbte, oder um erst spät erworbene Eigenschaften handelt. Dies hat jeweils eine andere Auswirkung auf die Entwicklung, bzw. nach Goffman auf den moralischen Werde-gang (vgl. Goffman 1992, S. 45). Desweiteren geht es darum, wie die soziale Interaktion beeinflusst wird, wenn Stigmatisierte und Nicht-Stigmatisierte zusammentreffen und dar-um wie sich dies auf die Identität der Personen auswirken kann? Goffman gibt hierzu an, dass innerhalb einer Interaktion mit einer unbekannten Person Eigenschaften auffallen können, die von den eigentlich gebildeten stereotypen Vorstellungen abweichen und die Person in der Vorstellung herabgemindert wird (vgl. Hellmann 1991, S. 7). Es soll darges-tellt werden, welche Probleme im Zuge von Stigmatisierung auftreten können und es werden Möglichkeiten aufgezeigt, mit dem Stigma umzugehen.
Es gibt sichtbare stigmatisierte Eigenschaften und nicht sichtbare stigmatisierte Eigen-schaften. Zu ersteren kann z.B. eine Behinderung, oder ein auffälliges Verhalten entgegen der Norm gezählt werden. Nicht sichtbare stigmatisierte Eigenschaften lassen derweilen vermuten, dass bestimmte Personen als Stigmatisierte hervortreten, indem sie in Kontakt mit bestimmten Instanzen treten, oder sich an speziellen Orten aufhalten. Hier können z.B. Lernbehinderte als Beispiel für eine stigmatisierte Gruppe genannt werden. Treten die Kinder und Jugendlichen in Kontakt mit der Instanz Sonderschule, so wird es augenscheinlich bekannt, dass bestimmte Defizite vorliegen „(…) es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert hatten“ (Goffman 1992, S. 13). Durch diese Abgrenzung zum „normalen“ Schüler und den
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ambivalenz von Stereotypisierung
- Warum sind wir auf Stereotype angewiesen?
- Warum kann Stereotypisierung verletzen?
- Identität und Stigma
- Persönliche Identität
- Soziale Identität
- Ich-Identität
- Stigma – Erklärung anhand der Identitätsbegriffe
- Stigma-Management
- Möglichkeiten des Stigma-Managements
- Hannah Arendt: „Wir Flüchtlinge“
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die enge Verbindung zwischen Stereotypisierung und Stigma. Ziel ist es, die Ambivalenz von Stereotypisierung aufzuzeigen, die sowohl positive Aspekte als auch negative Folgen beinhaltet. Anschließend wird der Begriff Stigma im Kontext der Identität näher betrachtet und anhand der Identitätsbegriffe von Goffman erklärt.
- Ambivalenz von Stereotypisierung: Vor- und Nachteile der Verwendung von Stereotypen
- Identität und Stigma: Erklärung des Begriffs Stigma anhand der Identitätsbegriffe von Goffman
- Stigma-Management: Möglichkeiten und Herausforderungen im Umgang mit Stigmatisierungen
- Soziale Interaktion und Stigma: Auswirkungen von Stigmatisierung auf die soziale Interaktion und die Identität der Betroffenen
- Hannah Arendt und Stigma: Ein Bezug zum Essay „Wir Flüchtlinge“ im Kontext von Stigmatisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt den Zusammenhang zwischen Stereotypisierung und Stigma dar. Sie erläutert die Ambivalenz von Stereotypisierung, die sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringen kann.
Ambivalenz von Stereotypisierung
Dieses Kapitel beleuchtet die Ambivalenz von Stereotypisierung. Es werden sowohl die Vorteile als auch die Nachteile von Stereotypen diskutiert. Dabei wird der Begriff des Stereotyps definiert und die Bedeutung von Stereotypen für die menschliche Wahrnehmung und Handlungsfähigkeit erläutert.
Identität und Stigma
In diesem Kapitel wird der Begriff Stigma näher betrachtet und ein Bezug zum Identitätsaspekt hergestellt. Es werden die drei Identitätsbegriffe von Goffman (persönliche Identität, soziale Identität, Ich-Identität) vorgestellt und erklärt, wie Stigma im Kontext dieser Identitätsbegriffe entsteht und wirkt.
Stigma-Management
Dieses Kapitel befasst sich mit den Möglichkeiten des Stigma-Managements. Es werden verschiedene Strategien aufgezeigt, wie Menschen mit einem Stigma umgehen können, um die Folgen von Stigmatisierung zu bewältigen. Des Weiteren wird der Essay „Wir Flüchtlinge“ von Hannah Arendt als Beispiel für eine Gruppe von Stigmatisierten betrachtet.
Schlüsselwörter
Stereotypisierung, Stigma, Identität, Goffman, Ambivalenz, Stigma-Management, soziale Interaktion, Hannah Arendt, „Wir Flüchtlinge“, Ausgrenzung, Inklusion.
- Quote paper
- Sylvia Grieß (Author), 2011, Stereotypisierung und Stigma in Bezug auf persönliche und soziale Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274531