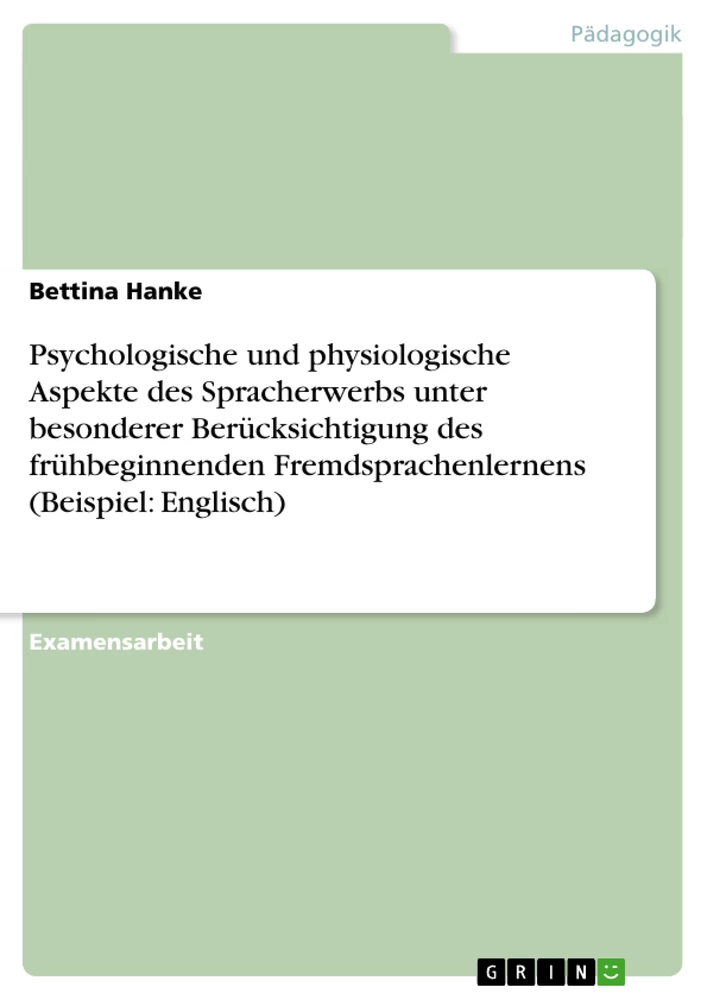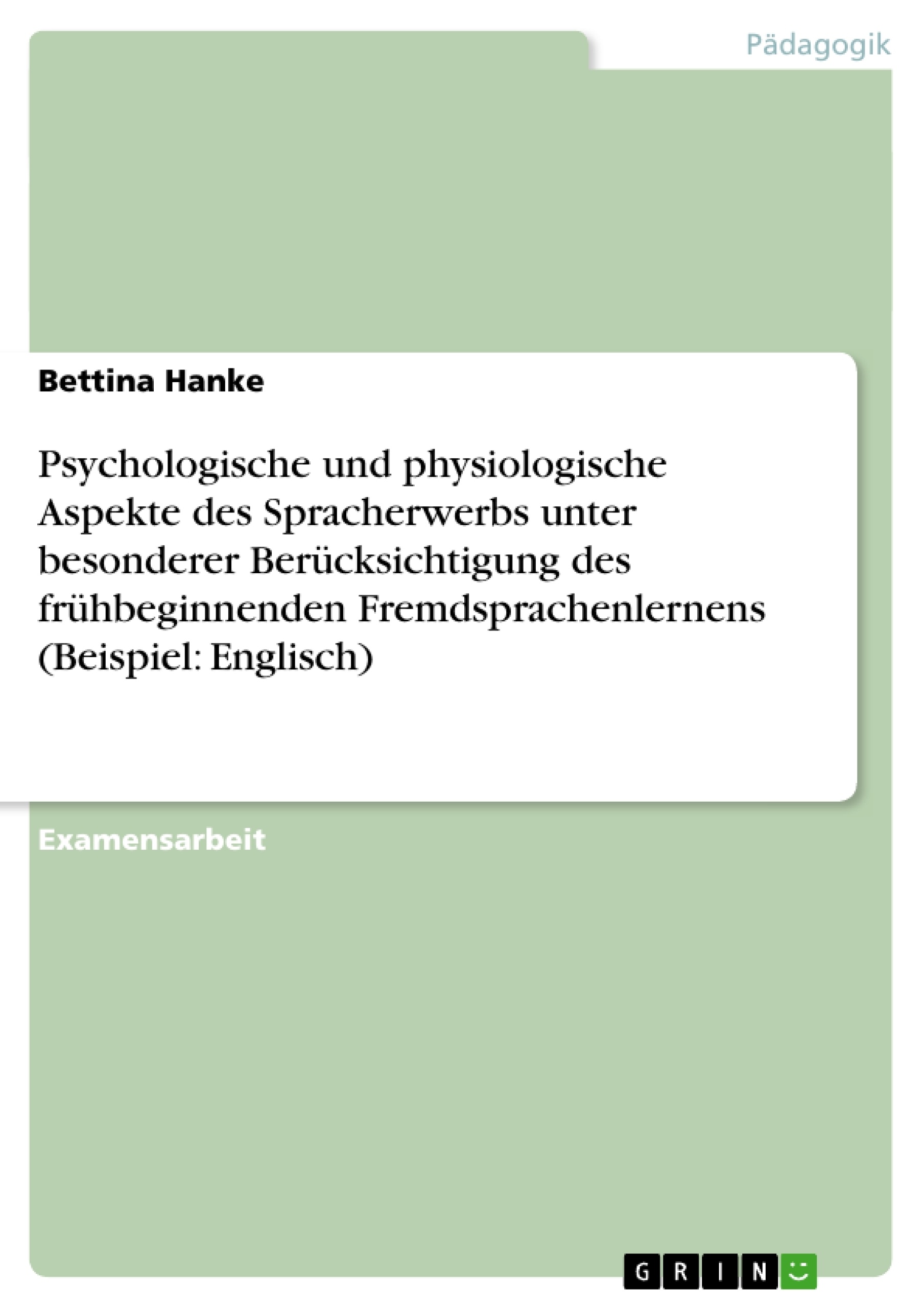Sprache ist Bestandteil unseres Lebens. Jedes Individuum besitzt die Fähigkeit, eine Sprache zu erwerben. Doch was zeichnet diese Fähigkeit aus, eine Sprache zu erwerben? Zu dem Zeitpunkt, an dem wir bewusst über unsere Sprache nachdenken, haben wir sie bereits erworben. Wir können es uns selbst nicht erklären, wie wir sie erworben haben. Sie gehört zu unserem Leben, so wie auch das Gehen oder Sehen. Daher ist die Beantwortung der Frage, wie wir unsere Sprache erwerben so schwierig. Wir fangen in frühen Jahren an zu sprechen, zu gehen, zu denken. Diese Entwicklung ist bei allen Menschen auf der ganzen Welt gleich. Egal welches Land wir betrachten, ob nun Russland, Chile oder Irland, jedes Kind wird ab einem bestimmten Alter anfangen zu sprechen. Doch was löst dieses Verhalten aus? Sind es die Menschen in unserer Umgebung, die mit feinster und zarter Stimme auf uns einreden, uns zum lächeln bringen, uns in den Schlaf singen? Einerseits scheint die Umgebung des Kindes tatsächlich eine Rolle im Spracherwerbsprozess zu spielen, denn jedes Kind erwirbt die Sprache, die in seiner Umgebung gesprochen wird. Andererseits kann dies auch auf eine vererbte Veranlagung zum Spracherwerb zurückzuführen sein. Diese zwei unterschiedlichen Annahmen werden auch in der Literatur aufgenommen und diskutiert. Auf der einen Seite stehen die Vertreter des nativistischen Ansatzes. Dazu gehören, unter anderen, Lenneberg und Chomsky. Es wird angenommen, dass die Fähigkeit zum Spracherwerb angeboren ist. Es existiert ein Spracherwerbsmechanismus, der es ermöglicht, die Sprache zu entfalten. Dem gegenüber stehen die Anhänger, unter anderen Skinner, des lerntheoretischen Ansatzes. Sie vertreten die Annahme, dass Lernprozesse am Spracherwerbsprozess beteiligt sind. Sprache und Sprechen werden gelernt. Dies geschieht nach den Regeln des operanten Konditionierens. Es wird z. B. ein Laut zufällig produziert und dann unmittelbar belohnt. Dies führt zu einer vermehrten Wiederholung des Lautes. Auf diese Weise wird dann Sprache gelernt. Zusätzlich zu diesen Positionen besteht noch ein dritter Erklärungsansatz. Man ist der Auffassung, dass man Spracherwerb nicht losgelöst von der kognitiven Entwicklung betrachten kann. Spracherwerb wird als Teil der kognitiven Gesamtentwicklung [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entwicklungspsychologische Aspekte des Spracherwerbs
- 2.1. Grundlagen der Montessori-Pädagogik
- 2.1.1. Die sensiblen Phasen der Entwicklung und die Stufen der Erziehung
- 2.1.2. Montessoris Theorie von der Entwicklung der Sprache im Kind
- 2.1.2.1. Der Mechanismus der Sprache
- 2.1.2.2. Der zeitliche Ablauf der Sprachentwicklung
- 2.2. Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung
- 2.2.1. Adaptation und Organisation
- 2.2.2. Schema
- 2.2.3. Äquilibration
- 2.2.4. Die Entwicklungsstufen
- 2.2.5. Die Entwicklung der Sprache im Kind nach Piaget
- 2.2.5.1. Nachahmung
- 2.2.5.2. Symbolfunktion
- 2.1. Grundlagen der Montessori-Pädagogik
- 3. Biologische Aspekte des Spracherwerbs
- 4. Allgemeine Aspekte des Zweitspracherwerbs
- 4.1. Die Beziehungen zwischen Erst- und Zweitspracherwerb
- 4.2. Einige Theorien zum Zweitspracherwerb
- 4.3. Neuere Erkenntnisse in der Zweitspracherwerbstheorie
- 5. Frühbeginnendes Fremdsprachenlernen und der Einfluss der Spracherwerbstheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht psychologische und physiologische Aspekte des Spracherwerbs, insbesondere im Kontext des frühbeginnenden Fremdsprachenlernens (Englisch). Ziel ist es, verschiedene Theorien und Ansätze zum Erst- und Zweitspracherwerb zu beleuchten und deren Relevanz für den frühen Fremdsprachenunterricht zu diskutieren.
- Entwicklungspsychologische Grundlagen des Spracherwerbs (Montessori, Piaget)
- Biologische Faktoren im Spracherwerbsprozess
- Theorien des Erst- und Zweitspracherwerbs (z.B. Acquisition-Learning, Input-Hypothese)
- Der Einfluss des Alters auf den Spracherwerb
- Implikationen für den frühbeginnenden Englischunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Spracherwerbs ein und stellt die zentrale Frage nach den Mechanismen des Spracherwerbs. Sie beleuchtet die unterschiedlichen theoretischen Ansätze, vom nativistischen Standpunkt (Lenneberg, Chomsky) bis hin zum lerntheoretischen Ansatz (Skinner) und dem kognitiven Ansatz (Piaget). Die Arbeit konzentriert sich auf die nativistische und die kognitive Perspektive und kündigt die Untersuchung des Erst- und Zweitspracherwerbs sowie des frühbeginnenden Fremdsprachenunterrichts an.
2. Entwicklungspsychologische Aspekte des Spracherwerbs: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklungspsychologischen Grundlagen des Spracherwerbs. Es werden die Montessori-Pädagogik mit ihren sensiblen Phasen und der Theorie der Sprachentwicklung sowie Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung mit ihren Stadien und dem Konzept der Äquilibration detailliert erläutert. Beide Theorien werden im Kontext der Sprachentwicklung des Kindes analysiert und miteinander verglichen. Die Kapitel betrachten den Spracherwerb als einen Prozess, der eng mit der kognitiven Entwicklung verwoben ist.
3. Biologische Aspekte des Spracherwerbs: Dieses Kapitel befasst sich mit den biologischen Einflussfaktoren auf den Spracherwerb. Es werden Themen wie Umwelt, Entwicklungsstufen, Alter und Aphasie, Lateralisation, physische Reifung, sowie das Verhältnis von Verstehen und Sprechen behandelt. Eine umfassende Theorie der Sprachentwicklung wird vorgestellt, welche die Interaktion zwischen biologischen Voraussetzungen und Umwelteinflüssen hervorhebt. Die Zusammenhänge zwischen biologischer Reife und sprachlicher Kompetenz werden analysiert.
4. Allgemeine Aspekte des Zweitspracherwerbs: Dieses Kapitel untersucht die Theorien des Zweitspracherwerbs. Es werden die Beziehungen zwischen Erst- und Zweitspracherwerb beleuchtet und verschiedene Hypothesen wie die Acquisition-Learning Distinction, die Natural Order Hypothesis, die Monitor Hypothesis, die Input Hypothesis und die Affektive Filter Hypothesis vorgestellt und diskutiert. Besondere Aufmerksamkeit wird dem optimalen Input, dem Output und dem bewussten Lernen gewidmet. Das Kapitel analysiert die Interaktions- und Output-Hypothese als neuere Erklärungsansätze.
5. Frühbeginnendes Fremdsprachenlernen und der Einfluss der Spracherwerbstheorie: Dieses Kapitel befasst sich mit dem frühbeginnenden Fremdsprachenlernen, insbesondere im Kontext des Englischunterrichts. Die Ziele des Fremdsprachenunterrichts, die Lerninhalte (Hörverstehen, Sprechen, Lesen, Schreiben, Strukturen), die Unterrichtsgestaltung, Leistungsbeurteilung, Fehlerbehandlung und der Einsatz von Spielen im Unterricht werden detailliert erörtert. Die Kapitel integriert die zuvor vorgestellten Theorien des Spracherwerbs und ihre Relevanz für den effektiven Fremdsprachenunterricht in der Grundschule.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Fremdsprachenlernen, Entwicklungspsychologie, Montessori-Pädagogik, Piaget, Biologische Aspekte, Theorien des Spracherwerbs, frühkindlicher Spracherwerb, Englischunterricht, kognitive Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Spracherwerb
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über den Spracherwerb, einschließlich der Titel-, Inhaltsverzeichnisses, der Zielsetzung und der zentralen Themen, der Kapitelzusammenfassungen und der Schlüsselbegriffe. Es behandelt sowohl den Erst- als auch den Zweitspracherwerb und konzentriert sich insbesondere auf den frühbeginnenden Fremdsprachenunterricht (Englisch).
Welche Entwicklungspsychologischen Theorien werden behandelt?
Das Dokument analysiert die Montessori-Pädagogik mit ihren sensiblen Phasen und der Theorie der Sprachentwicklung sowie Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung, einschließlich Adaptation, Organisation, Schema, Äquilibration und den Entwicklungsstufen. Beide Theorien werden im Kontext der Sprachentwicklung des Kindes verglichen und analysiert.
Welche biologischen Aspekte des Spracherwerbs werden berücksichtigt?
Der Einfluss von biologischen Faktoren wie Umwelt, Entwicklungsstufen, Alter, Aphasie, Lateralisation und physischer Reifung auf den Spracherwerb wird untersucht. Der Zusammenhang zwischen biologischer Reife und sprachlicher Kompetenz wird analysiert.
Welche Theorien des Zweitspracherwerbs werden diskutiert?
Das Dokument präsentiert und diskutiert verschiedene Theorien des Zweitspracherwerbs, darunter die Acquisition-Learning Distinction, die Natural Order Hypothesis, die Monitor Hypothesis, die Input Hypothesis und die Affektive Filter Hypothesis. Die Interaktions- und Output-Hypothese werden als neuere Erklärungsansätze betrachtet.
Wie wird der früh beginnende Fremdsprachenunterricht behandelt?
Das Dokument widmet sich dem frühbeginnenden Fremdsprachenlernen, insbesondere im Kontext des Englischunterrichts. Es beleuchtet die Ziele des Fremdsprachenunterrichts, die Lerninhalte (Hörverstehen, Sprechen, Lesen, Schreiben, Strukturen), die Unterrichtsgestaltung, Leistungsbeurteilung, Fehlerbehandlung und den Einsatz von Spielen im Unterricht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Spracherwerb, Zweitspracherwerb, Fremdsprachenlernen, Entwicklungspsychologie, Montessori-Pädagogik, Piaget, Biologische Aspekte, Theorien des Spracherwerbs, frühkindlicher Spracherwerb, Englischunterricht, kognitive Entwicklung.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Entwicklungspsychologische Aspekte des Spracherwerbs, Biologische Aspekte des Spracherwerbs, Allgemeine Aspekte des Zweitspracherwerbs und Frühbeginnendes Fremdsprachenlernen und der Einfluss der Spracherwerbstheorie.
Welche Zielsetzung verfolgt das Dokument?
Das Dokument untersucht psychologische und physiologische Aspekte des Spracherwerbs, insbesondere im Kontext des frühbeginnenden Fremdsprachenlernens (Englisch). Ziel ist es, verschiedene Theorien und Ansätze zum Erst- und Zweitspracherwerb zu beleuchten und deren Relevanz für den frühen Fremdsprachenunterricht zu diskutieren.
- Quote paper
- Bettina Hanke (Author), 2003, Psychologische und physiologische Aspekte des Spracherwerbs unter besonderer Berücksichtigung des frühbeginnenden Fremdsprachenlernens (Beispiel: Englisch), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27449