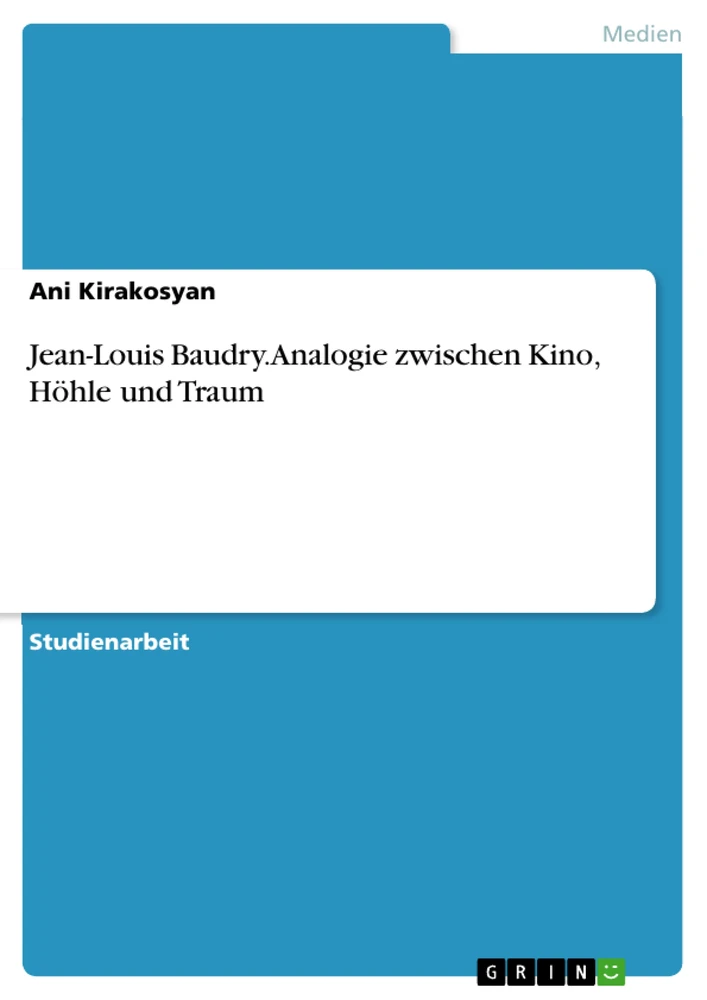"Die blödsinnigen und irrealen Filmphantasien sind die Tagträume der Gesellschaft, in denen ihre eigentliche Realität zum Vorschein kommt, ihre sonst unterdrückten Wünsche sich gestalten." Was der Filmkritiker Siegfried Kracauer hier meint, ist wohl die Tatsache, dass das Kino Ideen und Argumente gesellschaftlicher Diskurse visuell und narrativ in konkrete exemplarische Situationen und Handlungsabläufe stellt. Dabei entfaltet das Kino emotionale Wirkungen bei seinen Zuschauern. Eine weitere Möglichkeit das Zitat für sich genommen zu deuten, ist es im Sinne des französischen Theoretikers Jean-Louis Baudry zu verstehen. Die Grundthese Baudrys besagt, dass die kinematografische Anordnung des Kinos und die Konstruktion des Sehraumes voraussetzen, dass beim Kinozuschauer bestimmte psychische Effekte eintreten. Baudry geht es nicht um die Technik des Kinos, sondern die Position eines Zuschauersubjekts, das selbst Teil dieser apparativen Anordnung ist. "Der Zuschauer identifiziert sich weniger mit dem Dargestellten, als mit den Bedingungen, die ihm ermöglichen zu sehen, was er sieht" .
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hinführung
- 2.1 Zum Dispositivbegriff
- 2.2 Die Höhle als Kino
- 2.3 Das Kino als Traum
- 2.4 Das Kino und die menschliche Psyche
- 3. Kritische Betrachtung
- 3.1 Christian Metz: Der Betrachter im Kino schläft nicht.
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Analogien zwischen Kino, Platons Höhlengleichnis und Freuds Traumdeutung, wie sie von Jean-Louis Baudry beschrieben werden. Ziel ist es, die Plausibilität dieser Analogien zu überprüfen und Baudrys Theorie kritisch zu betrachten.
- Das kinematographische Dispositiv nach Baudry
- Die Analogie zwischen dem Kinosaal und Platons Höhle
- Die Analogie zwischen dem Kinoerlebnis und dem Traum
- Die psychischen Effekte des Kinos auf den Zuschauer
- Kritische Auseinandersetzung mit Baudrys Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Plausibilität der Analogien zwischen Kino, Höhle und Traum nach Baudry. Sie zitiert Siegfried Kracauer, um die gesellschaftliche Relevanz des Kinos zu betonen, und führt kurz Baudrys Grundthese ein, die besagt, dass die kinematografische Anordnung des Kinos bestimmte psychische Effekte beim Zuschauer hervorruft. Der Fokus liegt auf der Position des Zuschauers als Teil des apparativen Systems, und nicht auf der technischen Seite des Films. Die Arbeit kündigt die Struktur der folgenden Kapitel an: Erläuterung des Dispositivbegriffs, Analyse der Analogien zum Höhlengleichnis und zur Traumdeutung, und schließlich eine kritische Betrachtung und ein Fazit.
2. Hinführung: Dieses Kapitel führt in Baudrys Konzept des kinematographischen Dispositivs ein. Es betont, dass Baudry nicht den Film, sondern die Anordnung der materiellen Elemente des Kinos (Projektor, Leinwand, Sitzreihen etc.) als zentral für die Wirkung auf den Zuschauer betrachtet. Die Betrachtung stützt sich auf philosophische und psychoanalytische Paradigmen (Platons Höhlengleichnis und Freuds Traumdeutung). Es werden die beiden zentralen Hypothesen Baudrys vorgestellt: die Analogie zwischen dem Höhlengleichnis und dem Kinosaal sowie die Analogie zwischen dem Kino und dem Traum. Das Kapitel dient als Brücke zwischen der Einleitung und der detaillierteren Betrachtung der Analogien in den folgenden Abschnitten.
2.1 Zum Dispositivbegriff: Dieser Abschnitt definiert den zentralen Begriff des "Dispositivs" nach Baudry und Foucault. Es wird herausgestellt, dass Baudry den Begriff verwendet, um die Zusammenhänge zwischen technischen, produktions- und rezeptionsbezogenen Bedingungen sowie den gesellschaftlichen Funktionen des Mediums Kino zu untersuchen. Das Dispositiv wird als ein heterogenes Ensemble aus Diskursen, Institutionen, Architektur und Regeln beschrieben, die miteinander verwoben sind und die Wirkung des Kinos bestimmen. Der Abschnitt legt den Grundstein für das Verständnis der Analogien, die im Folgenden erläutert werden, da diese Analogien eben auf diesem Verständnis des Dispositivs aufbauen.
2.2 Die Höhle als Kino: In diesem Abschnitt wird die Analogie zwischen Platons Höhlengleichnis und dem Kinosaal detailliert dargestellt. Der Vergleich verdeutlicht, wie das kinematographische Dispositiv eine Illusion von Realität erzeugt, indem es die Bewegungsfreiheit des Zuschauers einschränkt und seine Wahrnehmung auf das Visuelle und Auditive beschränkt. Die Gefangenen in der Höhle nehmen die Schatten als Realität wahr, ähnlich wie Kinobesucher die Projektion auf der Leinwand. Der Einwand, dass Kinobesucher freiwillig ihre Plätze einnehmen, wird durch den Verweis auf Platons Text entkräftet, wo ein Gefangener die Flucht gelingt, aber sein Versuch, die anderen aufzuklären, fehlschlägt. Dies wird interpretiert als Ausdruck eines unbewussten Begehrens nach dem Gefangenstatus.
Schlüsselwörter
Jean-Louis Baudry, kinematographisches Dispositiv, Platons Höhlengleichnis, Freuds Traumdeutung, Kino, Realitätseindruck, Illusion, Zuschauer, psychische Effekte, Wahrnehmung.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Analogien zwischen Kino, Platons Höhlengleichnis und Freuds Traumdeutung nach Baudry
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Analogien zwischen Kino, Platons Höhlengleichnis und Freuds Traumdeutung, wie sie von Jean-Louis Baudry beschrieben werden. Ziel ist es, die Plausibilität dieser Analogien zu überprüfen und Baudrys Theorie kritisch zu betrachten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das kinematographische Dispositiv nach Baudry, die Analogie zwischen Kinosaal und Platons Höhle, die Analogie zwischen Kinoerlebnis und Traum, die psychischen Effekte des Kinos auf den Zuschauer und eine kritische Auseinandersetzung mit Baudrys Theorie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Hinführung mit Unterkapiteln zum Dispositivbegriff, der Höhle als Kino, dem Kino als Traum und dem Kino und der menschlichen Psyche, eine kritische Betrachtung (inkl. Bezug auf Christian Metz), und ein Fazit. Die Kapitel enthalten detaillierte Erklärungen und Analysen der jeweiligen Themen.
Was ist das zentrale Argument von Baudry?
Baudry argumentiert, dass die Anordnung der materiellen Elemente des Kinos (Projektor, Leinwand, Sitzreihen etc.) – das kinematographische Dispositiv – bestimmte psychische Effekte beim Zuschauer hervorruft. Er zieht hierfür Analogien zum Höhlengleichnis und zur Traumdeutung.
Welche Analogie besteht zwischen dem Kinosaal und Platons Höhle?
Die Analogie besteht darin, dass das kinematographische Dispositiv, ähnlich wie die Höhle in Platons Gleichnis, eine Illusion von Realität erzeugt. Die eingeschränkte Bewegungsfreiheit und die Beschränkung der Wahrnehmung auf das Visuelle und Auditive schaffen eine künstliche Realität, die vom Zuschauer als wahrgenommene Realität erlebt wird.
Welche Analogie besteht zwischen dem Kinoerlebnis und dem Traum?
Die Arbeit vergleicht das passive, hypnotische Erlebnis im Kinosaal mit der Erfahrung eines Traumes. Der Zuschauer wird in eine Welt der Projektion versetzt, die seine Wahrnehmung und sein Bewusstsein beeinflusst, ähnlich wie es im Traum geschieht.
Wie wird Baudrys Theorie kritisch betrachtet?
Die Arbeit enthält einen Abschnitt zur kritischen Betrachtung von Baudrys Theorie. Genaueres zum Inhalt dieser kritischen Auseinandersetzung wird im Text nicht explizit angegeben, jedoch wird Christian Metz als Referenz genannt.
Welche Schlüsselbegriffe sind wichtig für das Verständnis der Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Jean-Louis Baudry, kinematographisches Dispositiv, Platons Höhlengleichnis, Freuds Traumdeutung, Kino, Realitätseindruck, Illusion, Zuschauer, psychische Effekte und Wahrnehmung.
Wer wird in der Arbeit zitiert?
Die Arbeit zitiert neben Jean-Louis Baudry auch Siegfried Kracauer und Christian Metz.
Welche Rolle spielt der Begriff des „Dispositivs“?
Der Begriff des „Dispositivs“ nach Baudry und Foucault ist zentral. Er beschreibt die Verknüpfung von technischen, produktions- und rezeptionsbezogenen Bedingungen sowie den gesellschaftlichen Funktionen des Mediums Kino. Das Dispositiv ist ein komplexes Gefüge, das die Wirkung des Kinos bestimmt.
- Arbeit zitieren
- Ani Kirakosyan (Autor:in), 2012, Jean-Louis Baudry. Analogie zwischen Kino, Höhle und Traum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274207