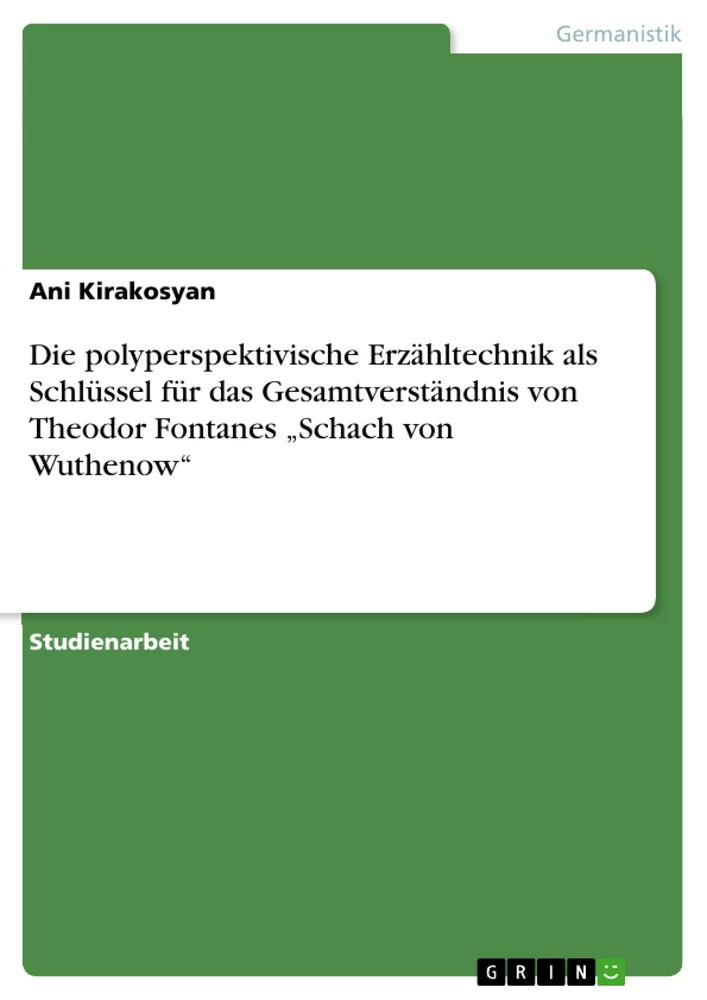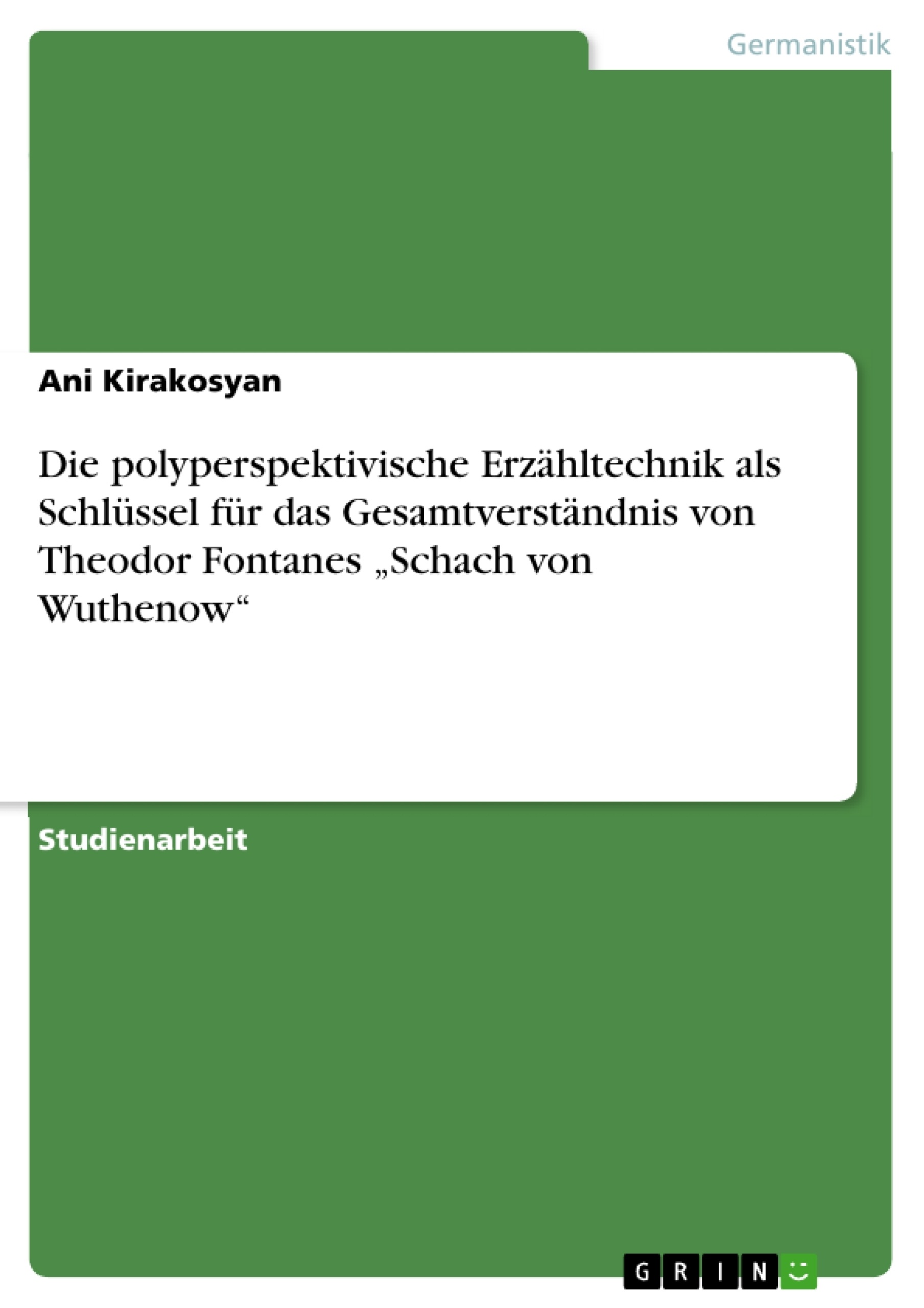»Eitlen, auf die Ehre dieser Welt gestellten Naturen ist der Spott und das Lachen der Gesellschaft derart unerträglich, daß sie lieber den Tod wählen, als eine Pflicht erfüllen, die sie selber gut und klug genug sind, als Pflicht zu erkennen, aber auch schwach genug sind, aus Furcht vor Verspottung nicht erfüllen zu wollen.« So charakterisiert Fontane seinen im Jahre 1883 erschienenen Roman „Schach von Wuthenow, in dem „Das Problem Individuum und Gesellschaft […] einen ungewöhnlichen Spannungsbereich mit dramatischem Ausgang [findet]. Er [der Roman] schildert »den schönsten Offizier der damaligen Berliner Garnison, der, in einem Anfalle von Übermut und Laune, die liebenswürdigste, aber hässlichste junge Dame der damaligen Hofgesellschaft becourt. So, daß der Skandal offenbar wird.«“ Nach Bekanntwerden dieses „Skandals“, zwingt die Mutter der „hässlichen jungen Dame“ Schach zu einer Heirat mit der Tochter. Nach der Hochzeitsfeier erschießt sich dieser. Der Grund für den Freitod scheint zunächst der Spott seiner Kameraden zu sein, den Schach womöglich nicht ertragen kann.
Den Roman kurz beschreibend, könnte man sagen, dass Schach von Wuthenow die umfassende Beschreibung des Seelenzustandes eines „unerhört kränkbaren, stolzen und irgendwie feingearteten“ Individuums ist, der versucht aus dem kleinen Kreis, den seine Natur ihm gesteckt hat, auszubrechen, daran aber scheitert und als Ausweg den Freitod wählt.
Die Tatsache, dass sich ein Roman, geschrieben auf 153 Seiten (Reclam- Ausgabe 2003), in zwei Sätzen zusammenfassen lässt, spricht nicht nur für die „Handlungsarmut“ des Werkes, sondern ist ein bedeutungsvolles Stilmittel Fontanes, denn all die handlungsarmen Stellen werden durch andere bedeutungsvolle Mittel, wie etwa dem Dialog oder von Briefen gefüllt. Näheres dazu werde ich in den folgenden Abschnitten erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Fontanesche Realismus
- Was soll der Roman?
- Der Dialog als Stilmittel eines realistischen Erzählens
- Der Weg bis zum Untergang
- Polyperspektivisches Erzählen
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Erzähltechnik von Theodor Fontanes Roman „Schach von Wuthenow" und analysiert, wie die polyperspektivische Erzählweise zum Gesamtverständnis des Werkes beiträgt. Dabei wird der Fokus auf die Titelfigur Schach und seine Einbettung in den Gesamttext gelegt, wobei auch die Ambivalenz dieser Figur beleuchtet wird.
- Fontanesche Realismus und seine Anwendung in „Schach von Wuthenow"
- Die Rolle des Dialogs in der realistischen Erzählung
- Die Bedeutung der polyperspektivischen Erzählweise für das Verstehen des Romans
- Die gesellschaftlichen und persönlichen Gründe für Schachs Selbstmord
- Die Ambivalenz der Figur Schach und die Vielschichtigkeit des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman „Schach von Wuthenow" vor und beleuchtet die Herausforderungen beim Verstehen des Werkes. Die Vieldeutigkeit und die zeitgeschichtlichen Bezüge des Romans machen es schwierig, ihn aus heutiger Sicht zu erfassen. Die Einleitung skizziert die Forschungsgeschichte des Romans und stellt die Zielsetzung der Arbeit vor.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Fontaneschen Realismus. Der Begriff „Realismus" wird im Kontext von Fontanes Werk definiert und seine Anwendung in „Schach von Wuthenow" erläutert. Der Autor zeigt, wie Fontane die gesellschaftliche Realität in seinen Werken verarbeitet und wie er die Wirklichkeit durch die Anwendung von Stilmitteln poetisiert.
Das dritte Kapitel untersucht die Rolle des Dialogs als Stilmittel in der realistischen Erzählung. Fontane verzichtet auf komplizierte literarische Kunstgriffe und setzt stattdessen auf die Kraft des Dialogs, um die Figuren und ihre Beziehungen zueinander darzustellen. Der Dialog spielt eine zentrale Rolle in der Charakterentwicklung und der Vermittlung der gesellschaftlichen Verhältnisse.
Das vierte Kapitel analysiert den Weg Schachs bis zu seinem Selbstmord. Der Selbstmord eines Individuums wird als Folge von Unzufriedenheit und Konflikt mit der Gesellschaft betrachtet. Die Gesellschaft trägt sowohl zur Stabilisierung als auch zur Schwächung des Einzelnen bei. Im Falle Schachs werden die sozialen und persönlichen Gründe für seinen Freitod untersucht.
Das fünfte Kapitel widmet sich der polyperspektivischen Erzählweise in „Schach von Wuthenow". Fontane nutzt verschiedene Perspektiven, um die Figuren und ihre Handlungen zu beleuchten. Der Leser wird aufgefordert, sich ein eigenes Bild von den Figuren zu machen und die verschiedenen Perspektiven zu berücksichtigen. Die polyperspektivische Erzählweise verhindert eine einseitige Interpretation des Romans und eröffnet dem Leser neue Einsichten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die polyperspektivische Erzähltechnik, den Fontaneschen Realismus, die gesellschaftliche Kritik, den Selbstmord, die Ambivalenz der Figur Schach, den Dialog als Stilmittel, die historische Einbettung des Romans und die Vielschichtigkeit des Werkes. Der Text analysiert die Bedeutung der verschiedenen Perspektiven für das Gesamtverständnis von „Schach von Wuthenow" und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Vieldeutigkeit des Romans ergeben.
- Quote paper
- Ani Kirakosyan (Author), 2014, Die polyperspektivische Erzähltechnik als Schlüssel für das Gesamtverständnis von Theodor Fontanes „Schach von Wuthenow“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/274186