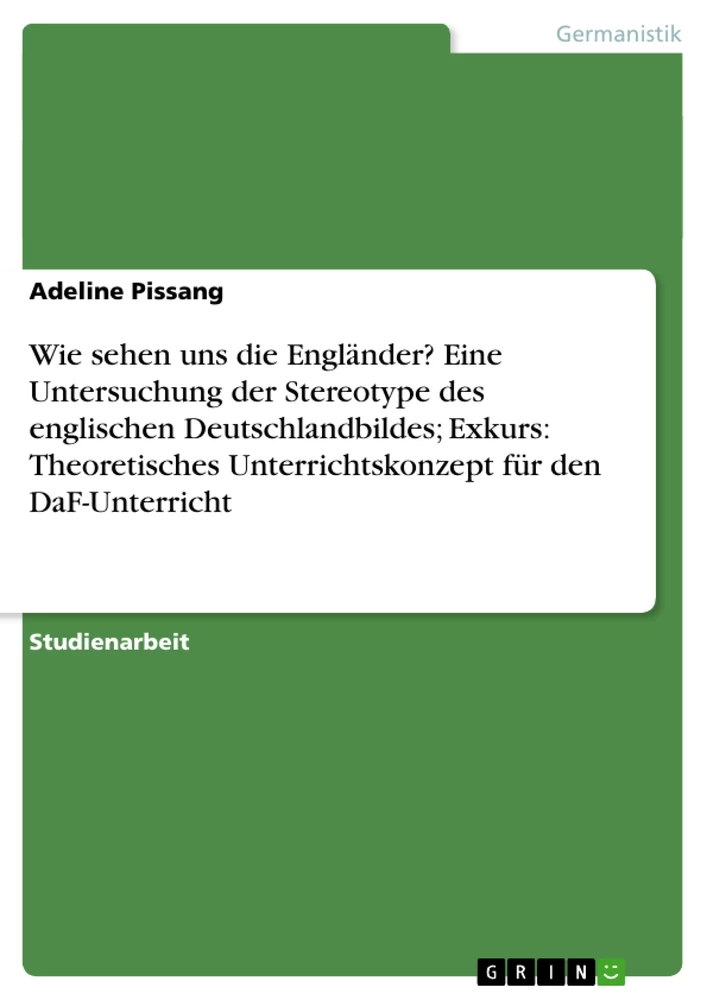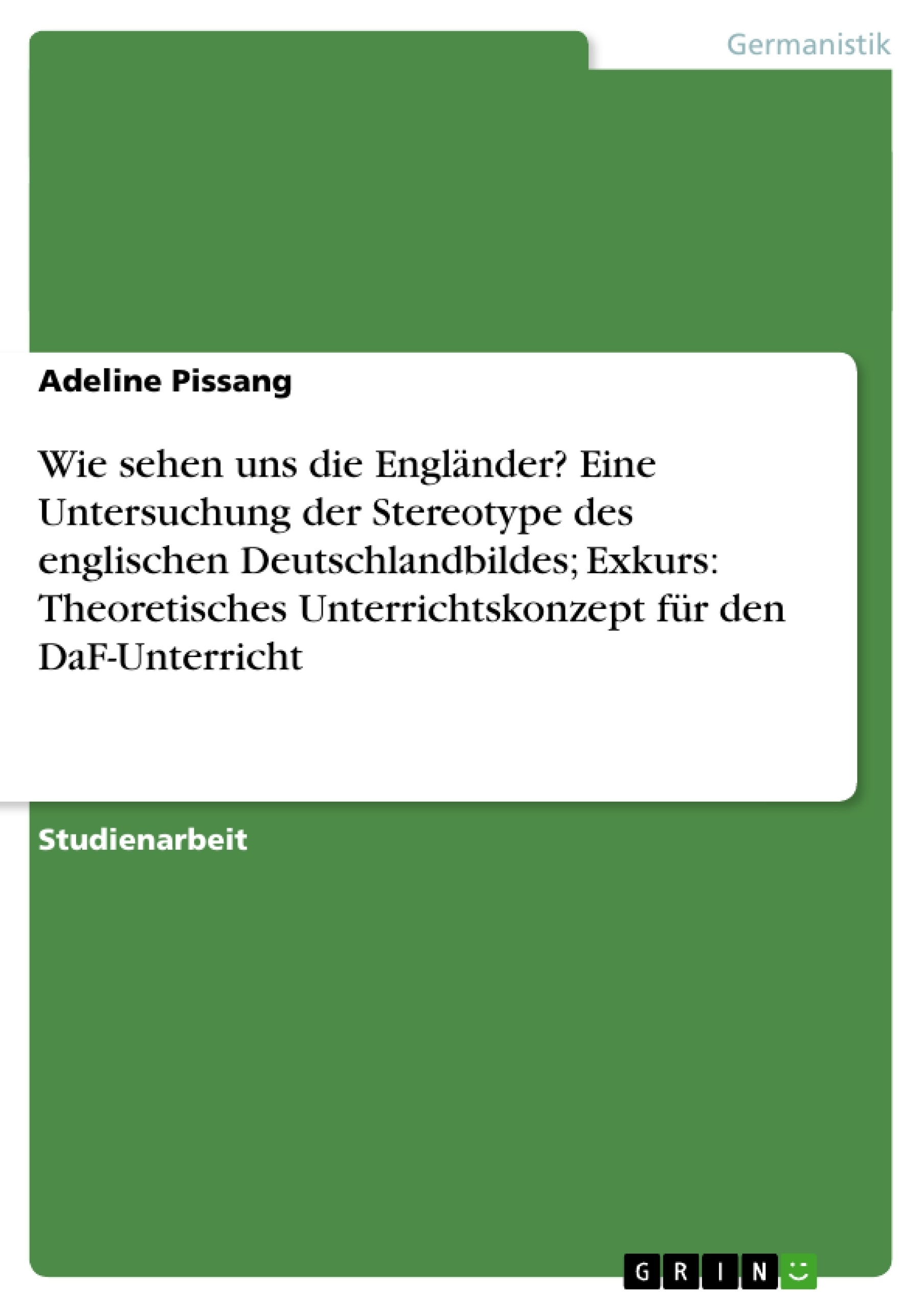Was haben folgende Worte gemein: Pünktlichkeit, Leistungswille,
Humorlosigkeit, Ordnung? Richtig, dieses sind typische
Klischeevorstellungen über die Deutschen aus der Sicht des
Auslandes. Welche Ansichten teilen wir über Briten – oder spezieller –
Engländer? Es kann durchaus nicht geleugnet werden, dass wir ihnen
kurzerhand Eigenschaften, wie Konservativität, steifes Auftreten,
schwarzen Humor und insularischen Abgrenzungswillen zuordnen
möchten (vgl. Schulte). Bezüglich der typischen Merkmale des Deutschen stellt sich nun aus
meiner persönlichen Sicht die Frage, warum denn kaum jemand jene
Tausende deutsche Studenten beachtet, die allmorgendlich 15 bis 30
Minuten später das Seminar „erreichen“, bzw. wie man das heillose
Chaos der ein oder anderen „typisch deutschen“ WG-Küche einfach
übersehen kann. Von Pünktlichkeit und Ordnung kann in diesem
Zusammenhang durchaus nicht die Rede sein. Auch die andere Seite
wird ihre Gegenargumente vorlegen – eine Klassifizierung von
Nationalitäten anhand ihrer „repräsentativen“ Eigenschaften kann
demnach niemals vollständig und nur unbefriedigend ausfallen.
Doch es zeigt sich, dank des Beispiels, dass der Wille und vor allem
die Freude an Stereotypisierungen und Klischeebildungen bei allen
Nationen gleich stark sind. Wir leben in einer Welt der zunehmenden Globalisierung und eines
nicht endenden Informationsflusses und kommen deshalb nicht
umhin, eine reduzierte und verallgemeinerte Vorstellung von anderen
Kulturen zu entwerfen. Eine enorme Verantwortung tragen
diesbezüglich die verschiedenartigen Medien, denn sie bilden die
Grundlage allen Informationsaustauschs1 (vgl. Trautmann 62). Ein wichtiger Vermittler von Fremdbildern, der jedoch ebenfalls die Gefahr einer möglichen Verzerrung birgt, ist außerdem die Werbung. [...]
1 In seinem Artikel „Stereotype, Images und Vorurteile“ macht Hans J. Kleinsteuber
darauf aufmerksam, dass aufgrund der eng beieinander liegenden Arbeitsfelder der
Medien und der Stereotypen-Beobachtung, letztendlich beides ein und dasselbe
Forschungsfeld darbietet (vgl. Trautmann 63).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte mit Blick auf die Begriffe „Stereotyp“ und „Vorurteil“
- Kulturelle Missverständnisse im Alltag zwischen Deutschen und Engländern
- Stereotypisierungen in der Geschichte
- Einfluss der Weltkriege: Der militaristische, brutale und gehorsame Deutsche
- Die wirtschaftliche Macht Deutschland: Eine alles überwältigende Autorität?
- Die Wiedervereinigung Deutschlands: Die mögliche Entstehung eines 4. Reiches?
- Das Portrait des Deutschen in den englischen Medien
- Zusammenfassende Betrachtung des englischen Deutschlandbildes
- Theoretische Stundenkonzeption einer Lehr- und Lerneinheit zum Thema: „Kaffee oder Tee? Englische und deutsche Essens- und Trinkstereotype“
- Konkretisierung der Lehr- und Lernbedingungen
- Präzisierung der Lehr- und Lernziele
- Konzept einer Stoffeinheit
- Vorentlastung – Aktualisierung des Themas
- Einführung neuer Texte, Situationen und Kenntnisse zum Thema
- Aneignungs- und Fertigungsübungen
- Sprachspiele
- Didaktische Reflexion über die gesamte Lehr- und Lerneinheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das englische Deutschlandbild, indem sie alltägliche kulturelle Missverständnisse, historische Stereotypisierungen und deren Darstellung in englischen Medien analysiert. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der ambivalenten Wahrnehmung Deutschlands in Großbritannien zu zeichnen und die Konstruktion und Perpetuierung von Stereotypen zu beleuchten.
- Kulturelle Missverständnisse im deutsch-englischen Alltag
- Der Einfluss historischer Ereignisse (Weltkriege, Wiedervereinigung) auf das Englandbild
- Die Rolle der englischen Medien bei der Konstruktion des Deutschlandbildes
- Die Entwicklung und der Wandel von Stereotypen über die Zeit
- Konzeption einer DaF-Unterrichtseinheit zur kritischen Auseinandersetzung mit Stereotypen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Worte mit Blick auf die Begriffe „Stereotyp“ und „Vorurteil“: Der einleitende Abschnitt definiert die Begriffe Stereotyp und Vorurteil und betont deren universelle Präsenz in zwischenkulturellen Begegnungen. Er hebt die Rolle der Medien bei der Verbreitung von Fremdbildern hervor und unterscheidet zwischen neutralen Stereotypen und negativ besetzten Vorurteilen, die oft auf Missverständnissen und Unkenntnis beruhen. Die Arbeit kündigt eine Analyse des englischen Deutschlandbildes in Alltag, Geschichte und Medien an, gefolgt von einer konzeptionellen Darstellung einer DaF-Unterrichtseinheit zur Bewusstmachung dieser Bilder.
Kulturelle Missverständnisse im Alltag zwischen Deutschen und Engländern: Dieses Kapitel beleuchtet alltägliche kulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und Engländern, die zu Missverständnissen und der Entstehung von Vorurteilen führen können. Die direkte Kommunikationsweise der Deutschen wird im Gegensatz zur indirekteren britischen Art beschrieben, ebenso die unterschiedlichen Auffassungen von Pünktlichkeit. Der deutsche Hang zu Ordnung und Bürokratie wird mit der britischen Pragmatik kontrastiert, wobei die hohe Qualität deutscher Produkte als Gegenbeispiel angeführt wird. Der Abschnitt illustriert, wie scheinbar kleine Unterschiede in der Lebensweise zu größeren kulturellen Konflikten führen können.
Stereotypisierungen in der Geschichte: Dieses Kapitel verfolgt die historische Entwicklung negativer Stereotype über Deutsche in England, beginnend mit den Berichten frühmittelalterlicher Mönche über die „Barbarei“ der Germanen. Die Weltkriege werden als entscheidende Momente hervorgehoben, in denen die Propaganda das Bild des „Hunnen“ und des militaristischen, brutalen Deutschen festigte. Die wirtschaftliche Macht Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert erzeugte Neid und die Befürchtung eines neuen deutschen Hegemonialstrebens, was sich besonders während der Wiedervereinigung zeigte. Das Kapitel analysiert, wie historische Ereignisse und politische Entwicklungen das deutsche Bild in England prägten und bis heute beeinflussen.
Das Portrait des Deutschen in den englischen Medien: Dieser Abschnitt untersucht die Darstellung Deutschlands in englischen Medien. Während in älteren Filmen und Fernsehserien negative Klischees dominierten (z.B. der preußische Offizier, der deutsche Spion), zeigen neuere Entwicklungen eine zunehmende kritische Auseinandersetzung mit veralteten Stereotypen. Der Artikel betont den ambivalenten Charakter des englischen Deutschlandbildes, das zwischen der Wahrnehmung des militaristischen Deutschen und dem des wirtschaftlich starken und kulturell interessanten Nachbarn schwankt. Die Arbeit differenziert zwischen der verantwortungsvollen Berichterstattung und der weiterhin existierenden Verbreitung von primitiven Stereotypen in Teilen der britischen Medienlandschaft.
Schlüsselwörter
Deutschlandbild, Stereotype, Vorurteile, England, Kulturvergleich, interkulturelle Kommunikation, Medien, Geschichte, Weltkriege, Wiedervereinigung, DaF-Unterricht, Landeskunde, Klischees, deutsch-englische Beziehungen, Wirtschaftswunder.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Das Englische Deutschlandbild
Was ist das Thema des Textes?
Der Text analysiert das englische Deutschlandbild, indem er alltägliche kulturelle Missverständnisse, historische Stereotypisierungen und deren Darstellung in englischen Medien untersucht. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der ambivalenten Wahrnehmung Deutschlands in Großbritannien zu zeichnen und die Konstruktion und Perpetuierung von Stereotypen zu beleuchten.
Welche Aspekte des englischen Deutschlandbildes werden behandelt?
Der Text beleuchtet verschiedene Aspekte, darunter kulturelle Missverständnisse im deutsch-englischen Alltag (z.B. Kommunikationsstile, Pünktlichkeit, Ordnungssinn), den Einfluss historischer Ereignisse wie der Weltkriege und der Wiedervereinigung, die Rolle der englischen Medien bei der Konstruktion des Deutschlandbildes und die Entwicklung und den Wandel von Stereotypen über die Zeit.
Wie werden kulturelle Missverständnisse im Alltag beschrieben?
Der Text beschreibt Unterschiede in der Kommunikationsweise (direkte vs. indirekte), Auffassungen von Pünktlichkeit und dem Umgang mit Ordnung und Bürokratie. Diese Unterschiede werden als mögliche Quellen für Missverständnisse und die Entstehung von Vorurteilen dargestellt.
Welche Rolle spielen historische Ereignisse im englischen Deutschlandbild?
Der Text hebt die Weltkriege als entscheidende Momente hervor, in denen die Propaganda das Bild des „Hunnen“ und des militaristischen, brutalen Deutschen festigte. Die wirtschaftliche Macht Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert erzeugte Neid und die Befürchtung eines neuen deutschen Hegemonialstrebens, was sich besonders während der Wiedervereinigung zeigte.
Wie wird die Darstellung Deutschlands in den englischen Medien analysiert?
Der Text untersucht die Darstellung Deutschlands in englischen Medien über die Zeit, von älteren Filmen und Fernsehserien mit negativen Klischees bis hin zu neueren Entwicklungen mit einer zunehmenden kritischen Auseinandersetzung mit veralteten Stereotypen. Der ambivalente Charakter des englischen Deutschlandbildes wird hervorgehoben.
Welche didaktische Komponente beinhaltet der Text?
Der Text beinhaltet die Konzeption einer DaF-Unterrichtseinheit zum Thema „Kaffee oder Tee? Englische und deutsche Essens- und Trinkstereotype“, die die kritische Auseinandersetzung mit Stereotypen zum Ziel hat. Die Konzeption umfasst Lehr- und Lernziele, Stoffeinheiten (Vorentlastung, Einführung neuer Inhalte, Übungen, Sprachspiele) und eine didaktische Reflexion.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Deutschlandbild, Stereotype, Vorurteile, England, Kulturvergleich, interkulturelle Kommunikation, Medien, Geschichte, Weltkriege, Wiedervereinigung, DaF-Unterricht, Landeskunde, Klischees, deutsch-englische Beziehungen, Wirtschaftswunder.
Wie werden die Begriffe „Stereotyp“ und „Vorurteil“ definiert?
Der Text definiert Stereotype und Vorurteile und betont deren universelle Präsenz in zwischenkulturellen Begegnungen. Er hebt die Rolle der Medien bei der Verbreitung von Fremdbildern hervor und unterscheidet zwischen neutralen Stereotypen und negativ besetzten Vorurteilen, die oft auf Missverständnissen und Unkenntnis beruhen.
- Citar trabajo
- Adeline Pissang (Autor), 2004, Wie sehen uns die Engländer? Eine Untersuchung der Stereotype des englischen Deutschlandbildes; Exkurs: Theoretisches Unterrichtskonzept für den DaF-Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27392