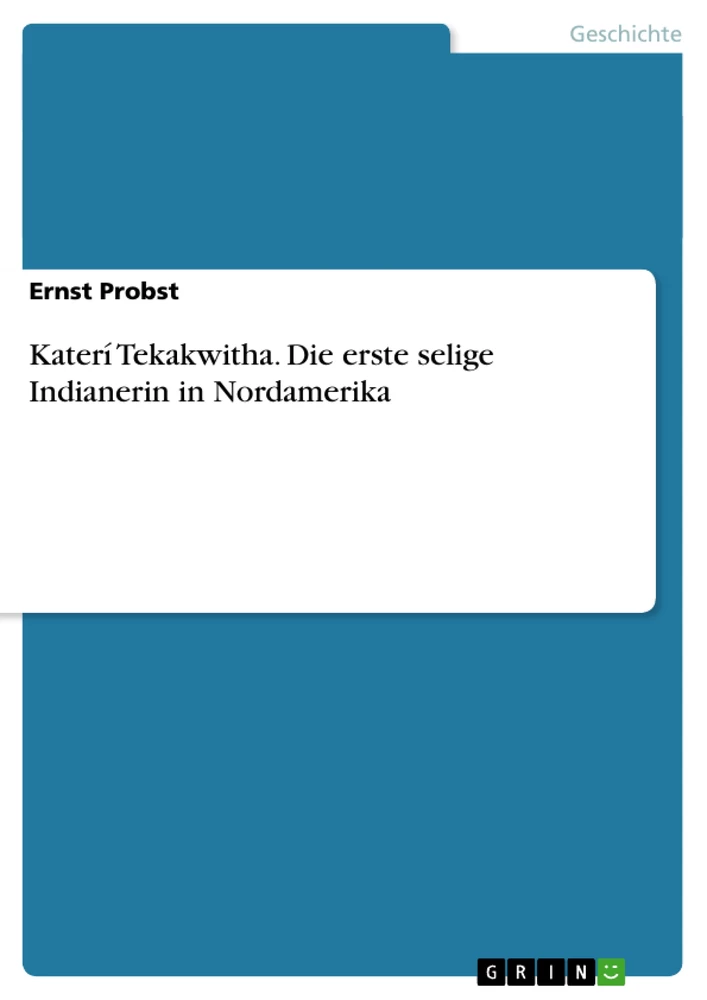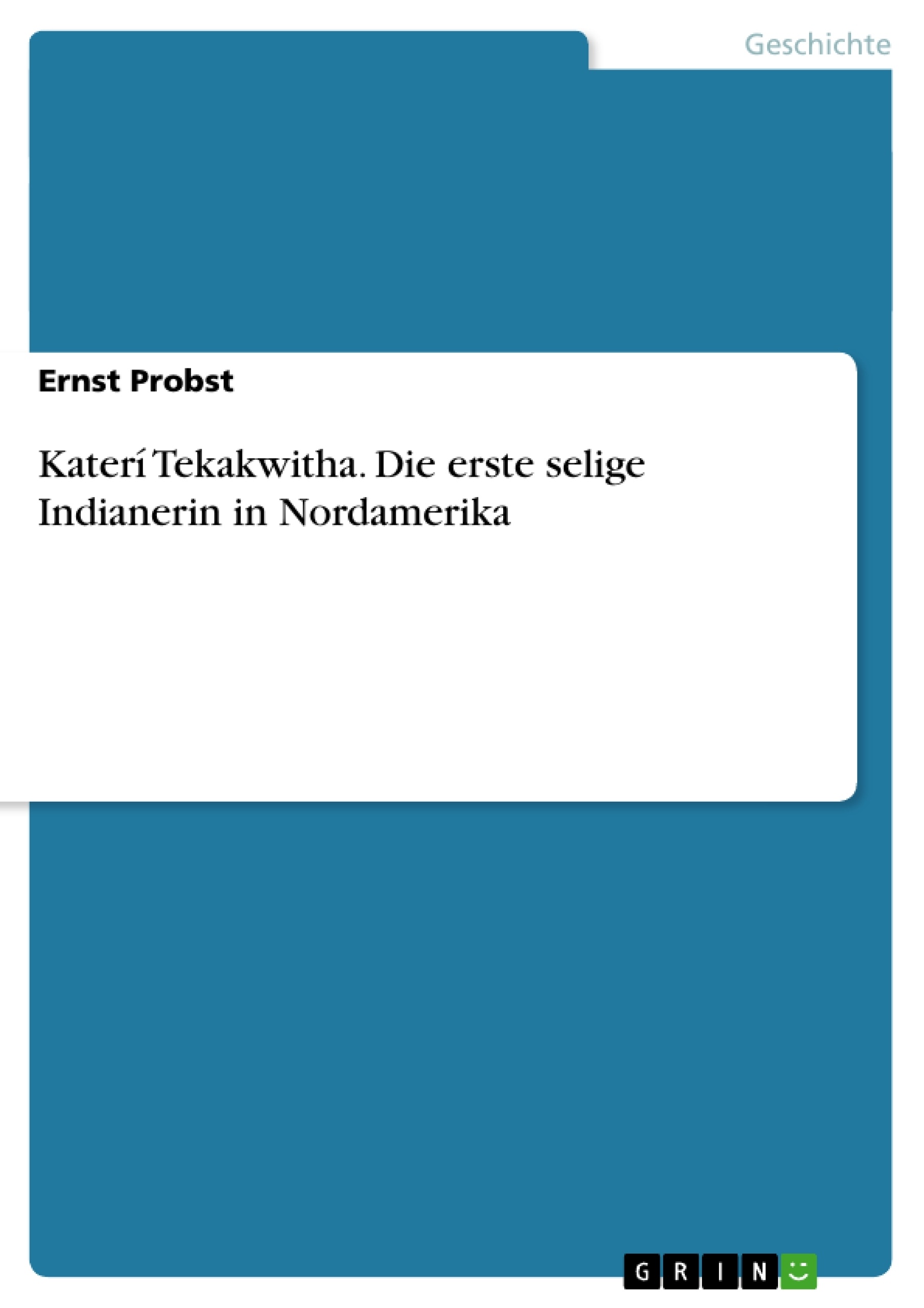Nur 24 Jahre alt wurde die Indianerin Katerí Tekakwitha (1656–1680), die „Lilie der Móhawk“. In ihrem kurzen Leben litt die tugendhafte junge Frau vom wildesten und grausamsten Stamm der Irokesen unter schweren Krankheiten, vielen Anfeindungen heidnischer Zeitgenossen sowie selbst auferlegten schmerzhaften Bußen. Nach ihrem frühen Tod geschahen Wunder, Gebetserhörungen und Heilungen. 1980 sprach man sie selig und 2012 heilig. Das Leben dieser ungewöhnlichen Frau wird in dem Taschenbuch „Katerí Tekakwitha. Die erste selige Indianerin in Nordamerika“ des Wiesbadener Autors Ernst Probst geschildert. Aus seiner Feder stammen die Taschenbücher „Malinche. Die Gefährtin des spanischen Eroberers“, „Pocahontas. Die Indianer-Prinzessin aus Virginia“, „Cockacoeske. Die „Königin der Pamunkey“, „Katerí Tekakwitha. Die erste selige Indianerin in Nordamerika“, „Sacajawea. Die indianische Volksheldin“, „Mohongo. Die In-dianerin, die in Europa tanzte“, „Lozen. Die tapfere Kriegerin der Apachen“, „Sieben berühmte Indianerinnen“ und „Superfrauen aus dem Wilden Westen“.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Katen' Tekakwitha
- Die erste selige Indianerin in Nordamerika
- Als erste nordamerikanische Indianerin, die selig gesprochen wurde, ging Katharina Tekakwitha (1656— 1680), eigentlich Kateri Tekakwitha, in die Geschichte der katholischen Kirche ein.
- Kateri Tekakwitha kam im April 1656 als erstes Kind des Kriegshäuptlings Tsonit6wa („Großer Biber") und dessen Frau Kah6nta („Wiese") in der Siedlung Ossernénon — heute Auriesville im US-Bundesstaat New York (USA) — zur Welt.
- Dort, wo einst das alte Ossernénon lag, befindet sich heute eine große Wallfahrtskirche zu Ehren der drei 1930 heilig gesprochenen Männer, die einst an diesem Ort von den N16hawk grausam gefoltert, als Sklaven gehalten und ermordet wurden: René Goupil (1608— 1642), Isaak Jogues (1607-1646) und Jean de La lande
- René Goupil wurde am 29. September 1642 in Ossernénon mit Tomahawkschlägen auf den Kopf getötet, weil er einlgen Kindern der M6hawk das Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht hatte.
- Nach dem Tod von Goupil hat man Jogues als Sklaven schuften lassen und drangsaliert.
- Trotz seiner leidvollen Erfahrungen reiste Jogues im Mai 1646 nach Ossernénon, um einen Friedensvertrag zwischen den Franzosen und den N16hawk, deren Sprache er gut beherrschte, auszuhandeln.
- Im September 1646 reiste Jogues erneut nach Ossernénon, um weitere Details des Friedensvertrages zu regeln.
- Ein Jahrzehnt nach dem Märtyrertod von Isaak Jogues und Jean La Lande kam in Ossernénon ein Mädchen zur Welt, das ganz und gar nicht seinen grausamen Stammesgenossen glich.
- Bei den Irokesen, die sich selbst als Haudenosaunee („Leute des Langhauses" bezeichneten, gab die Mutter jeweils gleich nach der Geburt ihrem Kind einen Kosenamen.
- Die Mutter von Jorågode gehörte einem Stamm der Alg6nkin an.
- 1658 schenkte die Mutter der etwa zweijährigen Jorågode einem Jungen das Leben.
- 1660 starben die Mutter, der Vater und der Bruder von Jåragode an Pocken.
- Nach dem Tod ihrer Eltern lebte Jarågode bei ihrem Onkel, dem Krieger Jowanéro („Kalter Wind"), der Karitha („Köchin"), die Schwester ihres Vaters, geheiratet hatte.
- Einige Monate nach dem Ende der Pockenepidemie verließen die M6hawk im Spätsommer 1660 Ossernénon.
- Im neuen Langhaus von Gandaouagué streckte die halb blinde Jarågode oft die Arme vor, um nicht anzustoßen, und tastete sich voran.
- Im September 1664 verloren die Holländer ihre Kolonie Neu-Niederlande in Nordamerika an die Engländer.
- Im Oktober 1666 erlebte die ungefähr zehnjährlge Tekakwitha die Strafexpedition französischer Truppen aus Kanada gegen die M6hawk.
- Der Irokesenbund war etwa zwischen 1559 und 1570 nach verlustreichen Kriegen mit den Alg6nkin-Stämmen gegründet worden.
- An der Strafexpedition der Franzosen unter dem Befehl von General Alexandre de Prouville de Tracy (um 1596/ 1603—1670) gegen die NI(3hawk beteiligten sich rund 1.200 französische Soldaten.
- 1667 schlossen die M6hawk mit den Franzosen wieder Frieden.
- Im Dezember 1667 kamen die Patres Jacques Frérnin (1628—1691), Jacques Bruyas (1635—1712) und Jean Pierron (1631—um 1700) in das Dorf Gandaouagué.
- Von 1666 bis 1669 hatten sich die Irokesenstämme der mit ihnen verfeindeten M6hikaner zu erwehren, die sie vernichten wollten.
- Die angreifenden Möhikaner zogen nach vier Tagen wieder ab, weil den verteidigenden M6hawk in Gandaouagué immer mehr Krieger aus benachbarten Dörfern zu Hilfe eilten.
- Nach dem Sieg wurden in Gandaouagué zehn gefangene M6hikaner, darunter vier Frauen, die ihren Kriegern gefolgt waren, drei Tage lang gefoltert.
- 1671 hatte ein Ehestreit des M6hawk4Æiuptlings Ganeag6wa mit seiner christlichen Frau Satékon („Ebenmaß") in Gandaouagué ungeahnte Folgen.
- In Gandaouagué lebten in den 1670-er Jahren neben schätzungsweise 20 bis 30 christlichen Familien immer noch viele heidnische M6hawk.
- Obwohl sie sonst immer ihrem Onkel Jowanéro sowie ihren Tanten Karitha und Ar6son gehorchte, wehrte sich Tekakwitha im heiratsfähigen Alter gegen den Wunsch ihrer Verwandten, zu heiraten.
- Im Frühjahr 1675 stürzte Tekakwitha und verletzte sich dabei schwer an einem Fuß.
- Am nächsten Morgen besuchte Tekakwitha erstmals die Unterkunft der Mission.
- Acht Monate nach Beginn des Taufunterrichts wurde sie im Alter von 20 Jahren am Ostersonntag, 5. April 1676, zusammen mit zwei anderen Mädchen in der kleinen Kirche von Gandaouagué durch Pater Lamberville getauft.
- Weil sie als Katholikin am Sonntag nicht auf dem Feld arbeiten durfte, erhielt Kateri an diesem Tag von ihren Verwandten nichts mehr zu essen.
- Ab Frühjahr 1677 wurde der Weg zur Kirche in Gandaouagué für Kateri immer mehr zur Qual.
- Im September 1677 stürzte ein wilder Krieger mit Kriegsbemalung in das Langhaus, in dem sich Kateri gerade allein aufhielt.
- Nach diesem aufregenden Vorfall im Langhaus unternahm der Onkel Jowanéro nichts mehr, um Kateri vom Christentum abzubringen und wies deren Tanten Karitha und Arc3son an, sie in Ruhe zu lassen.
- Das Leben bei den Möhawk in Gandaouagué war Kateri inzwischen so verleidet, dass sie In schlaflosen Nächten immer öfter an die im christlichen Gebetsdorf am Sankt-Lorenz-Strom friedlich zusam-menlebenden Menschen dachte.
- Im Juli 1677 flüchtete Tekakwitha mit Hilfe von drei christlichen Indianern (Häuptling Garonjåge und zwei Indianern namens Onas und Jakob) im Morgengrauen aus Gandaouagué.
- Nach dreiwöchiger Reise kam Kateri in der mehr als 200 Meilen (etwa 330 Kilometer) entfernten, nach dem heiligen Franz Xaver (1506—1552) benannten „Francis-Xavier-Mission" an den Sault-Saint-Louis-Stromschnellen (heute Lachine-Stromschnellen) am Sankt-Lorenz-Strom in Kanada an.
- In Caughnawaga wohnte Katerf in einem Langhaus zusammen mit dem Ehepaar Onas und Onida mit ihren zwei Kindern sowie mit ihrer erwähnten Freundin Anastasia Tegonhadsih6ngo.
- Die christlichen Indianer von Caughnawaga gingen nach den Weihnachtsfeiern in die Wälder des südlichen Berglandes, wo die Wigwams der Adirondack-Indianer („Sie essen Bäume") lagen.
- Wenn die Arbeit im Winterlager getan war, wanderte Kateri allein in den Wald zu einem Schlupfwinkel unter großen Tannen.
- Kurz vor dem Palmsonntag kehrten die christlichen Indianer aus dem Winterlager nach Caughnawaga zurück.
- Am letzten Sonntag im April 1678 traf Kateri unter einem großen Holzkreuz auf einem Hügel am Ufer des Sankt-Inrenz-Stroms die 28-jährige Oneida-lndianerin Thér&se Tegaiagonta.
- Im Sommer 1678 fuhren Kateri und andere Indianerfrauen aus Caughnawaga in zwei Kanus auf dem Sankt-Lorenz-Strom hinab zur rund 1.000 Einwohner zählenden Siedlung Ville-Marie, wie Montreal damals hieß.
- Als sie in Caughnawaga mit Thérese unter dem Holzkreuz am Nussufer saß, erklärte Kateri, sie wolle das Gelöbnis der Jungfräulichkeit ablegen, wie es die weißen Schwestern in VilleA1arie taten.
- Zur nächsten Winterjagd kam Kateri nicht mit.
- Nach den Vorstellungen der Jesuiten gehörten Jungfräulichkeit, religiöse Hingabe, Selbstkasteiung (Selbstzüchtigung) und Verzicht auf weltlichen Besitz, den man den Armen schenken sollte, zum Leben ernes Heiligen.
- Gleich mehrere Frauen in Caughnawaga unterzogen sich freiwilligen Entbehrungen und Leiden um ernes höheren Gutes willen.
- Kateri besuchte in Caughnawaga jeden Vormittag alte und kranke Stammesgenossen und kümmerte sich um sie.
- Überdies praktizierte Kateri übertriebene Bußübungen.
- Bei der Rückkehr von der Wrnterjagd Mitte März 1679 erschraken die Freundinnen und Freunde von Kateri beim Anblick von derem stark abgemagerten Körper.
- Am 25. März 1679, dem Fest Mariä Verkündigung, legte die 22-jährlge Kateri Tekakwitha das Gelübde der ewigen Jungfräulichkeit ab.
- Fortan lebte Kateri wie eine Nonne.
- Zeitweise dachte Katerf auch daran, sich ihre Haare abzuschneiden und ständig wie Nonnen einen Schleier zu tragen.
- Die bußwütigen Indianerfrauen Kateri und Therese fasteten, trugen Bußgürtel, setzten sich dünn bekleidet der Winterkälte aus, litten Durst im Sommer und geißelten sich heimlich im Wald mit Dornenzweigen, bis ihre Schultern bluteten.
- Täglich ging Kateri bereits morgens um vier Uhr zur Kirche.
- Im Sommer 1679 erkrankte Kateri schwer, litt zwei Wochen unter starkem Fieber und schien fast dem Tode nahe.
- Im Herbst 1679 fühlte sich Kateri immer erschöpft und litt ständig an leichtem Fieber.
- Im Winter 1679/ 1680 litt Kateri wiederholt an starkem Fieber und war bettlägerig.
- Kaum waren die Anfälle überwunden, unternahm Kateri wieder Besuche bei Alten und Kranken und führte Gebetsübungen in der Kirche durch.
- Einmal drückte sich die fanatische Kateri ein glühendes Holzscheit auf ihren rechten Fuß und erzeugte so — wie die Irokesen bei ihren Sklaven ein Brandmal.
- Im März 1860 litt Kateri wieder unter Fieber, musste das Bett hüten, hatte schlimme Schmerzen und starkes Kopfweh.
- Ab Palmsonntag wachte in jeder Nacht ein weibliches Mitglied der frommen „Bruderschaft von der Heiligen Familie" am Krankenlager von Katerf.
- Am Dienstag der Karwoche fühlte sich Kateri so schwach und elend, dass man ihren Tod befürchtete.
- Am Mittwoch der Karwoche gegen zehn Uhr vormittags erhielt Katerf die „Heilige Ölung".
- Am 17. April 1680, einige Minuten nach drei Uhr nachmittags, zuckte das Gesicht von Kateri leicht und ihre Züge entspannten sich.
- Sofort nach dem Ableben der 24jährigen Kateri Tekakwitha änderten sich langsam, aber merklich deren Gesichtszüge.
- Nach dem Tod von Kateri stritten die Jesuitenpater vor Ort über den Verbleib ihrer Reliquien.
- Einen Tag nach ihrem Tod hat man Kateri am 18. April 1680 begraben.
- Pater Claude Chaucheti&re glaubte nach Visionen, den Tod einer Heiligen erlebt zu haben.
- Auch Wunder, zahlreiche Gebetserhörungen und Heilungen werden Kateri Tekakwitha zugeschrieben.
- Der Jesutitenpater Claude Chaucheti&re zeichnete Kateri Tekakwitha nach ihrem Tod irgendwann zwischen 1682 und 1693 aus dem Gedächtnis.
- Der erwähnte Jesuitenmissionar Pierre Cholonec schrieb die Berichte von Personen, die Katerf Tekakwitha persönlich begegnet waren, am 27. August 1715 nieder.
- Ab dem 19. Jahrhundert versuchten nordamerikanische Katholiken mehrfach, beim „Heiligen Stuhl" in Rom die Seligsprechung von Kateri Tekakwitha zu erreichen.
- 1939 wurde eine Versammlung indianischer Katholiken gegründet, die seit 1940 „Tekakwitha Conference" heißt.
- Papst Pius XII. (1876—1958) erklärte am 3. Januar 1943, die Prüfung der Ritenkongregation in Rom habe die heroische Tugend von Kateri Tekakwitha ergeben und ihr gebühre der Titel „Ehrwürdlge Dienerin Gottes".
- Papst Johannes Paul 11. (1920—2005) sprach sie am 22. Juni 1980 selig.
- Der aus Osterreich stammende Jesuit Franz Xaver Weiser (1901—1986), der seit 1938 in den USA lebte, schilderte das Leben und Werk von Kateri Tekakwitha in dem Buch „Das Mädchen der Mohawks", das in englischer und 1969 erstmals auch in deutscher Sprache erschien.
- Papst Benedikt XVI. gab am 19. Dezember 2011 die Anerkennung ernes Wunders durch die katholische Kirche bekannt, das sich 2006 ereignete hatte und auf die Anrufung der seligen Kateri Tekakwitha zurückgeführt wurde.
- Papst Benedikt WI. sprach Katheri Tekakwitha am 21. Oktober 2012 auf dem Petersplatz in Rom heilig.
- Die NI(3hawk reagierten auf die Heiligsprechung einer der Ihren sehr unterschiedlich.
- Die Gebeine von Kateri Tekakwitha werden heute in der Kirche der M(3hawk-Reservation in Caughnawaga in einer kostbaren Truhe mit einem Glasdeckel aufbewahrt.
- Über Kateri Tekakwitha wurden bis zum Ende des 20. Jahrhunderts rund 50 Biografien in zehn Sprachen verfasst.
- Literatur
- Bildquellen
- Autor Ernst Probst
- Der Autor
- Bücher von Ernst Probst
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Taschenbuch erzählt die Lebensgeschichte von Kateri Tekakwitha, der ersten seligen Indianerin in Nordamerika. Es zeichnet ein detailliertes Bild ihres Lebens, ihrer Herausforderungen und ihres christlichen Glaubens. Der Text beleuchtet die Geschichte der Irokesen, insbesondere des Möhawk-Stammes, sowie die Rolle der katholischen Missionare in der Kolonialzeit.
- Das Leben und Werk von Kateri Tekakwitha
- Die Geschichte und Kultur der Irokesen, insbesondere des Möhawk-Stammes
- Die Rolle der katholischen Missionare in der Kolonialzeit
- Die Herausforderungen des christlichen Glaubens in einer heidnischen Gesellschaft
- Die Bedeutung von Kateri Tekakwitha als Symbol der interkulturellen Begegnung und des christlichen Glaubens
Zusammenfassung der Kapitel
Das Buch beginnt mit einer Einführung in das Leben und Werk von Kateri Tekakwitha, der ersten seligen Indianerin in Nordamerika. Es schildert ihre Kindheit und Jugend im Möhawk-Dorf Ossernénon, das heute Auriesville im US-Bundesstaat New York heißt. Der Text beschreibt die grausamen Taten der Möhawk gegenüber den französischen Missionaren und die tragischen Schicksale von René Goupil, Isaak Jogues und Jean de La Lande.
Danach erzählt das Buch von Kateris Kindheit und Jugend, ihrem christlichen Glauben und ihrer Flucht aus dem Möhawk-Dorf Gandaouagué nach Caughnawaga in Kanada. Es schildert die Herausforderungen, denen sie sich im christlichen Indianerdorf stellen musste, und ihre tiefe Hingabe zum Glauben.
Das Buch schildert Kateris Bußübungen, ihre Krankheit und ihren Tod. Es beschreibt die Wunder, die nach ihrem Tod geschehen sind, und die Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. im Jahr 1980.
Der Text endet mit einer Betrachtung der Bedeutung von Kateri Tekakwitha für die katholische Kirche und für die indianische Kultur. Er beschreibt die Heiligsprechung durch Papst Benedikt XVI. im Jahr 2012 und die unterschiedlichen Reaktionen der Möhawk auf dieses Ereignis.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Kateri Tekakwitha, die erste selige Indianerin in Nordamerika, die Geschichte der Irokesen, insbesondere des Möhawk-Stammes, die Rolle der katholischen Missionare in der Kolonialzeit, die Herausforderungen des christlichen Glaubens in einer heidnischen Gesellschaft, die Bedeutung von Kateri Tekakwitha als Symbol der interkulturellen Begegnung und des christlichen Glaubens, die Heiligsprechung von Kateri Tekakwitha und die Reaktionen der Möhawk auf dieses Ereignis.
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2014, Katerí Tekakwitha. Die erste selige Indianerin in Nordamerika, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273910