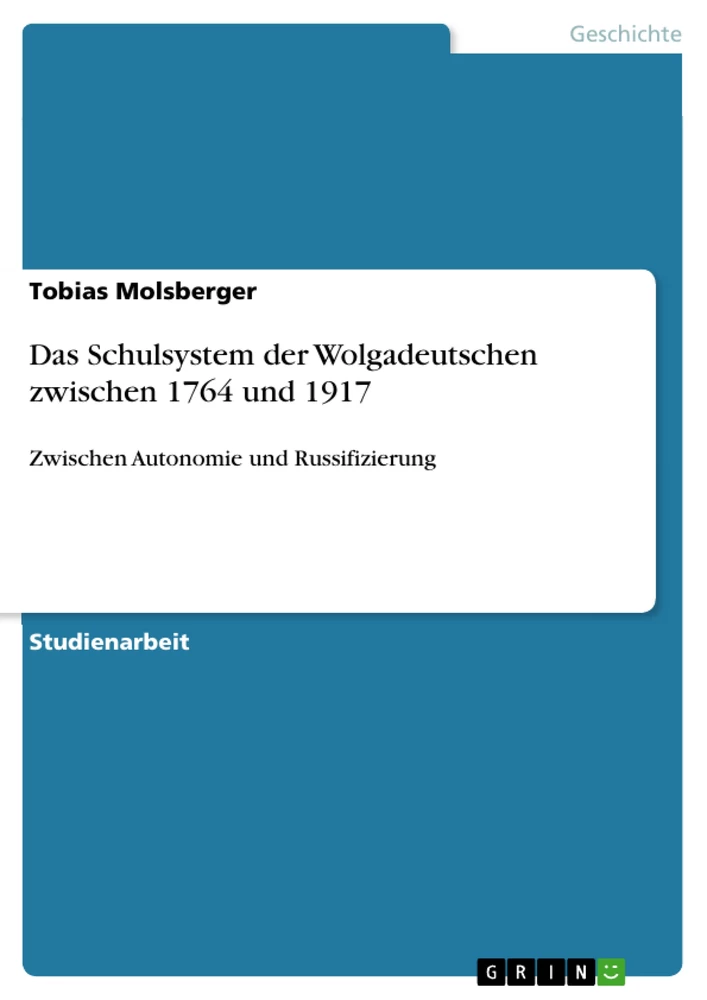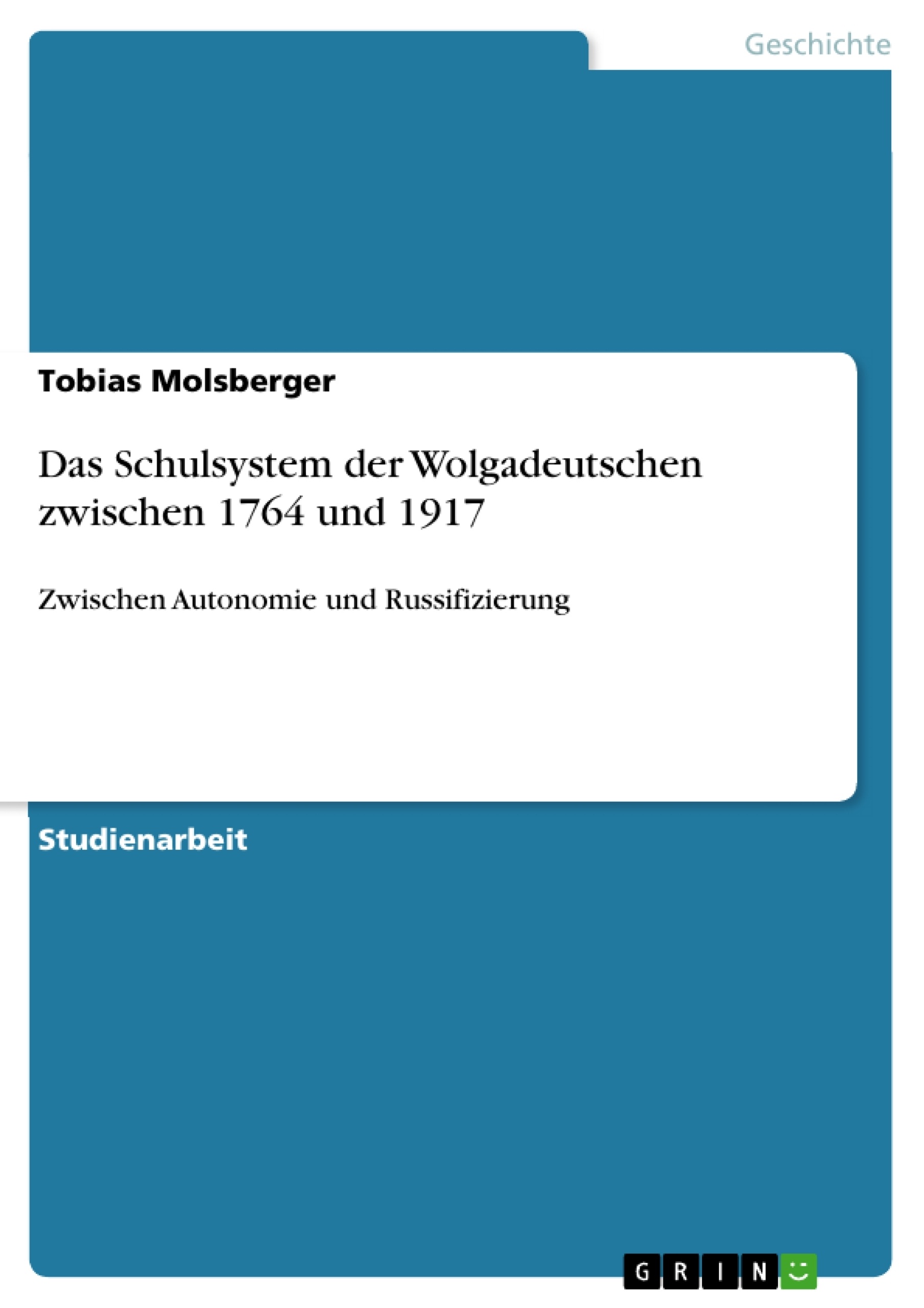Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Schulwesen der Russlanddeutschen schwerpunktmäßig, mit den Regionen an der Wolga von den ersten Ansiedlungen in den 1760ern bis hin zum ersten Weltkrieg. Ein allumfassender Blick, der auch die Schwarzmeerregion miteinschließen würde, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Es soll sich ein Überblick über Forschungsstand, das bedeutet das Schul- und Bildungswesen als wesentliche Institution zur Reproduktion und Erhaltung kultureller Identität, verschafft werden. Bis heute ist das Schulwesen in der Forschung zu den Russlanddeutschen nur sehr marginal berücksichtigt worden. Thematisch liegt der Fokus dieser Arbeit darüber hinaus auf dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Russifizierung des wolgadeutschen Schulsystems während des genannten Zeitraums von 150 Jahren. Hinzu kommt eine Skizzierung der Entwicklung des deutsch-mennonitischen Schulwesens auf russischem Boden, welches sich in signifikanten Aspekten von jenem der anderen deutschen Einwanderer unterschied, worauf kontrastierend im Fazit dieser Arbeit eingegangen wird. Es folgt ein kurzer Ausblick auf die sich verändernden Verhältnisse der 1920er Jahre, die gleichzeitig das Ende des eigenständigen russlanddeutschen Schulwesens bedeuten.
Zunächst ist anzumerken, dass die deutschen Einwanderer in Russland keine homogene Gruppe darstellten, sondern unterschiedlichste Berufe und soziale Hintergründe aufwiesen. Jede territoriale Gruppe hatte ihre eigenen Besonderheiten wie Sprache, Gebräuche, kulturell-religiöses Leben oder die Art des Wirtschaftens.
In der Forschung habe es lange eine Glorifizierung des russlanddeutschen Schulwesens in Beschreibungen und Verkennen möglicher Mängel gegeben, als Resultat von antirussischer Grundhaltung, inhaltliche Unklarheiten hinsichtlich Russifizierung und der Frage nach Schärfe und Konsequenz von Russifizierung (siehe Mennoniten). Heute scheint der Blick deutlich differenzierter, sodass die Lage gerade in konfessionellen Dorfschulen des 19. Jahrhunderts vielfach als schlecht beschrieben wird. Dennoch wird berichtet, die deutsche Schule sei die erste organisierte Bildungsinstitution auf russischem Staatsgebiet gewesen, da
vorher in Russland kein organisiertes Bildungswesen vorhanden gewesen sei. Erst mit Revolution 1917 wurde eine vierjährige Grundschulpflicht eingeführt.
Hier ist das Stellen folgender Frage sinnvoll: Welche Interessen verfolgten die Russen mit Russifizierungsmaßnahmen?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Schulwesen der Wolgadeutschen - Zwischen Autonomie und Russifizierung
- 2.1 Hintergründe
- 2.2 Die Anfänge des Schulwesens der Wolgadeutschen
- 2.3 Die Situation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
- 2.4 Der russische Staat ergreift erste Initiative
- 2.5 Die Hauptphase der Russifizierung 1891 bis 1905
- 2.6 Das Schulwesen im Ersten Weltkrieg
- 3. Der Sonderfall der Mennoniten
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Schulwesen der Wolgadeutschen zwischen 1764 und 1917, mit Fokus auf das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Russifizierung. Sie beleuchtet den Forschungsstand zum Thema und skizziert die Entwicklung des deutsch-mennonitischen Schulwesens im Vergleich zu anderen deutschen Einwanderergruppen. Die Arbeit verzichtet auf eine umfassende Betrachtung der Schwarzmeerregion und konzentriert sich auf die Wolga-Region.
- Entwicklung des wolgadeutschen Schulsystems im Kontext der russischen Geschichte
- Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Russifizierung im wolgadeutschen Schulwesen
- Vergleich des Schulwesens der Wolgadeutschen mit dem der Mennoniten
- Der Einfluss von Kirche und Religion auf das Schulwesen
- Das wolgadeutsche Schulsystem als Institution zur Bewahrung kultureller Identität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Schulwesens der Wolgadeutschen von den ersten Ansiedlungen bis zum Ersten Weltkrieg ein. Sie betont den Forschungsdefizit in diesem Bereich und fokussiert auf das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Russifizierung. Die Einleitung stellt klar, dass die Wolgadeutschen keine homogene Gruppe waren und erwähnt die unterschiedliche Darstellung des Schulwesens in der Forschung, von einer Glorifizierung bis hin zu einer differenzierteren Betrachtung der oft schlechten Bedingungen, besonders in den Dorfschulen. Die Arbeit benennt die zentrale Forschungsfrage nach den Interessen der russischen Russifizierungsmaßnahmen.
2. Das Schulwesen der Wolgadeutschen - Zwischen Autonomie und Russifizierung: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über das wolgadeutsche Schulsystem. Es beschreibt die enge Verbindung von Schule und Kirche als Bewahrerin der deutschen Tradition und Kultur. Der stark konfessionell geprägte Charakter des Systems in der frühen Phase und seine spätere Entwicklung bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ohne nennenswerte russische Einflussnahme wird analysiert. Die Arbeit hebt die unterschiedlichen Anforderungen an Schulen in ländlichen Dörfern im Vergleich zu städtischen Umgebungen hervor. Der Mangel an einem staatlichen russischen Bildungssystem und die Besonderheit des deutschen Schulsystems als erste organisierte Bildungsinstitution auf russischem Gebiet werden erläutert.
2.1 Hintergründe: Dieser Abschnitt skizziert die historischen Hintergründe des wolgadeutschen Schulsystems, beginnend mit der Gründung deutscher Kolonien in Russland. Die Arbeit betont die untrennbare Verbindung von Kirche und Schule in der Bewahrung deutscher Kultur und Traditionen. Die unterschiedliche Entwicklung der Kolonistenschule im Vergleich zu Schulen in deutschsprachigen Gebieten wird hervorgehoben und die langfristige Unabhängigkeit vom russischen Einfluss bis zur zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschrieben, wobei auch das russische Bildungssystem im 18. Jahrhundert und seine Entwicklung im Kontext zum deutschen Schulsystem beleuchtet wird.
2.2 Die Anfänge des Schulwesens der Wolgadeutschen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Anfänge des Schulwesens und die drei von Süss identifizierten Phasen: Gründung und kirchliche Organisation (1764-1840), Ausdifferenzierung verschiedener Schultypen (1840-1897) und die letzte Phase bis 1917. Es wird festgestellt, dass die Manifeste zur Ansiedlung der Deutschen an der Wolga keine Aussagen zum Bildungssystem enthielten, was mit dem damaligen Mangel an staatlichem Bildungssystem in Russland begründet wird. Die Arbeit erwähnt den Fortbestand der mennonitischen Schulen bis in die 1920er Jahre.
3. Der Sonderfall der Mennoniten: Dieser Abschnitt behandelt das Schulwesen der Mennoniten als Sonderfall, der sich in signifikanten Aspekten von dem der anderen deutschen Einwanderer unterschied.
Schlüsselwörter
Wolgadeutsche, Schulwesen, Russifizierung, Autonomie, Mennoniten, kulturelle Identität, Bildung, Kirche, Russland, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Erster Weltkrieg.
Häufig gestellte Fragen zum Schulwesen der Wolgadeutschen (1764-1917)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Schulwesen der Wolgadeutschen zwischen 1764 und 1917, mit besonderem Fokus auf das Spannungsverhältnis zwischen der Autonomie der Wolgadeutschen und der Russifizierungspolitik des zaristischen Russland. Die Arbeit konzentriert sich auf die Wolga-Region und vergleicht das Schulwesen der Wolgadeutschen mit dem der Mennoniten.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des wolgadeutschen Schulsystems im Kontext der russischen Geschichte, das Spannungsverhältnis zwischen Autonomie und Russifizierung, einen Vergleich mit dem mennonitischen Schulwesen, den Einfluss von Kirche und Religion und die Rolle des Schulsystems als Institution zur Bewahrung kultureller Identität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es darin?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) bietet einen Überblick über die Thematik und den Forschungsstand. Kapitel 2 (Das Schulwesen der Wolgadeutschen – Zwischen Autonomie und Russifizierung) analysiert die Entwicklung des Schulsystems von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg, einschließlich der Hintergründe und verschiedener Phasen. Kapitel 3 betrachtet den Sonderfall des mennonitischen Schulwesens. Kapitel 4 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Einfluss der Russifizierung dargestellt?
Die Arbeit analysiert, wie die Russifizierungspolitik des zaristischen Russland das wolgadeutsche Schulwesen beeinflusste. Sie beleuchtet die verschiedenen Phasen dieser Politik und ihre Auswirkungen auf die Autonomie des deutschen Schulsystems. Besonders die Phase von 1891 bis 1905 wird als Hauptphase der Russifizierung hervorgehoben.
Welche Rolle spielte die Kirche im wolgadeutschen Schulwesen?
Die Kirche spielte eine zentrale Rolle im wolgadeutschen Schulwesen. In der frühen Phase war die Schule eng mit der Kirche verbunden und diente der Bewahrung der deutschen Kultur und Tradition. Der konfessionell geprägte Charakter des Schulsystems wird ausführlich behandelt.
Wie unterscheidet sich das Schulwesen der Mennoniten von dem der anderen Wolgadeutschen?
Das Schulwesen der Mennoniten wird als Sonderfall behandelt, der sich in wesentlichen Aspekten von dem der anderen deutschen Einwanderergruppen unterschied. Die genauen Unterschiede werden im Kapitel 3 näher erläutert.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit benennt zwar keine expliziten Quellen, impliziert aber die Verwendung von historischen Dokumenten, Forschungsliteratur und möglicherweise Archiven, um die Entwicklung des wolgadeutschen Schulwesens zu rekonstruieren.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit betrifft die Interessen und Ziele der russischen Russifizierungsmaßnahmen im Kontext des wolgadeutschen Schulwesens.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wolgadeutsche, Schulwesen, Russifizierung, Autonomie, Mennoniten, kulturelle Identität, Bildung, Kirche, Russland, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Erster Weltkrieg.
- Quote paper
- Tobias Molsberger (Author), 2014, Das Schulsystem der Wolgadeutschen zwischen 1764 und 1917, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273740