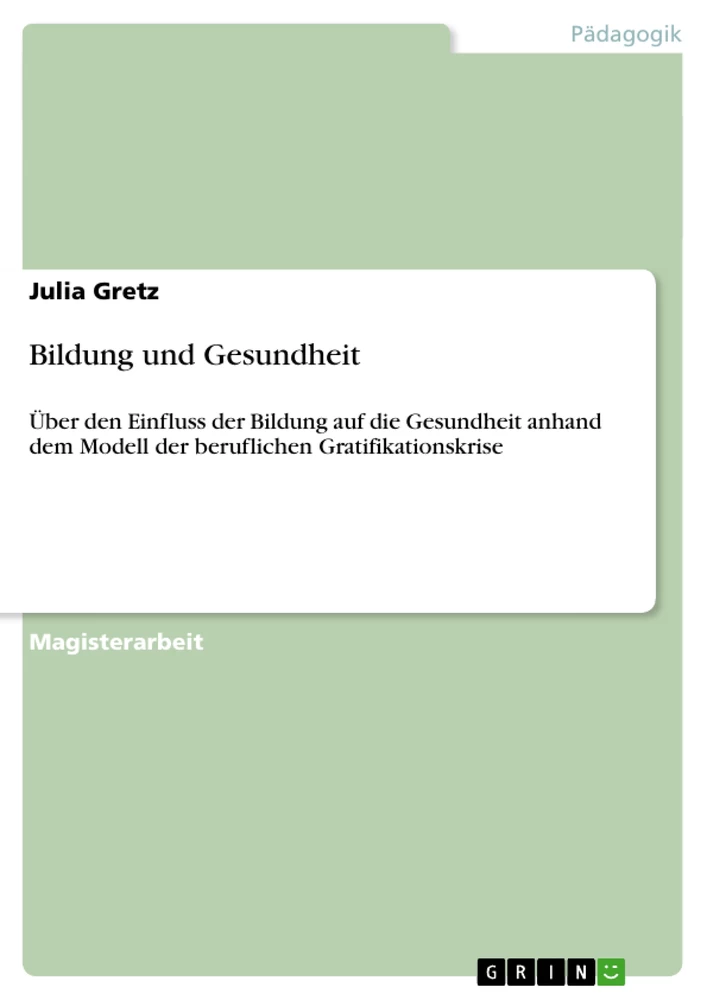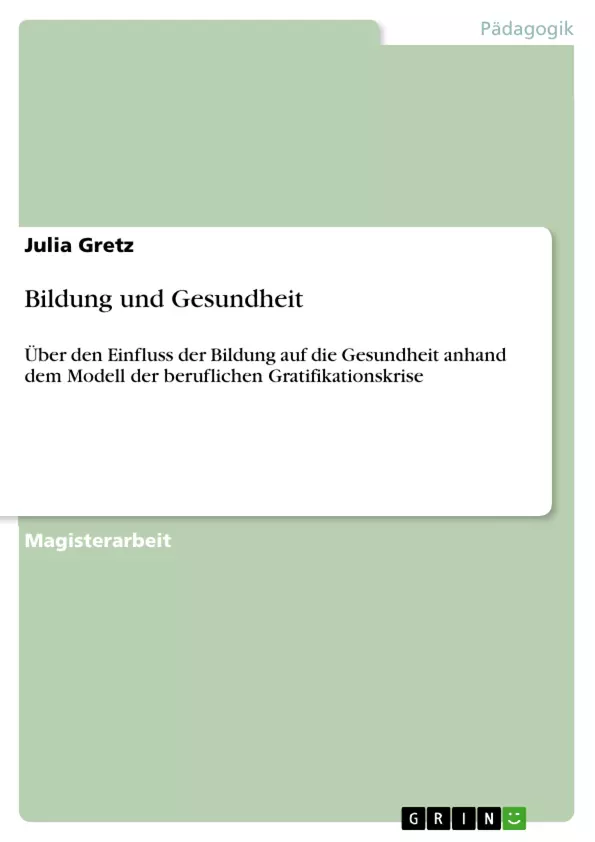Die Folgen hoher Arbeitsbelastungen sind für den einzelnen Mitarbeiter ebenso gravierend
wie für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Gesamtsituation. Allein zwischen 2006 und
2009 ist der Anteil an vorzeitigen Renteneintritten aufgrund psychischer Erkrankungen um
5% auf 38% gestiegen (vgl. Dragano/Kroll/Müters 2011: 5). In Anbetracht der dargelegten
demographischen Prognose ist ein derartiger Ausfall an Arbeitskräften weder für die
Unternehmen noch für die Gesellschaft tragbar.
Setzt man nun die aufgeführten gesellschaftlichen und arbeitsspezifischen Entwicklungen in
Zusammenhang, ergibt sich ein Bedarf an möglichst hochqualifizierten Erwerbstätigen, die
sich einerseits den veränderten Anforderungsprofilen anpassen und andererseits den
gegebenen Arbeitsbedingungen in der Weise gewachsen sind, dass weder ihre
Arbeitsleistung, noch ihre persönliche Gesundheit eingeschränkt wird. Die sich daraus
ergebenden zentralen Faktoren sind das Bildungsniveau und die Arbeitsbelastungen.
Aufgrund der Aktualität und Brisanz der Thematik ist eine Zusammenführung dieser Faktoren
besonders aus erziehungswissenschaftlicher Sicht von Interesse, da eine solche Untersuchung
bisher kaum unternommen wurde. Dies zeigt auch die hierzu spärlich vorhandene
pädagogische Literatur.
Daher soll das Thema vorliegender Magisterarbeit der Zusammenhang von Bildung und
Arbeitsbelastungen, und die daraus resultierenden Folgen sein. Die fokussierte Fragestellung
ist dabei, welchen Einfluss Bildung auf das Erleben von und den Umgang mit belastenden
Arbeitsanforderungen hat.
Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Bildung und
Arbeitsbelastungen setzt eine Definition der Begriffe voraus. Während dabei das
Qualifikationsniveau eines Mitarbeiters leicht durch zertifizierte Bildungsabschlüsse
definierbar ist, stellt sich jedoch die Frage was eine belastende Arbeitssituation ist bzw. wann
eine Arbeitsanforderung als Belastung wahrgenommen wird. Ein theoretisches Modell,
welches dieser Frage nachgeht, ist das Modell der beruflichen Gratifikationskrise von
Johannes Siegrist (1996). Es führt dabei die individuellen Erwartungen und Haltungen eines
Mitarbeiters mit den externen Arbeitsanforderungen zusammen und erklärt hieraus die
Gründe für das Erleben belastender Arbeitsanforderungen bzw. Arbeitsstress.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2. Vorgehensweise
- 2. Stresstheoretischer Hintergrund
- 2.1. Definition Gesundheit und Krankheit
- 2.2. Definition Stress und Stressor
- 2.3. Die Folgen von Stress
- 3. Arbeitsstressmodelle
- 3.1. Zur Bedeutung der Erwerbsarbeit
- 3.2. Arbeitsvertrag und Psychologischer Vertrag
- 3.3. Das Anforderungs-Kontroll-Modell
- 3.4. Das Modell der beruflichen Gratifikationskrise
- 3.4.1. Modellaussage
- 3.4.2. Drei Transmittersysteme der Belohnung
- 3.4.3. Extrinsische und Intrinsische Verausgabung
- 3.4.4. Empirische Evidenz
- 4. Das System Bildung
- 4.1. Definition Bildung
- 4.2. Bildung in Deutschland
- 4.3. Bildung und sozialer Status
- 4.3.1. Zur Problematik der Begriffsabgrenzung
- 4.3.2. Zusammenhang sozialer Status und Gesundheit
- 4.3.3. Bildung und Beruf
- 4.4. Bildung und Gesundheit
- 4.4.1. Zusammenhang Bildung und Gesundheit
- 4.4.2. Bildung als Gesundheitsressource
- 5. Zusammenfassung und Fragestellung
- 6. Empirie
- 6.1. Die Stichprobe
- 6.2. Datengrundlage
- 6.3. Das Analyseverfahren
- 6.4. Die Ergebnisse
- 6.4.1. Demographische Merkmale
- 6.4.2. Berufliche Situation
- 6.4.3. Gesundheit
- 6.5. Die Berechnung des ERI-Quotienten
- 6.5.1. Die Verausgabungsskala
- 6.5.2. Die Belohnungsskala
- 6.5.3. Der Verausgabungs-Belohnungs-Quotient
- 6.6. Diskussion der Ergebnisse
- 7. Ausblick und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Einfluss von Bildung auf die Gesundheit, fokussiert auf das Modell der beruflichen Gratifikationskrise. Die Arbeit zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, beruflicher Situation und Gesundheit zu analysieren und zu beleuchten, inwieweit Bildung als Gesundheitsressource betrachtet werden kann.
- Der Einfluss von Stress auf die Gesundheit
- Das Modell der beruflichen Gratifikationskrise und seine Anwendbarkeit
- Der Zusammenhang zwischen Bildung, sozialem Status und Gesundheit
- Bildung als Schutzfaktor und Ressource für die Gesundheit
- Empirische Überprüfung der Zusammenhänge anhand einer Stichprobe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, beschreibt die Problemstellung und die Forschungsfrage. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext von gesellschaftlichen Herausforderungen und der Bedeutung von Bildung und Gesundheit herausgestellt. Die Vorgehensweise der Arbeit wird skizziert, um dem Leser einen klaren Überblick über die methodischen Ansätze zu geben. Die Einleitung legt den Grundstein für die folgende detaillierte Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Bildung und Gesundheit.
2. Stresstheoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen der Arbeit. Es definiert die zentralen Begriffe Gesundheit, Krankheit, Stress und Stressor und beleuchtet die Folgen von Stress. Verschiedene Stressmodelle werden vorgestellt und diskutiert, um das Verständnis für die komplexen Zusammenhänge zwischen Stress und Gesundheit zu fördern. Dieses Kapitel dient als Grundlage für die spätere Anwendung des Modells der beruflichen Gratifikationskrise.
3. Arbeitsstressmodelle: Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die Darstellung verschiedener Arbeitsstressmodelle, insbesondere das Anforderungs-Kontroll-Modell und das Modell der beruflichen Gratifikationskrise. Es wird detailliert auf die einzelnen Komponenten dieser Modelle eingegangen, um deren Bedeutung für die spätere empirische Untersuchung zu verdeutlichen. Die Ausführungen zu den Modellen werden mit empirischen Befunden untermauert und in ihren Anwendungsbezügen erklärt. Die Kapitel legt die theoretische Basis für die Analyse der Daten im empirischen Teil der Arbeit.
4. Das System Bildung: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit dem System Bildung. Es definiert den Begriff Bildung und beleuchtet die Rolle der Bildung in Deutschland, insbesondere im Hinblick auf den Zusammenhang mit sozialem Status und Gesundheit. Es wird auf die Problematik der Begriffsabgrenzung eingegangen und der Zusammenhang zwischen Bildung, Beruf und Gesundheit detailliert analysiert. Dieses Kapitel schafft den Kontext für das Verständnis der Rolle von Bildung im Hinblick auf die Gesundheit.
6. Empirie: Dieses Kapitel präsentiert die empirische Untersuchung. Es beschreibt die Stichprobe, die Datengrundlage und die verwendeten Analyseverfahren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden detailliert dargestellt und kommentiert. Es werden verschiedene demografische Merkmale, berufliche Situationen und Gesundheitsdaten berücksichtigt, um einen umfassenden Überblick zu gewährleisten. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf den Forschungsfrage interpretiert, jedoch werden zentrale Schlussfolgerungen dem Ausblick vorbehalten.
Schlüsselwörter
Bildung, Gesundheit, Stress, berufliche Gratifikationskrise, Anforderungs-Kontroll-Modell, sozialer Status, Gesundheitsressourcen, empirische Forschung, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Einfluss von Bildung auf die Gesundheit
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Einfluss von Bildung auf die Gesundheit, wobei der Fokus auf dem Modell der beruflichen Gratifikationskrise liegt. Analysiert wird der Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, beruflicher Situation und Gesundheit, und es wird beleuchtet, inwieweit Bildung als Gesundheitsressource betrachtet werden kann.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Der Einfluss von Stress auf die Gesundheit, das Modell der beruflichen Gratifikationskrise und seine Anwendbarkeit, der Zusammenhang zwischen Bildung, sozialem Status und Gesundheit, Bildung als Schutzfaktor und Ressource für die Gesundheit sowie die empirische Überprüfung dieser Zusammenhänge anhand einer Stichprobe.
Welche Modelle werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet das Anforderungs-Kontroll-Modell und vor allem das Modell der beruflichen Gratifikationskrise zur Analyse des Zusammenhangs zwischen Arbeit, Stress und Gesundheit. Diese Modelle werden detailliert erläutert und ihre Anwendbarkeit im Kontext der Forschungsfrage diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (Problemstellung, Zielsetzung, Vorgehensweise), Stresstheoretischer Hintergrund (Definitionen, Folgen von Stress), Arbeitsstressmodelle (Anforderungs-Kontroll-Modell, Modell der beruflichen Gratifikationskrise), Das System Bildung (Definition, Bildung in Deutschland, Bildung und sozialer Status, Bildung und Gesundheit), Zusammenfassung und Fragestellung, Empirie (Stichprobe, Datengrundlage, Analyseverfahren, Ergebnisse, Diskussion) und Ausblick und Schluss.
Welche Methoden werden in der empirischen Untersuchung eingesetzt?
Der empirische Teil der Arbeit beschreibt die Stichprobe, die Datengrundlage und die verwendeten Analyseverfahren. Es werden demografische Merkmale, berufliche Situationen und Gesundheitsdaten berücksichtigt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfrage interpretiert, wobei die Berechnung des ERI-Quotienten eine zentrale Rolle spielt (mit Verausgabungs- und Belohnungsskala).
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Bildung, Gesundheit, Stress, berufliche Gratifikationskrise, Anforderungs-Kontroll-Modell, sozialer Status, Gesundheitsressourcen, empirische Forschung und Deutschland.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Konkrete Schlussfolgerungen werden im Ausblick und Schluss gezogen. Der empirische Teil liefert Daten zur Interpretation, jedoch werden zentrale Schlussfolgerungen dem Ausblick vorbehalten.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit untersucht?
Der Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit wird auf mehreren Ebenen untersucht: durch die theoretische Einbettung in Stressmodelle, die Analyse des Einflusses des sozialen Status und durch eine empirische Untersuchung, die den Zusammenhang zwischen Bildungsniveau, beruflicher Situation und Gesundheit quantifiziert.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit den Themen Bildung, Gesundheit, Stress und Arbeitsbedingungen auseinandersetzen. Sie kann auch für Personen im Gesundheitswesen, in der Bildungspolitik und in der Arbeitsforschung von Interesse sein.
Wo kann man die vollständige Arbeit einsehen?
Die vollständige Magisterarbeit ist nicht in diesem FAQ enthalten. Dieses Dokument bietet lediglich eine Zusammenfassung des Inhalts.
- Quote paper
- Julia Gretz (Author), 2012, Bildung und Gesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273727