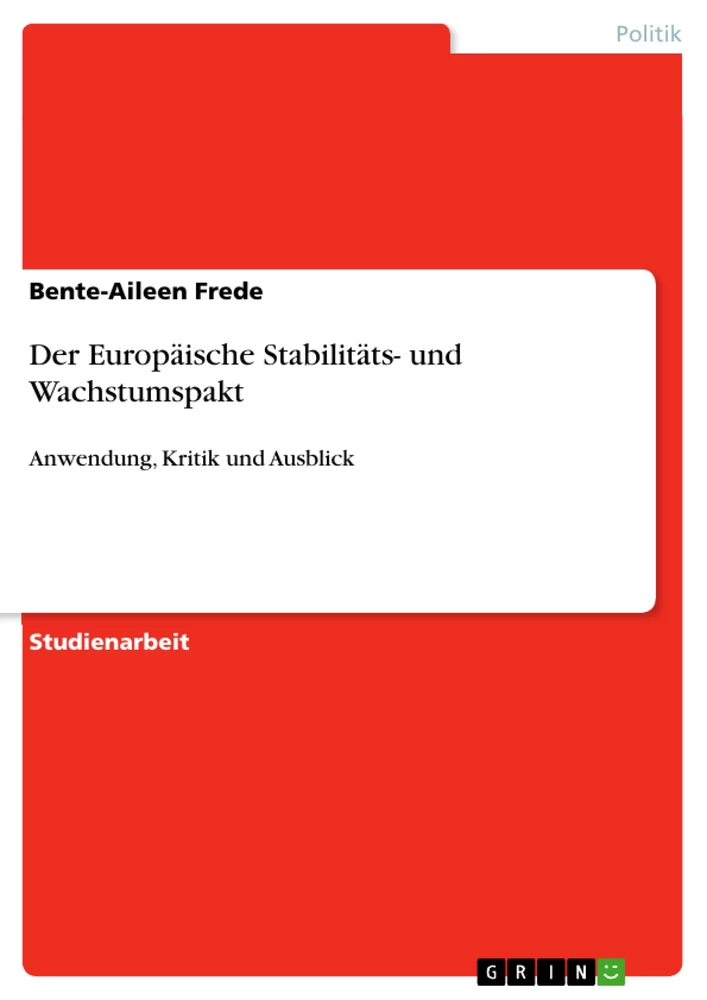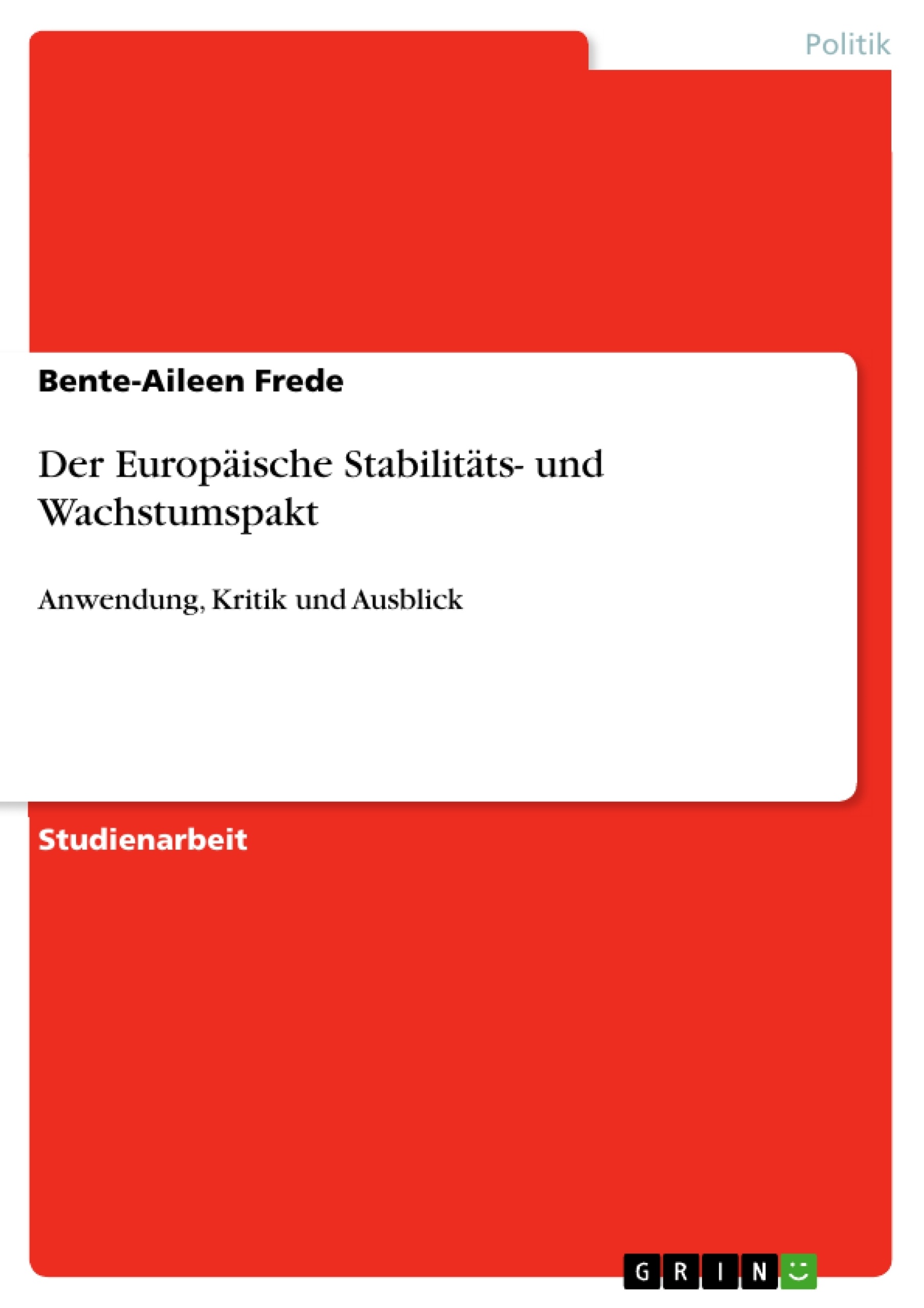Die Europäische Integration ist ein voranschreitendes, Ländergrenzen überschreitendes Großprojekt der Europäischen Union mit der Zielsetzung, in allen Mitgliedsstaaten den Euro einzuführen. Bisher (Stand 2013) haben 17 Länder ihre Währung durch den Euro ersetzt, der die Handlungsbedingungen im Europäischen Wirtschaftsbereich erleichtern und durch eine hohe Preisstabilität eine Stabilität des Marktes gewährleisten soll. Die Schaffung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) auf Grundlage eines dreistufigen Programmes im Jahre 1990 stellte die Basis, der Vertrag von Maastricht die ersten EU-vertraglich festgehalte-nen Kriterien, dessen Einhaltung den Eintritt in die EU gewähren sollten. Genau unter diesen sogenannten Konvergenzkriterien befinden sich zwei, welche weiterführend defizitäre Haus-halte innerhalb der Europäischen Union (EU) identifizierbar machen; ein Defizit von 3% oder mehr des Bruttoinlandprodukts (BIP), sowie eine Staatsverschuldung von über 60% des BIP.(...)
Die folgende Hausarbeit hat sich mit dem Thema der Entwicklung des ESWP in den Jahren von 1992, dem Vertrag von Maastricht, bis zu der Reform des „Sixpack“ 2011 beschäftigt. Diese Auseinandersetzung nimmt besonderen Bezug auf die Umsetzung der Theorie in die Praxis in Form der „Nichtbeistands-Klausel“ und den Hilfsmaßnahmen für Griechenland. Eine zentrale Rolle dabei spielt die Zukunft des ESWP. Kann eine stärkere Regelbindung helfen, zukünftige Krisen zu vermeiden? Oder muss der allgemeine Disziplinierungseffekt infrage gestellt werden, was zur Konsequenz hätte, dass der ESWP letztendlich kein geeignetes Instrumentarium wäre? Ralf Rotte und Sascha Derichs (2005) stellen die These auf, dass die Krise des ESWP ebenso sein Ende sei und zugleich eine Krise des europäischen Integrati-onsprozesses darstelle. Bereits 5 Jahre später spricht Daniela Schwarzer über ein „Versagen der wirtschafts- und fiskalpolitischen Überwachung“ . Die wirtschaftliche Relevanz kann an dieser Stelle gleich der Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion, der Eurozone und somit dem gesellschaftlichen Zusammenleben in der EU gesetzt werden.(...)
Wichtig zu erwähnen scheint an dieser Stelle, dass sich die rechtlichen Grundlagen in den alten Artikel 104 EGV und des Artikels 126 AEUV überschneiden, durch die Literatur in erster Linie aber über erstgenannten berichtet wird.
Inhaltsverzeichnis
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- EINLEITUNG
- DEFIZITÄRE HAUSHALTE
- GRUNDSTEINLEGUNG IM VERTRAG VON MAASTRICHT 1992
- PROTOKOLL 13: DIE KONVERGENZKRITERIEN IM VERTRAG VON MAASTRICHT
- DER STABILITÄTS- UND WACHSTUMSPAKT
- ZIELE DES SWP: THEO WAIGELS „DEUTSCHE STABILITÄTSKULTUR"
- DIE INSTRUMENTARIEN DES ESWP ZUR HAUSHALTSÜBERWACHUNG
- „FRÜHWARNSYSTEM"
- „ÜBERWACHUNG DES NATIONALEN HAUSHALTSPROGRAMMS"
- „VERFAHREN BEI ÜBERMÄßIGEN DEFIZIT"
- SANKTIONSMECHANISMEN
- DER ECOFIN-RAT
- KRISE UND NEUINTERPRETATION 2005
- DER STABILITÄTSPAKT NACH LISSABON
- NO-BAIL OUT KLAUSEL
- GRIECHISCHE STAATSSCHULDENKRISE 2010 UND DER EFSF
- EFSF, EFSM UND ESM
- „SIXPACK"- REFORM 2011
- FAZIT
- ANHANG
- TAB 1
- ABB. 1
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Entwicklung des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumpaktes (ESWP) von 1992 bis 2011, mit besonderem Fokus auf die Umsetzung der Theorie in der Praxis. Die Arbeit untersucht die „Nichtbeistands-Klausel" und die Hilfsmaßnahmen für Griechenland im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ein zentrales Thema ist die Zukunft des ESWP und die Frage, ob eine stärkere Regelbindung zukünftige Krisen verhindern kann oder ob der allgemeine Disziplinierungseffekt in Frage gestellt werden muss.
- Die Entstehung des ESWP im Kontext der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU)
- Die Ziele und Instrumente des ESWP zur Haushaltsüberwachung
- Die Krise des ESWP und die Neuinterpretation im Jahr 2005
- Die Auswirkungen des Lissabonner Vertrags auf den ESWP
- Die griechische Staatsschuldenkrise und die Rolle des ESWP
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Europäische Integration und die Entstehung des ESWP. Sie erläutert die Konvergenzkriterien des Vertrags von Maastricht und die Notwendigkeit eines Mechanismus zur Sanktionierung von Staaten bei einer defizitären Haushaltspolitik. Das zweite Kapitel beleuchtet die Motivation von Staaten, ein hohes Maß an Staatsverschuldung anzustreben und die Risikopotentiale, die mit einer Staatsverschuldung unter der Bedingung einer Währungsunion einhergehen.
Kapitel drei widmet sich dem ESWP und seinen Zielen. Die Arbeit analysiert die „deutsche Stabilitätskultur" und die Instrumente des Paktes zur Haushaltsüberwachung, einschließlich des Frühwarnsystems, der Überwachung des nationalen Haushaltsprogramms, des Verfahrens bei übermäßigen Defiziten und der Sanktionsmechanismen. Die Rolle des EcoFin-Rats als Schlüsselorgan der europäischen Wirtschaftspolitik wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel vier befasst sich mit der Krise des ESWP und der Neuinterpretation im Jahr 2005. Die Arbeit untersucht die Kritik am Pakt und die Gründe für die Reform. Die wichtigsten Punkte der Reform werden dargestellt, einschließlich der stärkeren Berücksichtigung individueller Schuldenstände und länderspezifischer Gegebenheiten.
Kapitel fünf analysiert die Auswirkungen des Lissabonner Vertrags auf den ESWP. Die Arbeit beleuchtet die Stärkung der Europäischen Kommission und die Erweiterung der Möglichkeiten der gemeinsamen Beschlussfassung im Euroraum. Die No-Bail Out-Klausel und ihre Bedeutung für die europäische Finanzpolitik werden ebenfalls diskutiert.
Kapitel sechs befasst sich mit der griechischen Staatsschuldenkrise und der Rolle des ESWP. Die Arbeit untersucht die Ursachen der Krise und die Reaktion der Europäischen Union, einschließlich der Einführung des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM) und der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF). Die Entwicklung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und die „Sixpack"-Reform von 2011 werden ebenfalls analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt (ESWP), die Konvergenzkriterien, die Haushaltsüberwachung, die Defizitverfahren, die Sanktionsmechanismen, die griechische Staatsschuldenkrise, die No-Bail Out-Klausel, der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM), die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM). Der Text beleuchtet die Herausforderungen der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWWU) und die Frage, ob der ESWP ein geeignetes Instrumentarium zur Bewältigung zukünftiger Krisen ist.
- Quote paper
- Bente-Aileen Frede (Author), 2014, Der Europäische Stabilitäts- und Wachstumspakt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273672