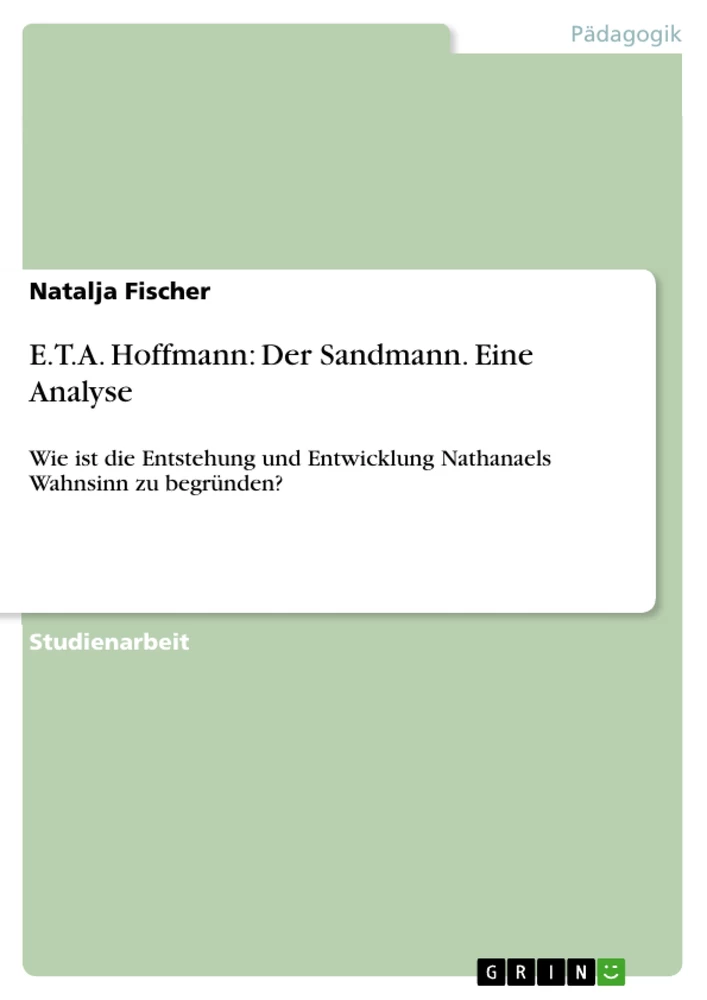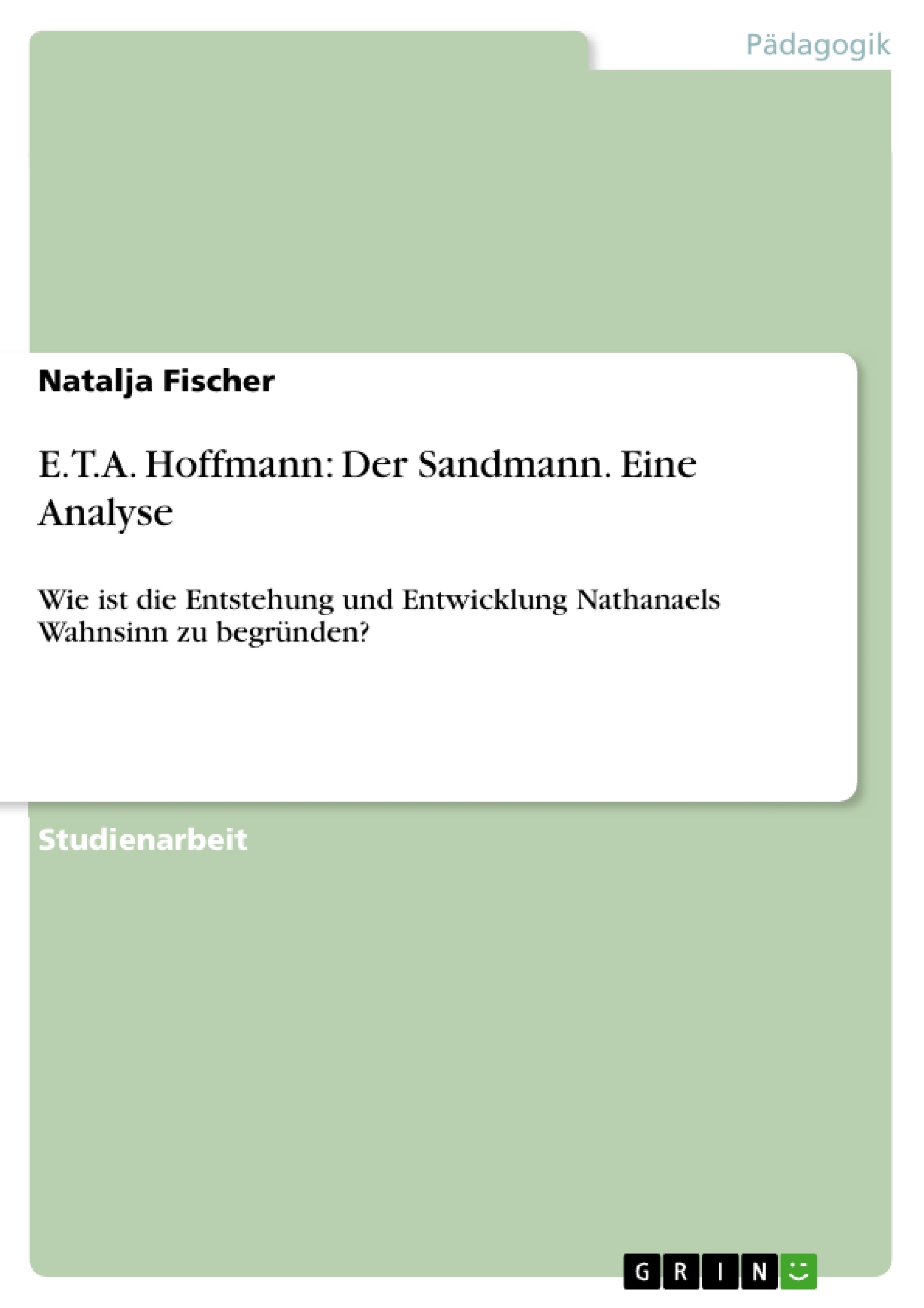E.T.A Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann" erschien 1816 im ersten Teil der Sammlung seiner sogenannten Nachtstücke. Die Geschichte, die vom verhängnisvollen Leben des Protagonisten Nathanael erzählt, blieb zu Lebzeiten des Autors zunächst weitgehend unbeachtet. Erst die Studie Siegmund Freuds über "Das Unheimliche" verhalf dem Schauermärchen zu Anfang des 20. Jahrhunderts zu größerer Aufmerksamkeit und veranlasste Autoren verschiedener Fachrichtungen zu neuen Interpretationen. Freud hatte anhand des Nathanael die exemplarische Entwicklung einer psychischen Krankheit aufgezeigt. Dies verwundert zunächst, da zur Zeit der Entstehung des Sandmanns die Begründung der Psychoanalyse noch weit entfernt war. Wie konnte Hoffmann also den Verlauf einer psychischen Krankheit so beispielhaft darstellen, dass Freud daran 70 Jahre später seine Theorien aufzeigen konnte? Woher hatte Hoffmann das nötige Wissen? Ein kurzer Blick auf seine Biografie gibt Aufschluss: Hoffmann, der seine kreativen Fähigkeiten als Komponist, Zeichner und Dichter vorwiegend nachts auslebte, war tagsüber als Jurist tätig. Er eignete sich durch Studien der damaligen Fachliteratur umfassende Kenntnisse über die menschliche Psyche an. Auf diese konnte er sich bei der Erstellungen von Gutachten über die Zurechnungsfähigkeit von Straftätern berufen. Sein Wissen über „Genese, Symptome und Therapie des Wahnsinns“ fügte er im Sandmann zu einer unheimlichen Erzählung zusammen.
Diese Arbeit soll sich auf genau diesen psychoanalytischen Aspekt konzentrieren und den fortschreitenden Realitätsverlust des Protagonisten analysieren: Es soll die Frage beantwortet werden, wie die Entstehung und Entwicklung Nathanaels Wahn zu erklären ist. Im Zuge einer allgemeinen Einführung ist es zunächst erforderlich den Inhalt der Erzählung wiederzugeben. Daraufhin soll eine Analyse der Figur Nathanaels, sowie jener Figuren gegeben werden, die in Zusammenhang mit seiner Krankheit von Bedeutung sind. Anhand der Figuren lassen sich bereits einige Faktoren erkennen, die seinen Wahn auslösten, begünstigten oder verstärkten. Auf dieser Grundlage kann dann dazu übergegangen werden, die komplexere Theorie Freuds vorzustellen. Diese kann als Ergänzung für die bis dahin gefundene Erklärung aufgefasst werden. Schlussendlich soll im Fazit eine allübergreifende Beurteilung zusammenfassen, wie es zu Nathanaels tragischem Schicksal kam.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einführung in die Erzählung
- Figurenanalyse
- Nathanael
- Clara
- Olimpia
- Coppelius/ Coppola
- Freuds Interpretation
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ aus psychoanalytischer Perspektive. Sie befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Wahnsinns des Protagonisten Nathanael und untersucht, welche Faktoren zu seinem tragischen Schicksal führten. Die Arbeit bezieht sich dabei auf die psychoanalytischen Theorien von Sigmund Freud und analysiert die Figuren und Ereignisse der Erzählung im Kontext dieser Theorien.
- Die romantische Geisteshaltung Nathanaels als Grundlage für seine Psychose
- Die Rolle des Ödipuskomplexes und der Kastrationsangst in Nathanaels Entwicklung
- Die Bedeutung der Vaterfigur und deren Ambivalenz in der Erzählung
- Die Funktion von Olimpia als Projektionsfläche für Nathanaels Selbstliebe
- Die Vermischung von Realität und Fantasie und die Entstehung des Verfolgungswahns
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext der Erzählung „Der Sandmann“ beleuchtet und die Forschungsfrage formuliert: Wie ist die Entstehung und Entwicklung von Nathanaels Wahnsinn zu begründen?
Im zweiten Kapitel wird eine Einführung in die Erzählung gegeben. Es wird die multiperspektivische Erzählstruktur und die Vermischung von Realität und Einbildung beschrieben. Die Arbeit stellt die zentralen Ereignisse der Erzählung dar, beginnend mit Nathanaels Brief an seinen Freund Lothar, in dem er von der Begegnung mit dem Wetterglashändler Coppola berichtet. In diesem Brief schildert Nathanael auch seine Kindheitserinnerungen an den „Sandmann“ und die Begegnung mit Coppelius, den er mit der Fabelgestalt des Sandmanns identifiziert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Figurenanalyse. Es werden die Figuren Nathanael, Clara, Olimpia und Coppelius/ Coppola im Detail betrachtet und deren Funktion im Zusammenhang mit Nathanaels Krankheit analysiert. Nathanael wird als ein romantischer, empfindsamer Charakter dargestellt, der zu einem übersteigerten Subjektivismus neigt. Clara verkörpert hingegen die Vernunft und versucht, Nathanael mit rationalen Argumenten von seinen Ängsten zu befreien. Olimpia ist eine von Spalanzani und Coppola geschaffene Holzpuppe, in die sich Nathanael verliebt. Die Figur der Olimpia ist als Kritik an Nathanaels romantischen Subjektivismus zu verstehen, da er die Puppe als Projektionsfläche für sein eigenes Ich benutzt. Coppelius/ Coppola ist die Schreckensgestalt, die Nathanaels Kindheitserinnerungen und Ängste wiedererweckt.
Im vierten Kapitel wird Freuds Interpretation der Erzählung vorgestellt. Freud analysiert den Zusammenhang zwischen der Angst vor Augenverlust und der Kastrationsangst. Er bezieht sich dabei auf den Ödipuskomplex und die Ambivalenz der Vaterfigur in Nathanaels Leben. Freud argumentiert, dass Nathanaels Wahnsinn in einem kindlichen Kastrationskomplex begründet ist, der durch die Wiedererinnerung an die Kindheitserfahrungen mit Coppelius/ Coppola wiederbelebt wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den „Sandmann“, E.T.A. Hoffmann, psychoanalytische Literaturtheorie, Wahnsinn, Nathanael, Ödipuskomplex, Kastrationsangst, Vaterfigur, Olimpia, Coppelius/ Coppola, romantische Geisteshaltung, Realität und Fantasie, Verfolgungswahn.
- Quote paper
- Natalja Fischer (Author), 2011, E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann. Eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273510