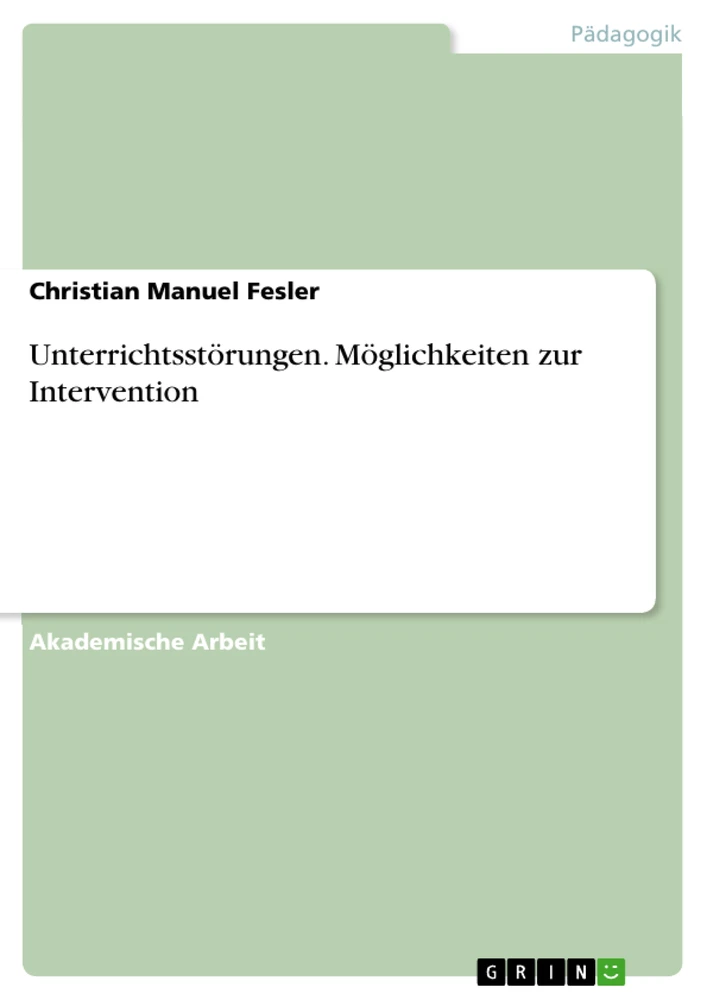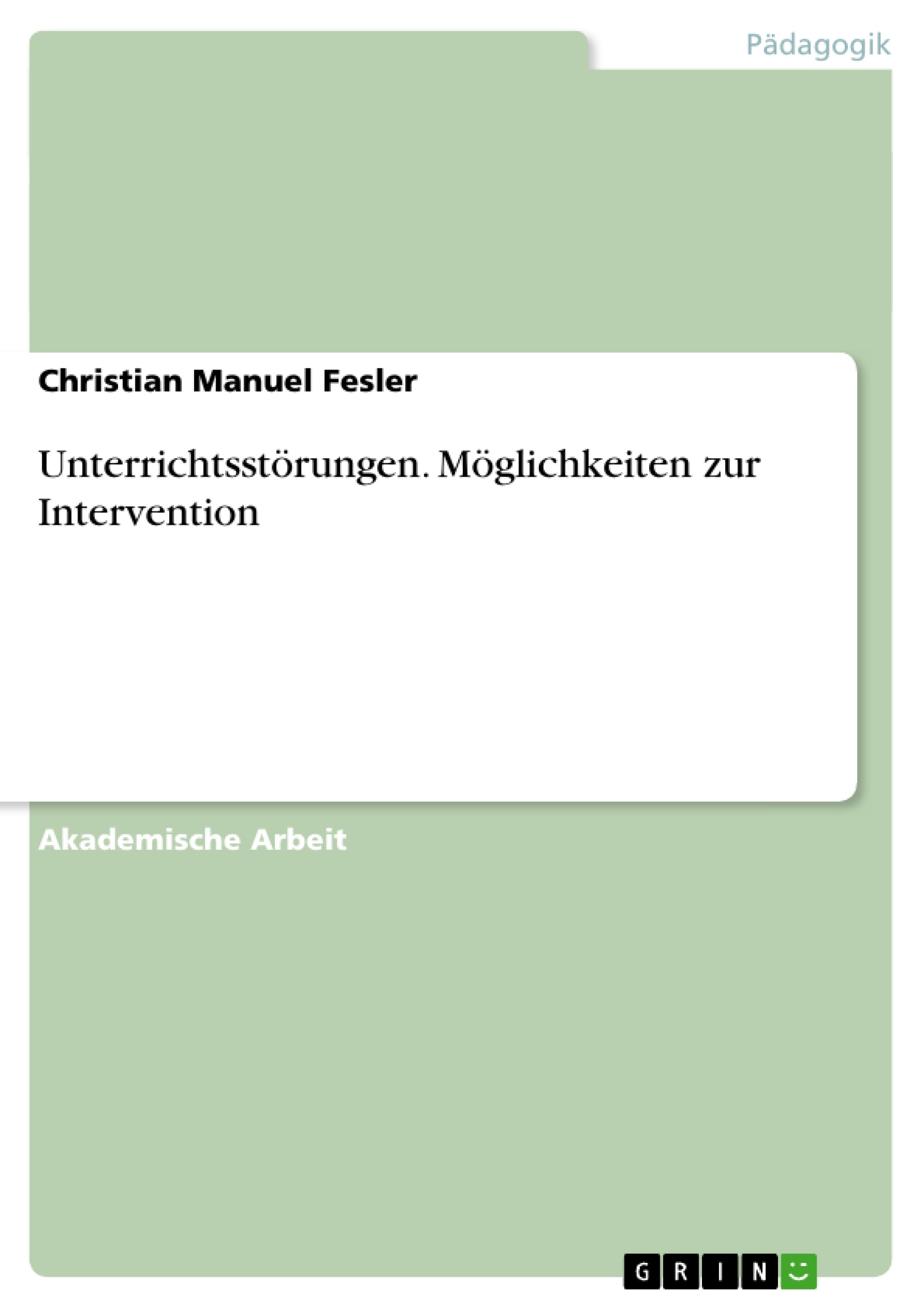„Störungsfreier Unterricht ist eine didaktische Fiktion“ (Lohmann 2003, S. 13). Diese These berücksichtigend beschäftigt sich diese Arbeit mit der Konfliktbewältigung, d.h. präventive Maßnahmen waren entweder nicht möglich, wurden nicht eingesetzt oder verfehlten ihre Wirkung: eine Störung des Unterrichts, die nicht ignoriert oder durch nonverbale Maßnahmen gelöst werden kann, tritt auf. Neben einer schwerwiegenden Störung können auch kleinere Konflikte Grund zur massiven Intervention geben, sofern sie wiederkehren.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen drei Möglichkeiten des Einschreitens dargestellt werden: die lehrerzentrierte und die kooperative Intervention sowie institutionelle Maßnahmen, die anhand der Beispiele „Meditation“ und „Arizona“-Projekt bzw. „Trainingsraumprogramm“ anschaulich gemacht werden. Obwohl u.a. durch KOUNINS Forschungen bestätigt wurde, dass die Störungsprävention wichtiger als die eigentliche Störungsbewältigung ist, gibt es im Bereich der Intervention gewisse Vorgehensweisen, die Störungen in der Schulklasse wirkungsvoller und dauerhafter abstellen als andere. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Einschätzung der Störung, der Unterrichtssituation, während der die Störung auftritt oder auch dem Führungsstil und Charakter des Lehrers.
Eines der Hauptprobleme ist, dass der Lehrer durch die aufgetretene Störung emotional tangiert wird und sich in seiner Reaktion auf den Störer Gefühle wie Wut, Entrüstung oder Enttäuschung widerspiegeln (Lohmann 2003, S. 151). Aggressives Ermahnen, Drohen und Strafen sind die meistgebrauchten und zumeist ineffektivsten Methoden der Intervention. Kurzfristig mögen die Maßnahmen eine Störung abstellen, auf längere Sicht vergiften sie jedoch das Lehrer-Schüler-Verhältnis und verbauen gleichzeitig die Sicht auf langfristig wirksamere Methoden. Es ist zwar verständlich, dass Lehrer emotional reagieren – dennoch ist es nicht professionell. Gerade in solchen Situationen sollte der Lehrer nicht als Privatmensch, sondern als „pädagogischer Profi“ handeln. In diesem Fall würde das bedeuten, sowohl emotional Abstand zum Vorfall zu gewinnen als auch sachlich und angemessen zu reagieren (vgl. Nolting 2002, S. 74f.). Eine praktische Konsequenz wäre, dass der Lehrer nach einer Störung und bevor er reagiert eine bestimmte Zeit „durchatmet“, ein Fenster öffnet oder – was allerdings nicht die Regel sein sollte – kurz den Raum verlässt...
Inhaltsverzeichnis
- Störungsintervention
- Lehrerzentrierte Intervention
- Reaktionen im akuten Konflikt
- Strafen
- Veränderungsstrategien
- Problemdiagnose
- Kooperative Intervention
- Konstruktives Konfliktgespräch nach Gordon (Lehrer-Schüler-Konferenz)
- Kooperative Verhaltensmodifikation im Unterricht
- Organisatorische Maßnahmen der Schule zur Störungsintervention
- Mediation
- Die Trainingsraum-Methode
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht verschiedene Interventionsmöglichkeiten bei Unterrichtsstörungen. Ziel ist es, Lehrerinnen und Lehrern handlungsspezifische Strategien zur effektiven und nachhaltigen Konfliktbewältigung aufzuzeigen. Dabei wird zwischen lehrerzentrierten, kooperativen und institutionellen Maßnahmen unterschieden.
- Lehrerzentrierte Interventionsmethoden
- Kooperative Konfliktlösungsansätze
- Institutionelle Maßnahmen zur Störungsbewältigung
- Bedeutung der emotionalen Regulation bei Lehrkräften
- Vergleich verschiedener Interventionsstrategien
Zusammenfassung der Kapitel
Störungsintervention: Der einleitende Abschnitt stellt die Prämisse auf, dass störungsfreier Unterricht eine Illusion ist. Er betont die Notwendigkeit von Interventionsstrategien bei auftretenden Störungen, fokussiert auf lehrerzentrierte und kooperative Methoden sowie institutionelle Maßnahmen wie Mediation und das Trainingsraumprogramm. Die Bedeutung der emotionalen Distanzierung des Lehrers bei der Reaktion auf Störungen wird hervorgehoben, um unwirksame, emotional getriebene Reaktionen zu vermeiden und langfristig erfolgreiche Strategien zu ermöglichen. Der Abschnitt führt die zentrale Problematik ein: die Notwendigkeit effektiver Methoden der Störungsbewältigung, im Gegensatz zu kurzfristigen, oft ineffektiven Maßnahmen.
Lehrerzentrierte Intervention: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene lehrerzentrierte Interventionsansätze. Es beginnt mit einfachen Maßnahmen wie höflichen Aufforderungen und der Betonung eines gleichberechtigten Gesprächs zwischen Lehrer und Schüler. Die Wichtigkeit der positiven Verstärkung von erwünschtem Verhalten wird betont, im Gegensatz zur oft übermäßigen Fokussierung auf Fehlverhalten. Für schwerwiegendere Störungen werden Methoden der Situationsklärung und Emotionsausdruck erläutert, mit der Warnung vor Pauschalisierungen und dem Appell, kontextbezogene Lösungsansätze zu berücksichtigen. Die Verwendung von Ich-Botschaften durch den Lehrer wird als hilfreiches Werkzeug empfohlen, um Gefühle zu vermitteln und Kritik sachlich zu formulieren, ohne die Persönlichkeit des Schülers anzugreifen.
Schlüsselwörter
Unterrichtsstörungen, Interventionsstrategien, Lehrerzentrierte Intervention, Kooperative Intervention, Konfliktlösung, Emotionsregulation, Mediation, Trainingsraum-Methode, Schülerverhalten, pädagogische Professionalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Interventionsmöglichkeiten bei Unterrichtsstörungen"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Interventionsmöglichkeiten bei Unterrichtsstörungen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf lehrerzentrierten, kooperativen und institutionellen Maßnahmen zur Konfliktbewältigung im Unterricht.
Welche Interventionsmethoden werden behandelt?
Das Dokument behandelt verschiedene Interventionsmethoden, darunter lehrerzentrierte Ansätze (höfliche Aufforderungen, positive Verstärkung, Situationsklärung, Ich-Botschaften), kooperative Ansätze (Konstruktives Konfliktgespräch nach Gordon, kooperative Verhaltensmodifikation) und institutionelle Maßnahmen (Mediation, Trainingsraum-Methode).
Was ist das Ziel des Dokuments?
Ziel ist es, Lehrerinnen und Lehrern handlungsspezifische Strategien zur effektiven und nachhaltigen Konfliktbewältigung aufzuzeigen. Es soll ihnen helfen, mit Unterrichtsstörungen konstruktiv umzugehen und langfristig erfolgreiche Strategien zu entwickeln.
Welche Arten von Interventionen werden unterschieden?
Es wird zwischen lehrerzentrierten, kooperativen und institutionellen Interventionsmaßnahmen unterschieden. Lehrerzentrierte Interventionen fokussieren auf die Rolle des Lehrers bei der Konfliktlösung, kooperative Interventionen betonen die Zusammenarbeit zwischen Lehrer und Schüler, und institutionelle Maßnahmen beziehen die Schule als Organisation mit ein.
Wie wird mit lehrerzentrierten Interventionen umgegangen?
Lehrerzentrierte Interventionen werden detailliert beschrieben, von einfachen Maßnahmen wie höflichen Aufforderungen bis hin zu Methoden der Situationsklärung und des Emotionsausdrucks. Die Bedeutung der positiven Verstärkung und die Vermeidung von Pauschalisierungen werden betont. Die Verwendung von Ich-Botschaften wird als hilfreiches Werkzeug empfohlen.
Welche Rolle spielt die Emotionsregulation?
Die Bedeutung der emotionalen Regulation bei Lehrkräften wird hervorgehoben. Es wird darauf hingewiesen, dass emotionale Distanzierung bei der Reaktion auf Störungen wichtig ist, um unwirksame, emotional getriebene Reaktionen zu vermeiden.
Welche kooperativen Interventionsansätze werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt das konstruktive Konfliktgespräch nach Gordon (Lehrer-Schüler-Konferenz) und die kooperative Verhaltensmodifikation im Unterricht als Beispiele für kooperative Interventionsansätze.
Welche institutionellen Maßnahmen werden erwähnt?
Als institutionelle Maßnahmen werden Mediation und die Trainingsraum-Methode vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Unterrichtsstörungen, Interventionsstrategien, Lehrerzentrierte Intervention, Kooperative Intervention, Konfliktlösung, Emotionsregulation, Mediation, Trainingsraum-Methode, Schülerverhalten, pädagogische Professionalität.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Eine Zusammenfassung der Kapitel "Störungsintervention" und "Lehrerzentrierte Intervention" ist im Dokument enthalten. Diese geben einen kurzen Überblick über die jeweiligen Inhalte und Kernaussagen.
- Quote paper
- Christian Manuel Fesler (Author), 2006, Unterrichtsstörungen. Möglichkeiten zur Intervention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273391