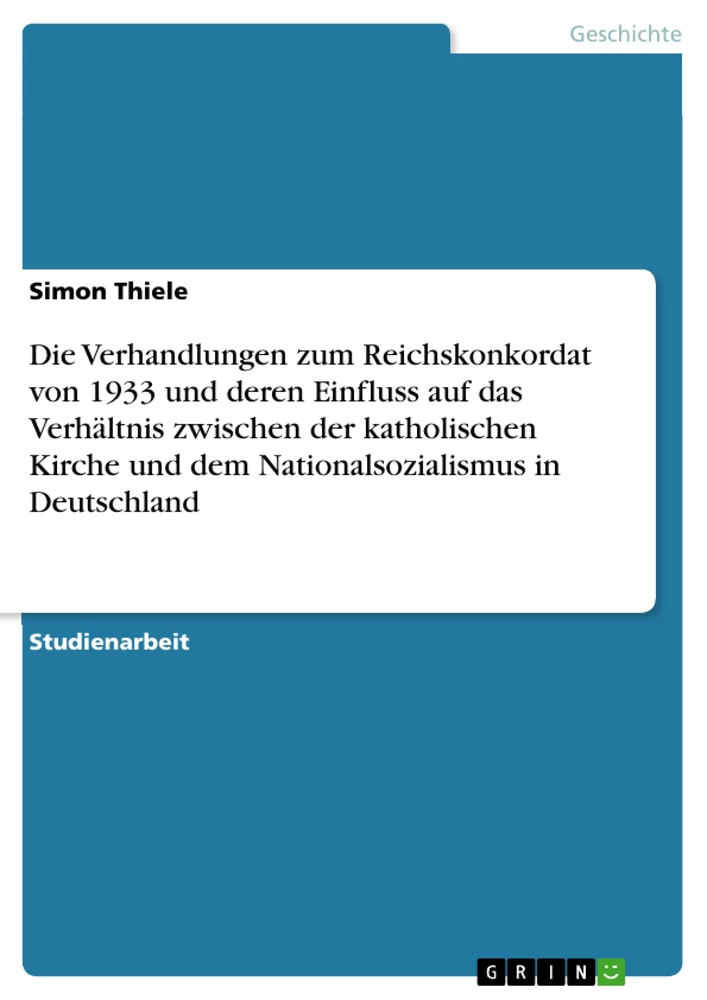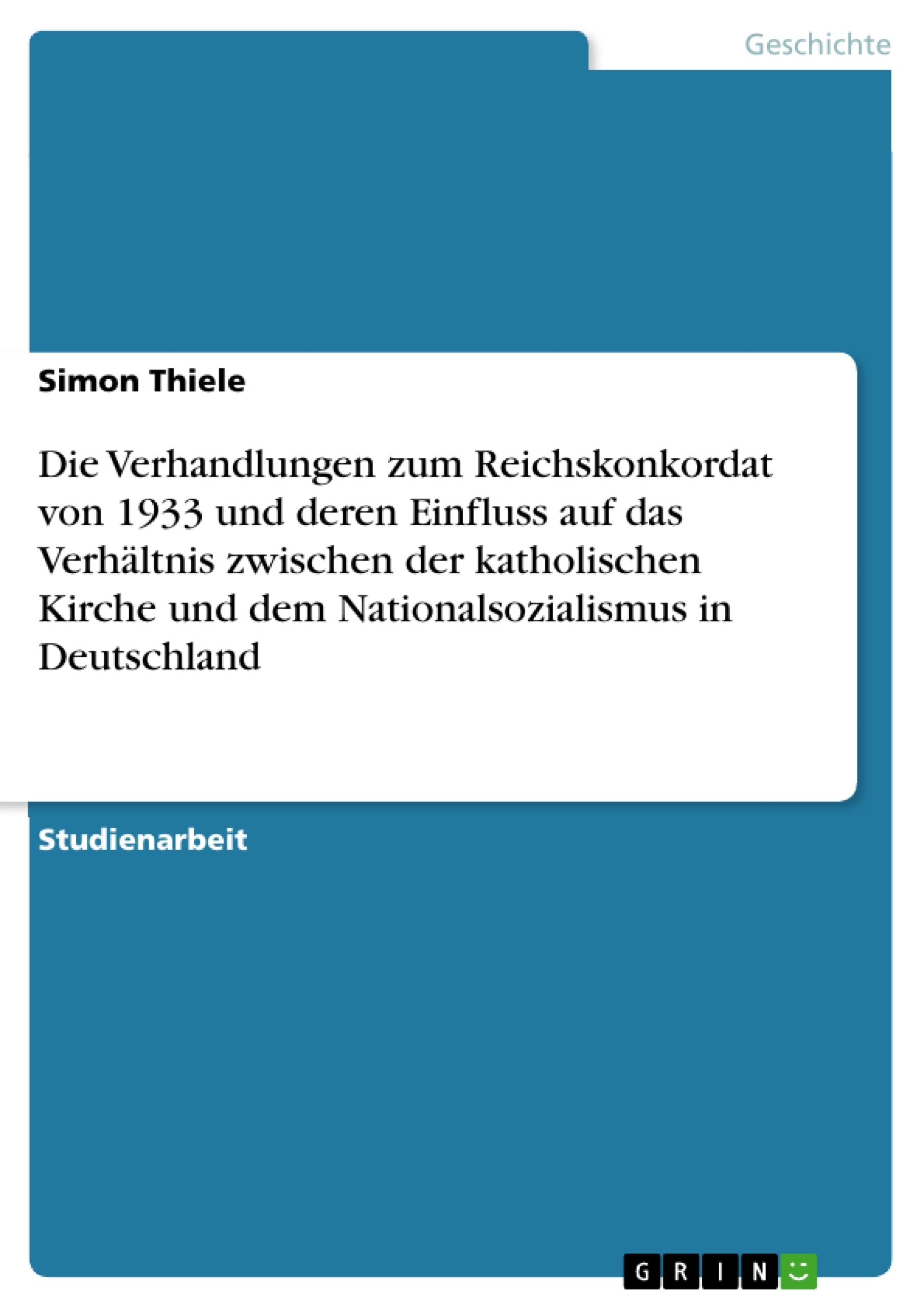Die Beziehung zwischen der katholischen Kirche in Deutschland und dem nationalsozialistischen Regime ist ein viel beachtetes Thema in der historischen wie auch der theologischen Forschung. Im Zentrum steht dabei häufig die Frage, inwieweit die katholische Kirche Widerstand gegen das Hitler-Regime leistete, oder ob sie sich vielmehr um bestmögliche Anpassung bemühte, um nicht im radikalen Mühlstein der Gewalt, Gleichschaltung, Unterdrückung und Vernichtung dieser zwölf beispiellosen Jahre der NS-Diktatur zermahlen zu werden. Für solche Untersuchungen ist eine Pauschalisierung der „katholischen Kirche“ auf die Gesamtheit der katholischen Gläubigen in Deutschland in der Regel ungeeignet, da es sich hierbei um eine sehr große und ideologisch heterogene Gruppe an Menschen handelt, die lediglich in ihrem Glauben auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Die Forschung zeigt, dass innerhalb dieser großen Gruppe verschiedene ideologische Standpunkte vertreten wurden, die eine einheitliche Haltung der Gläubigen gegenüber der neuen Obrigkeit ausschloss. So verdeutlicht etwa Roland WEIS in seinem Buch über die katholische Kirche Baden-Württembergs im Nationalsozialismus , dass es auf den unterschiedlichen Ebenen der katholischen Hierarchie sowohl unter den einfachen katholischen Dorfpfarrern als auch unter den hochangesehenen Kardinälen und Bischöfen verschiedene Haltungen gegenüber dem Nationalsozialismus gegeben habe, die zu individuell unterschiedlichen Handlungen führten. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die katholische Kirche mit ihrer großen Mitgliederzahl in Deutschland eine einflussreiche Institution darstellte, die Hitler auf seinem Weg zur Diktatur nicht ohne weiteres ignorieren oder gar ausschalten konnte. Vielmehr war er darauf angewiesen, einen Weg zu finden, die Anhänger der katholischen Kirche in Deutschland für seine Ziele zu gewinnen oder zumindest nicht geschlossen gegen sich zu haben. Ein Hindernis stellte dabei der politische Katholizismus dar, der im Zuge von Hitlers Errichtung eines Einparteienstaates beseitigt werden musste. Im Unterschied zum Umgang mit den anderen Parteien in Deutschland, wie etwa den Kommunisten und Sozialdemokraten, wählte Hitler bei den katholischen Parteien nicht hauptsächlich den Weg der gewaltsamen Einschüchterung und Diffamierung, sondern forcierte unter der Federführung von Vizekanzler Franz von Papen eine diplomatische Lösung mit dem Heiligen Stuhl in Rom – das sogenannte Reichskonkordat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zögerliche Annäherungsversuche als Basis für die Konkordatsverhandlungen
- Die erste Verhandlungsrunde
- Der Untergang der Zentrumspartei
- Der Vertragsschluss
- Der Artikel 31 zum Schutz katholischer Vereine greift ins Leere
- Zusammenfassung
- Quellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Verhandlungen zum Reichskonkordat von 1933 zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl in Rom. Sie analysiert die einzelnen Etappen des Zustandekommens dieses Vertragswerkes und untersucht, inwieweit die Verhandlungen selbst sowie der Inhalt des Konkordats zu einer Veränderung des Kräfteverhältnisses zwischen Hitlers Machtapparat und der katholischen Kirche in Deutschland geführt haben. Dabei wird auch die Frage beleuchtet, inwiefern es Hitler gelungen ist, der katholischen Kirche, einer potentiell gefährlichen Widerstandsgruppe, den Wind aus den Segeln zu nehmen.
- Die Entwicklung der katholischen Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus
- Die Rolle des Heiligen Stuhls in den Verhandlungen
- Der Einfluss des Reichskonkordats auf die katholische Kirche in Deutschland
- Die Bedeutung des Entpolitisierungsartikels und des Artikels 31 zum Schutz katholischer Vereine
- Die Folgen des Konkordats für die katholische Kirche und das nationalsozialistische Regime
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen der katholischen Kirche in Deutschland und dem nationalsozialistischen Regime, insbesondere die Frage, inwieweit die Kirche Widerstand leistete oder sich anpasste. Die Autorin betont die Heterogenität der katholischen Gruppe und die verschiedenen ideologischen Standpunkte innerhalb der Kirche. Sie erklärt, warum Hitler ein Konkordat mit dem Heiligen Stuhl anstrebte, um den politischen Katholizismus zu beseitigen.
Zögerliche Annäherungsversuche als Basis für die Konkordatsverhandlungen
Die Arbeit beschreibt die anfänglich ablehnende Haltung der katholischen Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus, die jedoch im Zuge der zunehmenden Macht der NSDAP erste Risse zeigte. Sie analysiert die unterschiedlichen Positionen innerhalb des Episkopats und die Herausforderungen, die die katholische Kirche in dieser Zeit durchlebte. Die Autorin zeigt, wie die Kirche sich durch die Wahl Hitlers zum Reichskanzler und den Erlass des Ermächtigungsgesetzes gezwungen sah, ihre Haltung zu überdenken.
Die erste Verhandlungsrunde
Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Papen und Hitler als Initiatoren der Konkordatsverhandlungen, die sich am italienischen Konkordat orientierten. Die Autorin zeigt auf, wie Hitler die Vernichtung des politischen Katholizismus als Voraussetzung für die Sicherung seiner Macht sah. Sie beschreibt die ersten Verhandlungen zwischen von Papen und Pacelli, die mit einem ersten Entwurf des Konkordats endeten. Die Autorin diskutiert die Rolle des Heiligen Stuhls und die Bedeutung des Entpolitisierungsartikels.
Der Untergang der Zentrumspartei
Die Arbeit beschreibt den Niedergang der Zentrumspartei, die sich im Zuge der Verhandlungen zum Reichskonkordat zunehmend unter Druck sah. Sie analysiert die Rolle von Kaas, dem Vorsitzenden der Zentrumspartei, und die mangelnde Kommunikation zwischen Episkopat, Zentrum und Rom. Die Autorin zeigt, wie die Partei schließlich am 5. Juli 1933 aufgelöst wurde, was Hitlers Ziel der Beseitigung des politischen Katholizismus erfüllte.
Der Vertragsschluss
Die Arbeit beschreibt die entscheidende Phase der Konkordatsverhandlungen im Juni 1933, in der von Papen einen Entwurf mit Hitlers gewünschtem Wortlaut für den Entpolitisierungsartikel vorlegte. Die Autorin zeigt, wie Pius XI. den Vertrag unter der Bedingung der Wiedergutmachung der Gewalttaten in Deutschland paraphierte. Sie erläutert die Hinhaltetaktik Hitlers, der eine breite Rückendeckung für das Konkordat benötigte. Schließlich wurde der Vertrag am 20. Juli 1933 in Rom unterzeichnet.
Der Artikel 31 zum Schutz katholischer Vereine greift ins Leere
Die Arbeit beleuchtet die Sonderrolle, die die katholische Kirche durch das Reichskonkordat im NS-Staat erhielt, und die Schwierigkeiten, die sich im Zuge der Auslegung des Artikels 31 zum Schutz katholischer Vereine ergaben. Die Autorin beschreibt, wie das NS-Regime den Vereinsschutzartikel durch Druck und Eingriffe untergrub und die wichtigsten katholischen Verbände zur Auflösung und Gleichschaltung zwang.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Reichskonkordat, die katholische Kirche, den Nationalsozialismus, den politischen Katholizismus, die Zentrumspartei, den Heiligen Stuhl, die Gleichschaltung, den Vereinsschutz und die Sonderrolle der katholischen Kirche im NS-Staat. Die Arbeit analysiert die Verhandlungen zum Reichskonkordat, die Rolle der katholischen Kirche im NS-Staat und die Auswirkungen des Konkordats auf die katholische Kirche und das nationalsozialistische Regime.
- Quote paper
- Simon Thiele (Author), 2014, Die Verhandlungen zum Reichskonkordat von 1933 und deren Einfluss auf das Verhältnis zwischen der katholischen Kirche und dem Nationalsozialismus in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273374