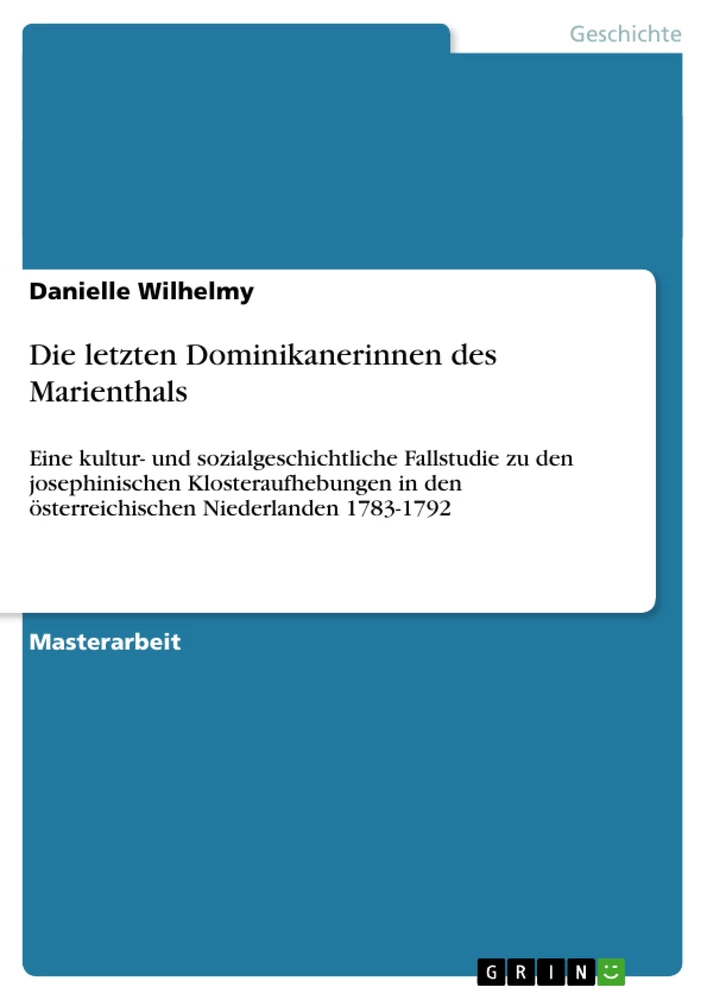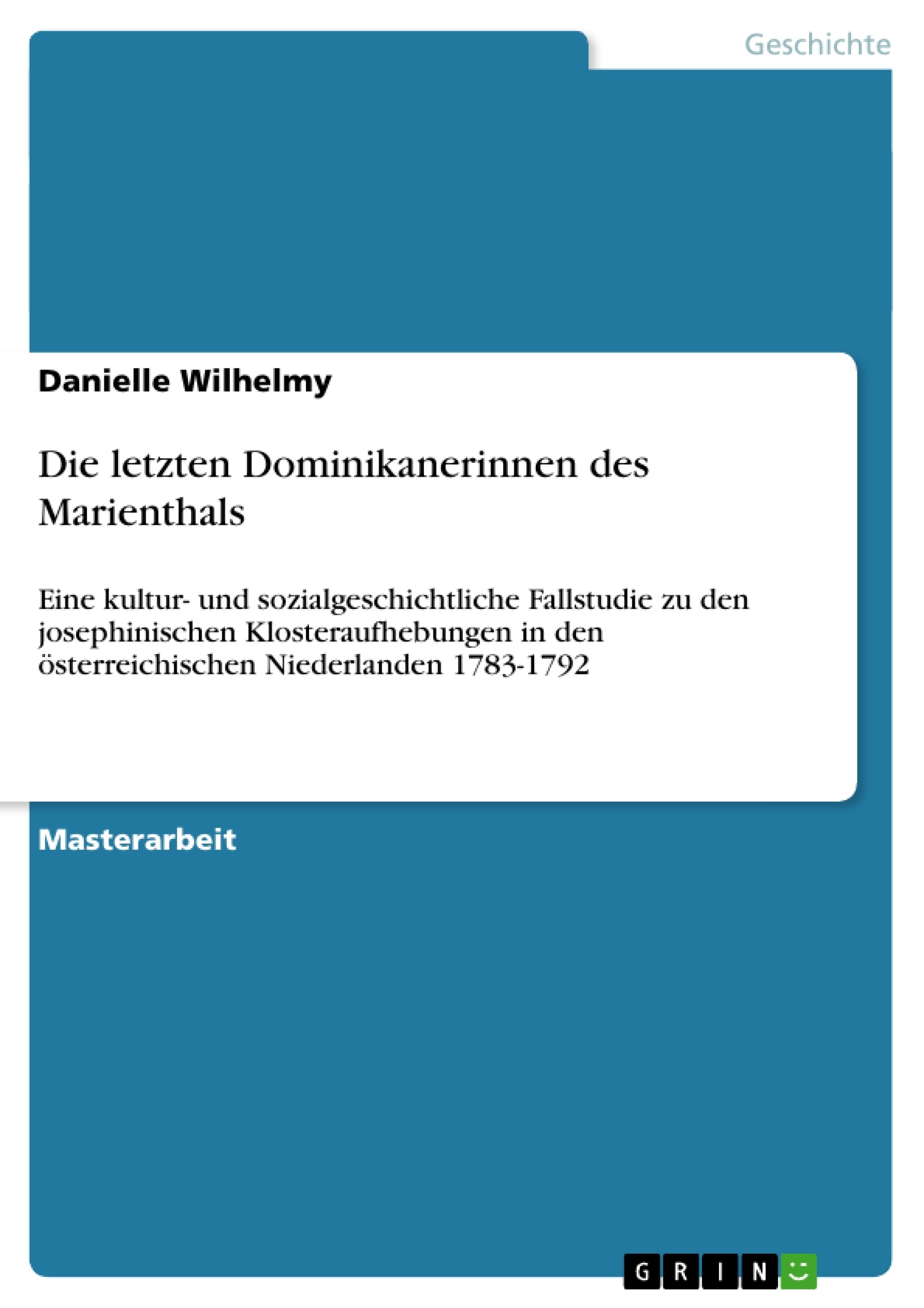Die Restaurierung des Gutes Marienthal durch den Service national de la Jeunesse rief ein erneutes Interesse an der Aufarbeitung der Geschichte des bereits im Jahre 1231 dort bezeugten Klosters auf. Nachdem bei früheren Forschungen besonders das mittelalterliche Frauenkloster unter der Leitung Yolandas, oder auch unter jener ihrer Mutter Marguerite Gräfin von Vianden und Namur, im Mittelpunkt standen und die Geschichte der dort von 1890 bis 1974 angesiedelten Weissen Väter aufgearbeitet wurde, soll in dieser Untersuchung
die 1783 erfolgte Aufhebung des Dominikanerinnenkonvents beleuchtet werden.
Dreizehn Jahre vor der eigentlichen Säkularisation der Klöster des ehemaligen Herzogtums Luxemburg unter dem französischen Directoire 1796, fanden zeitgleich zu den Klosteraufhebungen in den deutschen Vorlanden auf Anordnung des Kaisers Joseph II. Auflösungen von Konventen in sämtlichen österreichischen Erbländern statt. Diese trafen auch die vom Statthalterpaar Herzog Albert von Sachsen-Teschen und dessen Frau, Josephs Schwester Marie-Christine, gouvernierten österreichischen Niederlande, zu denen die
damals 9.185 km2 große Provinz „Herzogtum Luxemburg und Grafschaft Chiny“ gehörte. [...]
Laut der die österreichischen Vorlande untersuchenden Studie Ute Ströbeles erfuhren vor allem die Frauenkommunitäten tiefgreifende Veränderungen. Dies begründet sie vor allem durch die stark reglementierende Klosterpolitik Josephs II. die mit dessen Aufhebungen einherging.
Die vorliegende Arbeit soll als kultur- und sozialgeschichtliche Fallstudie zur Erhellung der bisher kaum untersuchten Frage der Auswirkungen der josephinischen Klosterpolitik auf weibliche Konvente und der nachklösterlichen Existenz der Ordensschwestern beitragen. Wer waren die letzten Dominikanerinnen des Marienthals und wie wirkte sich die Liquidierung ihres Konvents auf die Gestaltung ihres religiösen und nachklösterlichen Lebens aus? Gleichzeitig soll hier auch dem Schicksal anderer Klosterbewohner auf den Grund gegangen werden, um ein kompletteres Bild der Aufhebung und deren Implikationen zu erhalten. Da bis dato keine vergleichbare Studie zu einem österreichisch-niederländischen Frauenkloster existiert, dient Ute Ströbeles oben erwähnte Dissertation als Grundlage und Vergleichsmaterial. Aufgrund der spärlichen Forschungslage basiert die vorliegende Arbeit
überwiegend auf der Auswertung des in den Archives nationales du Luxembourg aufbewahrten Quellenmaterials. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Fragestellung
- Literatur- und Forschungsüberblick
- Quellen
- Marienthal am Vorabend seiner Aufhebung: Ein prosopographischer Überblick
- Die Nonnen und ihre Funktionen
- Altersdurchschnitt und Gesundheitszustand
- Herkunft
- Weitere Klosterbewohner
- Der Aufhebungsakt und seine Folgen für das klösterliche Leben bis zum endgültigen Austreten der Nonnen (26. April - 30. Juni 1783)
- Administrativer Hintergrund der Klosteraufhebung: der Religionsfonds
- Die Enteignung der Klosterfrauen
- Die Entmündigung der Klosterfrauen
- Die nachklösterlichen Existenzen der Marienthaler Ex-Religiosen
- Die Wahl ihrer nachklösterlichen Lebensform
- Die Wahl ihres nachklösterlichen Aufenthaltsorts
- Der endgültige Auszug aus dem Kloster
- Ein ärmliches Leben unter staatlicher Obhut
- Die nachklösterlichen Existenzen der anderen Klosterbewohner
- Die Novizin Magdelaine Keffeler
- Die Pensionärin Thérése de Keiffen
- Die Vikare Jacques Ketter und Antoine Beck
- Die drei Hausangestellten
- Das Marienthal nach dem Auszug der Dominikanerinnen
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen der josephinischen Klosteraufhebungen auf das Dominikanerinnenkloster Marienthal in den österreichischen Niederlanden zwischen 1783 und 1792. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Lebensgeschichte der letzten Marienthaler Dominikanerinnen zu rekonstruieren und die Folgen der Säkularisation für ihren weiteren Lebensweg zu beleuchten. Darüber hinaus wird das Schicksal anderer Klosterbewohner, die nicht im Aufhebungsedikt berücksichtigt wurden, beleuchtet, um ein umfassenderes Bild der Aufhebung und ihrer Implikationen zu zeichnen.
- Die prosopographische Zusammensetzung des Klosters Marienthal am Vorabend der Aufhebung
- Der administrative Hintergrund der josephinischen Klosteraufhebungen und die Rolle des Religionsfonds
- Die Enteignung und Entmündigung der Klosterfrauen im Zuge der Aufhebung
- Die Gestaltung der nachklösterlichen Existenz der Marienthaler Ex-Religiosen
- Die nachklösterliche Existenz der anderen Klosterbewohner, insbesondere der Novizin, der Pensionärin und der Vikare
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird ein prosopographischer Überblick über die Zusammensetzung des Marienthals am Vorabend seiner Aufhebung gegeben. Die Untersuchung beleuchtet die Funktion der Chorfrauen und Konversen im Klosteralltag und analysiert die Altersstruktur sowie die geografische Herkunft der Klosterinsassen.
Kapitel 2 beleuchtet den administrativen Hintergrund der josephinischen Klosteraufhebungen. Es wird die Rolle des Religionsfonds erläutert und die Enteignung sowie Entmündigung der Marienthaler Klosterfrauen im Zuge des Aufhebungsakts beschrieben.
Kapitel 3 widmet sich der nachklösterlichen Existenz der Marienthaler Ex-Dominikanerinnen. Es wird untersucht, welche Möglichkeiten die Nonnen zur Gestaltung ihres weiteren Lebensweges hatten und welche Faktoren ihre Wahl des nachklösterlichen Aufenthaltsorts beeinflussten. Zudem wird die rechtliche und finanzielle Situation der Ex-Religiosen im Kontext der staatlichen Reglementierung beleuchtet.
Kapitel 4 behandelt die nachklösterliche Existenz der anderen Klosterbewohner. Es wird das Schicksal der Novizin Magdelaine Keffeler, der Pensionärin Thérése de Keiffen sowie der Vikare Jacques Ketter und Antoine Beck beleuchtet.
Kapitel 5 gibt einen Überblick über die weitere Nutzung des Klostergebäudes nach dem Auszug der Dominikanerinnen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die josephinischen Klosteraufhebungen, das Dominikanerinnenkloster Marienthal, die österreichischen Niederlande, die Enteignung und Entmündigung von Klosterfrauen, die nachklösterliche Existenz der Ex-Religiosen, die Rolle des Religionsfonds und die Auswirkungen der Säkularisation auf das Leben der Klosterbewohner.
- Quote paper
- Danielle Wilhelmy (Author), 2012, Die letzten Dominikanerinnen des Marienthals, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273345