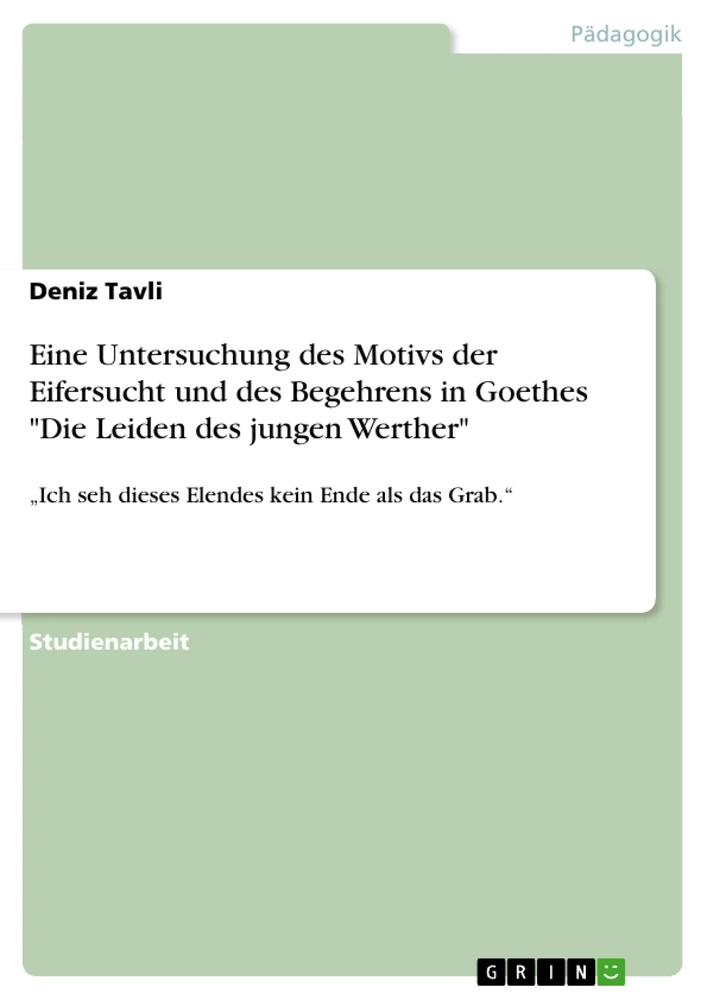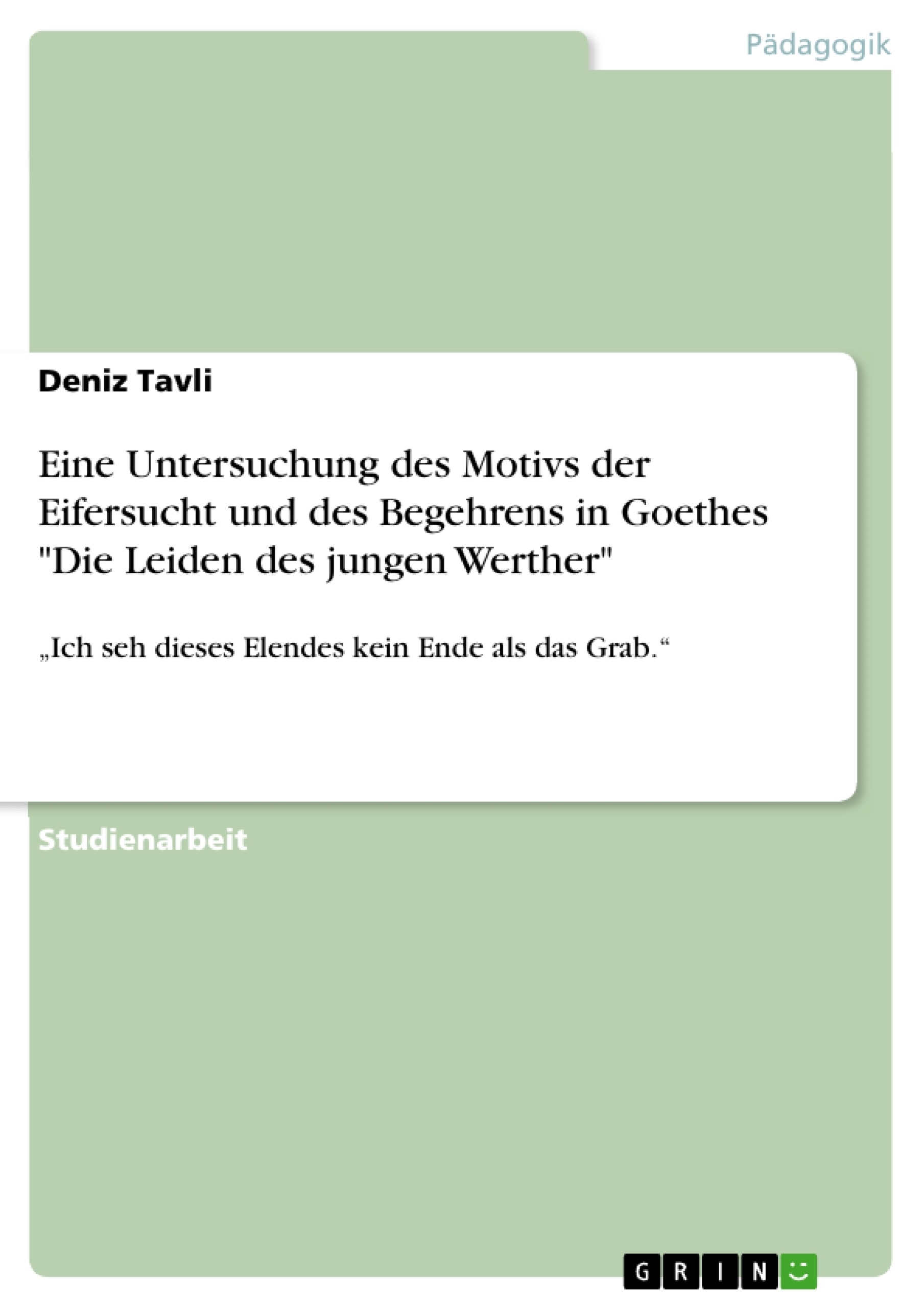„Musste denn das so sein, dass das, was des Menschen Glückseligkeit macht, wieder die Quelle seines Elendes würde?“ Diese Frage stellt Werther in dem Brief an seinen Freund Wilhelm vom 18. August. Es ist die Frage, die sich nicht nur jeder Philosoph, sondern auch - und insbesondere - jeder Liebende einmal stellen muss. In dem Briefroman Goethes wird allerdings keine befriedigende Antwort auf diese Frage des Protagonisten gegeben. Er beantwortet sie sich selbst, dem Liebeswahn verfallen und entschlossen diesem endgültig nachzugeben: „Ich seh dieses Elendes kein Ende als das Grab.“
Woraus besteht dieses Elend? Wie entstehen „Werthers Leiden“? Ist es seine Liebe zu Lotte? Oder ist es die Eifersucht zu Albert, der „ihm das Mädchen wegnimmt“?
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit eben diesen Fragen, die schließlich alle auf eine große, übergeordnete Frage abzielen: Was bewog Werther letztendlich den fatalen Schritt zum Selbstmord zu machen?
Dass diese Frage bereits auf verschiedenste Weise anhand zahlreicher Theorien und Modellen interpretiert worden ist, steht außer Frage. Doch statt mich einer platten Wiederholung dieser Auslegungen des Werther zu bedienen, möchte ich in dieser Arbeit anhand Roland Barthes Fragmente einer Sprache Liebe und René Girards Modell des „>Triangulären< Begehrens“ die jeweiligen Beziehungen zwischen Lotte, Werther und Albert untersuchen und beweisen, dass die alleinige Eifersucht auf das Verhalten von Werther nicht zutrifft und somit schon einmal als Grund für seinen Suizid ausscheidet.
Der Selbstmord wird hier thematisiert, da er unmittelbar mit der Eifersucht, mit der unerfüllten Liebe und dem unglücklich Liebenden verwoben ist. Er ist die totale Konsequenz der Eifersucht im Sinne des Liebeswahns und des Neides eines Verstoßenen gegenüber allen, die einen passenden Platz in einem gesellschaftlichen System gefunden haben.
Wer der Eifersüchtige in Werthers Leiden ist, welche Rollen die Hauptakteure des
Briefromans annehmen und eine weitere Erklärung für Werthers Resignation am Leben und an der Liebe soll auf den folgenden Seiten geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Werther- der verzweifelt Suchende
- Werther- der hoffnungsvolle Verliebte
- Werther, Lotte und Albert- das >trianguläre< Begehren oder „Zeigt mir, wen ich begehren soll“
- Lotte und Werther- kein spontanes Begehren
- Albert und Werther- Nachahmung als Rivalitätsäußerung
- Werther- der abwesende Dritte
- „Ich sehe wohl, dass wir nicht zu retten sind.“ - Rollenwechsel und Identifizierung
- Lotte und Albert- von außen verbunden
- Werther, der Bauernbursche, der Narr - die Überzähligen
- „Ich seh dieses Elendes kein Ende als das Grab.“ - Werthers Suizid oder Die Chronik eines angekündigten Freitodes
- Der Verlauf von Werthers Freitod
- „Warum weckst du mich, Frühlingsluft?“ - Werthers letzte Begegnung mit Lotte
- Fazit-Zusammenfassung des Motivs der Eifersucht in Die Leiden des jungen Werther
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen für Werthers Selbstmord in Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Sie hinterfragt die gängigen Interpretationen und analysiert die Beziehungen zwischen Werther, Lotte und Albert unter Anwendung von Theorien von Roland Barthes und René Girard. Das Ziel ist es, die Rolle der Eifersucht im Kontext des Liebeswahns und der gesellschaftlichen Ausgrenzung zu beleuchten und zu zeigen, dass sie nicht alleiniger Grund für Werthers tragischen Entschluss war.
- Analyse von Werthers Charakter und seiner Suche nach Sinn im Leben
- Untersuchung des „triangulären Begehrens“ zwischen Werther, Lotte und Albert
- Die Rolle der Eifersucht und des Liebeswahns in Werthers Leiden
- Werthers gesellschaftliche Ausgrenzung und seine daraus resultierende Resignation
- Interpretation von Werthers Selbstmord als Konsequenz seiner Lebenserkenntnis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Ursachen für Werthers Selbstmord. Sie positioniert die Arbeit im Kontext bestehender Interpretationen und kündigt die Anwendung der Theorien von Barthes und Girard an. Die Einleitung skizziert den Fokus auf die Beziehungen zwischen den Hauptfiguren und die kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Eifersucht.
Werther- der verzweifelt Suchende: Dieses Kapitel beleuchtet Werthers Charakter vor seiner Begegnung mit Lotte. Seine Briefe an Wilhelm zeigen ihn als einen jungen Mann, der sich von einer unbefriedigenden Situation entfernt hat und in einem Zustand der Sinnlosigkeit und des Schwebezustandes verweilt. Die scheinbare Heiterkeit wird als Ausdruck einer tiefen Sehnsucht nach Sinn und Zugehörigkeit interpretiert, gestützt durch Barthes' Theorie der Begierde als Erwartung. Werthers Introspektion und die Erschaffung einer inneren Welt werden als Reaktion auf die Erkenntnis der Sinnlosigkeit des Lebens dargestellt.
Werther- der hoffnungsvolle Verliebte: (Anmerkung: Kapitel 2 fehlt im bereitgestellten Text und muss aus dem vollständigen Text hinzugefügt werden.)
Werther, Lotte und Albert- das >trianguläre< Begehren oder „Zeigt mir, wen ich begehren soll“: Dieses Kapitel untersucht die Dreiecksbeziehung zwischen Werther, Lotte und Albert unter Einbezug von René Girards Theorie des „triangulären Begehrens“. Die einzelnen Unterkapitel analysieren die Dynamiken zwischen den Paaren und die Rolle Werthers als „abwesender Dritter“. Es wird hinterfragt, ob das Begehren spontan ist oder durch Nachahmung und Rivalität beeinflusst wird.
„Ich sehe wohl, dass wir nicht zu retten sind.“ - Rollenwechsel und Identifizierung: Dieses Kapitel analysiert die Rollen der Hauptfiguren und deren wechselseitige Wahrnehmung. Die Unterkapitel befassen sich mit der Verbindung von Lotte und Albert und Werthers Position als Außenseiter, der sich als Bauernsjunge oder Narr wahrgenommen fühlt. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Ausgrenzung und dem Gefühl der Überflüssigkeit.
„Ich seh dieses Elendes kein Ende als das Grab.“ - Werthers Suizid oder Die Chronik eines angekündigten Freitodes: Dieses Kapitel befasst sich mit den Umständen und der Bedeutung von Werthers Selbstmord. Es analysiert den Verlauf seines Freitodes und seine letzte Begegnung mit Lotte. Die Kapitel untersuchen den Selbstmord als Konsequenz aus seinen vorangegangenen Erfahrungen und seiner existenziellen Krise.
Schlüsselwörter
Die Leiden des jungen Werther, Eifersucht, Liebeswahn, Trianguläres Begehren, Selbstmord, Sinnlosigkeit, Gesellschaftliche Ausgrenzung, Roland Barthes, René Girard, Introspektion, Existenzielle Krise.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Die Leiden des jungen Werther"
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet eine umfassende Übersicht über eine akademische Arbeit, die sich mit den Ursachen von Werthers Selbstmord in Goethes "Die Leiden des jungen Werther" auseinandersetzt. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Analyse stützt sich auf Theorien von Roland Barthes und René Girard und untersucht die Rolle der Eifersucht, des Liebeswahns und der gesellschaftlichen Ausgrenzung im Kontext von Werthers tragischem Entschluss.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht Werthers Charakter, seine Suche nach Sinn, die Dreiecksbeziehung zwischen Werther, Lotte und Albert (das „trianguläre Begehren“), die Rolle der Eifersucht und des Liebeswahns, Werthers gesellschaftliche Ausgrenzung und seine Resignation, und schließlich seinen Selbstmord als Konsequenz seiner Lebenserkenntnis. Die Analyse bezieht die Theorien von Barthes und Girard mit ein.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit nutzt die Theorien von Roland Barthes (insbesondere seine Theorie der Begierde) und René Girard (seine Theorie des „triangulären Begehrens“) zur Analyse der Beziehungen zwischen den Hauptfiguren und der Entstehung von Werthers Leiden und Selbstmord.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz definiert. Es folgen Kapitel, die Werther als verzweifelten Suchenden und hoffnungsvollen Verliebten beschreiben, die Dreiecksbeziehung zwischen Werther, Lotte und Albert analysieren, die Rollen der Figuren und deren wechselseitige Wahrnehmung untersuchen und schließlich Werthers Selbstmord im Detail beleuchten. Ein Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Die Leiden des jungen Werther, Eifersucht, Liebeswahn, Trianguläres Begehren, Selbstmord, Sinnlosigkeit, Gesellschaftliche Ausgrenzung, Roland Barthes, René Girard, Introspektion, Existenzielle Krise.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Die Datei enthält Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung und die Kapitel über Werther als verzweifelten Suchenden, das „trianguläre Begehren“, die Rollenwechsel und Identifizierung, und Werthers Selbstmord. Eine Zusammenfassung für das Kapitel über Werther als hoffnungsvollen Verliebten fehlt im bereitgestellten Text.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist die nach den Ursachen für Werthers Selbstmord. Die Arbeit hinterfragt dabei gängige Interpretationen und untersucht, inwieweit Eifersucht, Liebeswahn und gesellschaftliche Ausgrenzung dazu beigetragen haben.
Ist die Eifersucht der alleinige Grund für Werthers Selbstmord?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass die Eifersucht nicht der alleinige Grund für Werthers Selbstmord ist, sondern vielmehr ein Faktor innerhalb eines komplexeren Geflechts aus Sinnlosigkeit, gesellschaftlicher Ausgrenzung und existenzieller Krise.
- Quote paper
- Deniz Tavli (Author), 2007, Eine Untersuchung des Motivs der Eifersucht und des Begehrens in Goethes "Die Leiden des jungen Werther", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/273189