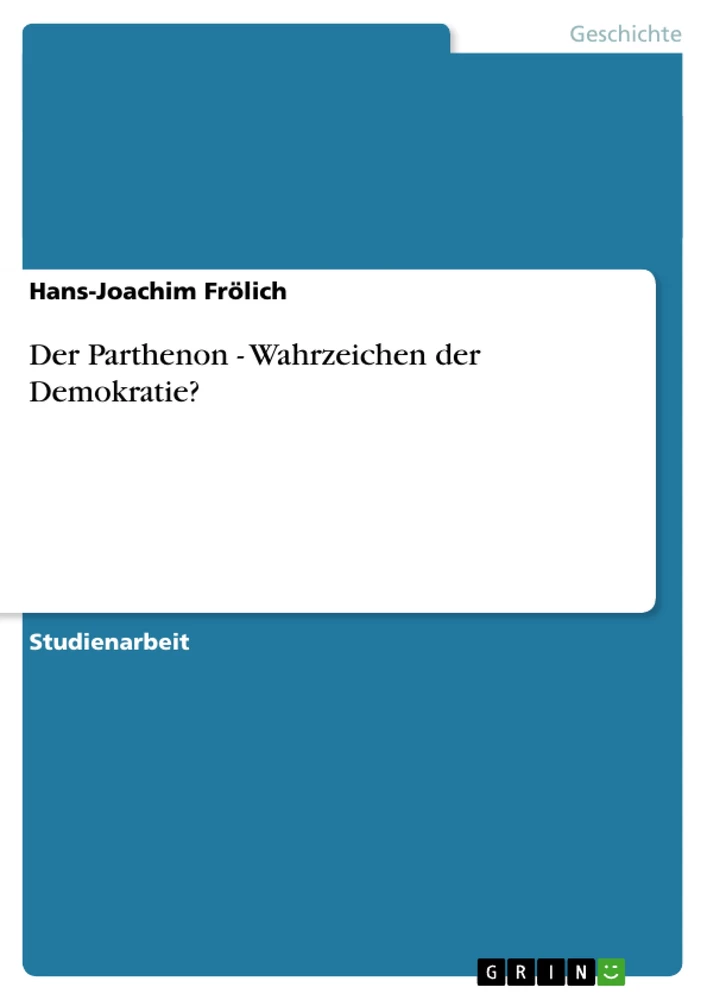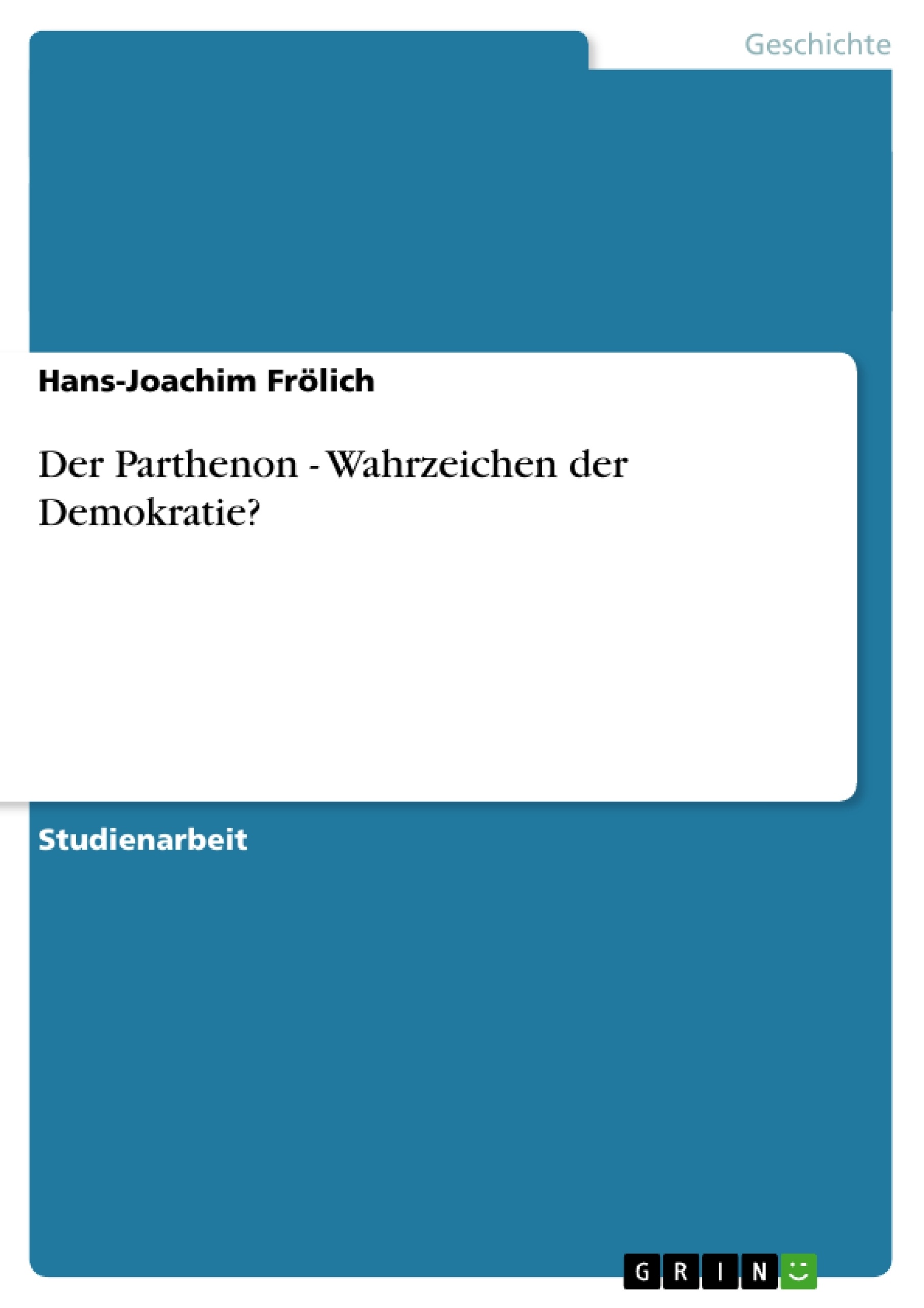Im Jahre 447 vor Christus legten die Athener den Grundstein für ein außergewöhnliches Gebäude. Schon 15 Jahre später waren die Bauarbeiten in der Innenstadt abgeschlossen - Der Parthenon, der größte Tempel auf der Akropolis, war entstanden. Zu Agora und Pnyx, den Mittelpunkten des Lebens in der Polis, strahlten die frischen bunten Farben seiner Skulpturen und Metopen herüber.
Die Bürger, die rund um den prachtvollen Bau ihre Wohnungen hatten, waren Zeugen einer glorreichen Zeit. Ihre Stadt war das Zentrum einer Großmacht, und sie alle (d.h. die Männer) hatten an dieser Macht teil. Rund 80 Jahre zuvor hatte Kleisthenes die Demokratie neu geordnet und den Einfluss der Volksversammlung gestärkt. Nun befand sich die demokratische Gesellschaft auf einem Höhepunkt.
Mit der innenpolitischen Stabilität gingen außenpolitische Erfolge einher. Aus den „Mitkämpfern” Athens im Seebund waren Untergebene geworden, die mit ihren Tributen zum Reichtum der Metropole am Saronischen Golf beitrugen.
Auf dem Höhepunkt ihrer Macht bauen die Athener auf dem damals höchsten Punkt ihrer Stadt den Parthenon. Bestehen über die bloße Gleichzeitigkeit hinaus Zusammenhänge zwischen dem öffentlichen Bau und der Politik? Welche Botschaft ging von den Skulpturen des Parthenon aus? Wie wirkte er auf Athener, wie auf Fremde? Es sind diese Fragen, die sich stellen, will man urteilen, ob der Parthenon ein „Wahrzeichen der Demokratie” war. Der Schwerpunkt soll hierbei auf der Betrachtung der Giebel, der Metopen und des Frieses liegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Von Grund auf demokratisch? Die Baudebatte (Plutarch, Perikles 12-14)
- 2.1 Die mangelnde Historizität der Schilderung
- 2.2 Die Grundaussage stimmt
- 3 Die Funktion des Parthenon
- 3.1 Kein Tempel
- 3.2 „The central bank of Athens”
- 3.3 Ein Denkmal des Volkes
- 3.4 Erst die Athener, dann Athena
- 4 Die Bauskulpturen und ihre Aussagen
- 4.1 Die Giebel
- 4.1.1 Der Ostgiebel
- 4.1.2 Der Westgiebel
- 4.2 Die Metopen
- 4.2.1 Die Nordmetopen
- 4.2.2 Die Südmetopen
- 4.2.3 Die Ostmetopen
- 4.2.4 Die Westmetopen
- 4.3 Der Fries
- 4.3.1 Der Festzug - mythisch, symbolisch oder historisch zu verstehen?
- 4.3.2 Eine Menschenmasse - das Volk in Marmor
- 4.3.3 Selbstbewußtsein oder Hybris?
- 4.3.4 Der Staat im Bild: die Phylenheroen
- 4.3.5 Der Imperialist bittet zum Altar - die Panathenäen und der Seebund
- 4.1 Die Giebel
- 5 Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Parthenon und seine Bedeutung im Kontext der athenischen Demokratie. Die Arbeit beleuchtet die Frage, inwieweit der Parthenon als „Wahrzeichen der Demokratie“ betrachtet werden kann. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Bauskulpturen (Giebel, Metopen, Fries) und deren Aussagekraft.
- Die demokratischen Entscheidungsprozesse beim Bau des Parthenon.
- Die Funktion des Parthenon als Tempel oder Schatzhaus.
- Die symbolische Bedeutung der Bauskulpturen und ihre Botschaften.
- Der Parthenon als Ausdruck athenischer Macht und Identität.
- Die historische Einordnung der Baudebatte nach Plutarch.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Bedeutung des Parthenon als „Wahrzeichen der Demokratie“ vor. Sie beschreibt den Parthenon als herausragendes Bauwerk, das im Kontext des Höhepunkts der athenischen Demokratie entstand, und kündigt den Fokus auf die Analyse der Bauskulpturen an. Die Verbindung zwischen dem monumentalen Bau und der politischen Realität Athens wird als zentrale Fragestellung formuliert.
2 Von Grund auf demokratisch? Die Baudebatte (Plutarch, Perikles 12-14): Dieses Kapitel analysiert Plutarchs Darstellung der Baudebatte um das Programm des Perikles. Es hinterfragt die historische Genauigkeit von Plutarchs Schilderung, argumentiert für eine teilweise mangelnde Historizität aufgrund des zeitlichen Abstands und der pädagogischen Intention Plutarchs. Trotz der kritischen Auseinandersetzung mit Plutarchs Werk, wird die grundlegende Aussage bestätigt: Die Entscheidung zum Bau des Parthenon erfolgte durch demokratische Abstimmungen und wurde von den Bürgern überwacht. Die demokratische Legitimation des Bauprojekts steht im Vordergrund.
3 Die Funktion des Parthenon: Dieses Kapitel diskutiert die Funktion des Parthenon. Es widerlegt die These, dass es sich um einen Tempel im traditionellen Sinne handelte, und argumentiert für die Interpretation als Schatzhaus oder Denkmal des Volkes. Der Mangel an eindeutigen Indizien für einen Kult wird hervorgehoben – das Fehlen eines Altars ist ein zentrales Argument. Die Darstellung der Athena Polias im Parthenon wird im Kontext der vorhandenen Quellen kritisch betrachtet.
Schlüsselwörter
Parthenon, athenische Demokratie, Perikles, Plutarch, Bauskulpturen, Giebel, Metopen, Fries, symbolische Bedeutung, politische Funktion, Baudebatte, historische Quellenkritik, Tempel, Schatzhaus, Volksversammlung.
Häufig gestellte Fragen zum Parthenon und der athenischen Demokratie
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Parthenon und seine Bedeutung im Kontext der athenischen Demokratie. Der Fokus liegt auf der Analyse der Bauskulpturen (Giebel, Metopen, Fries) und deren Aussagekraft, insbesondere im Hinblick auf die Frage, inwieweit der Parthenon als „Wahrzeichen der Demokratie“ betrachtet werden kann. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die Analyse der Baudebatte nach Plutarch, eine Diskussion der Funktion des Parthenon und eine detaillierte Interpretation der Bauskulpturen. Die Arbeit schließt mit einem Fazit und einer Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hauptquelle ist Plutarchs Darstellung der Baudebatte um den Parthenon. Die Arbeit analysiert Plutarchs Schilderung kritisch, hinterfragt deren historische Genauigkeit und berücksichtigt den zeitlichen Abstand und die Intention des Autors. Zusätzlich werden weitere historische Quellen herangezogen, um die Funktion und Bedeutung des Parthenon zu beleuchten. Die Analyse basiert auf einer kritischen Auseinandersetzung mit den vorhandenen Quellen.
Wie wird die demokratische Legitimation des Parthenon-Baus dargestellt?
Die Arbeit argumentiert, dass der Bau des Parthenon durch demokratische Abstimmungen legitimiert wurde und von den Bürgern überwacht wurde. Plutarchs Darstellung der Baudebatte wird zwar kritisch hinterfragt, die grundlegende Aussage über die demokratische Entscheidung für den Bau wird jedoch bestätigt. Die demokratische Legitimation des Bauprojekts steht im Vordergrund der Analyse.
Welche Funktion wird dem Parthenon zugeschrieben?
Die Arbeit widerlegt die These, dass der Parthenon ein Tempel im traditionellen Sinne war. Stattdessen wird argumentiert, dass er als Schatzhaus oder Denkmal des Volkes diente. Der Mangel an eindeutigen Indizien für einen traditionellen Kult, insbesondere das Fehlen eines Altars, wird als zentrales Argument angeführt. Die Rolle der Athena Polias im Parthenon wird im Kontext der vorhandenen Quellen kritisch betrachtet.
Wie werden die Bauskulpturen interpretiert?
Die Bauskulpturen (Giebel, Metopen, Fries) werden detailliert analysiert, um deren symbolische Bedeutung und Botschaften zu entschlüsseln. Die Arbeit untersucht die Darstellung von Mythen, Symbolen und historischen Ereignissen und betrachtet die Skulpturen als Ausdruck athenischer Macht und Identität. Besonders der Fries mit dem Panathenäen-Festzug wird eingehend untersucht, um seine politische und soziale Aussagekraft zu verstehen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Die demokratischen Entscheidungsprozesse beim Bau des Parthenon, die Funktion des Parthenon als Tempel oder Schatzhaus, die symbolische Bedeutung der Bauskulpturen und ihre Botschaften, der Parthenon als Ausdruck athenischer Macht und Identität und die historische Einordnung der Baudebatte nach Plutarch.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Parthenon, athenische Demokratie, Perikles, Plutarch, Bauskulpturen, Giebel, Metopen, Fries, symbolische Bedeutung, politische Funktion, Baudebatte, historische Quellenkritik, Tempel, Schatzhaus, Volksversammlung.
- Quote paper
- Hans-Joachim Frölich (Author), 2000, Der Parthenon - Wahrzeichen der Demokratie?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27294