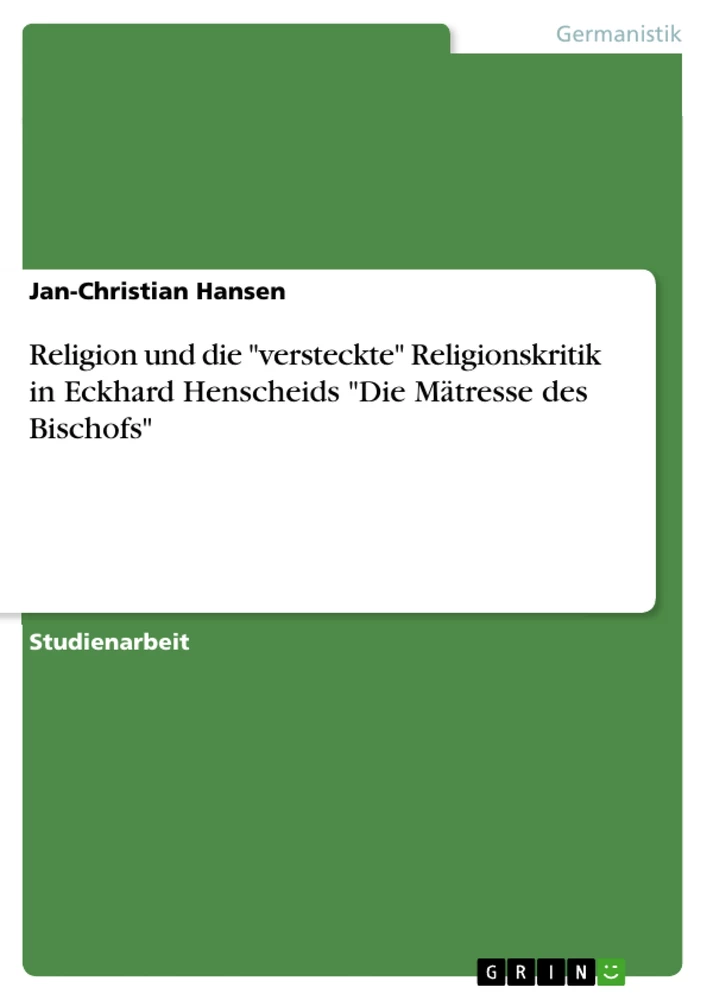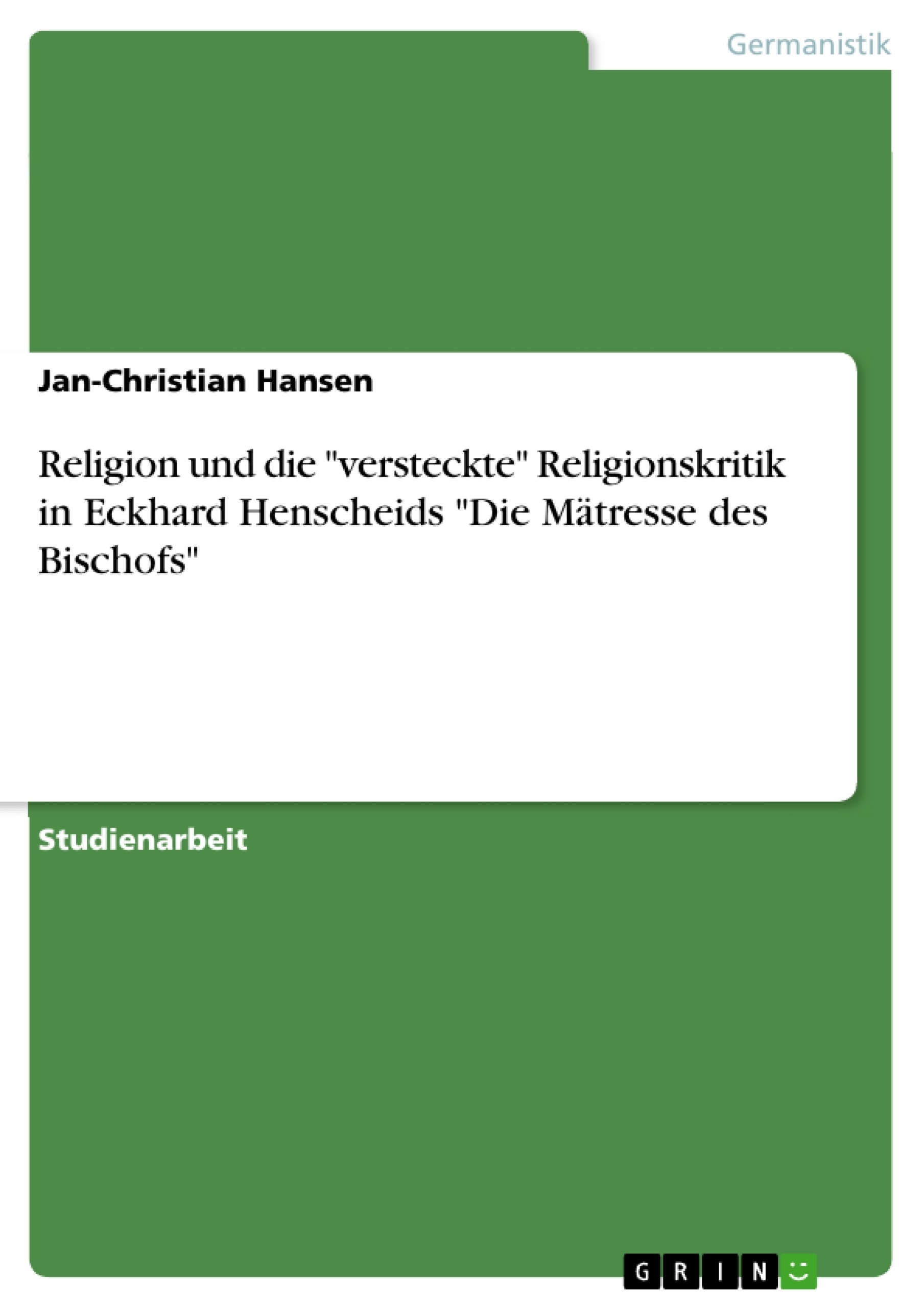Eckhard Henscheids knapp 1.000-seitige »Trilogie des laufenden Schwachsinns« wurde bis heute 400.000 Mal gedruckt. In Anbetracht dieses Erfolges stellt sich die Frage, warum kaufen und lesen so viele Menschen eine Trilogie, die vom Autor selbst als »schwachsinnig« betitelt wird?
In der Sekundärliteratur fanden und finden Henscheids Werke bisher eher wenig Beachtung, was vielleicht auch daran liegen mag, dass ihn einst der Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki einen „Idioten“ nannte und sich an Henscheids Werken die Geister scheiden, obwohl er als virtuoser Sprachjongleur gilt, der „seine ganz eigene saukomische Sprache gefunden hat, in der hoher Ton und niedere Beweggründe munter Trampolin springen“ (vgl. KUBITZA 2011).
Im Zentrum dieser Arbeit steht nicht die komplette »Trilogie des laufenden Schwachsinns«, sondern der „psychologische“ Roman »Die Mätresse des Bischofs«, explizit die Rolle der Religion und die versteckte Religionskritik im Roman.
»Die Mätresse des Bischofs« schließt die Trilogie des Schwachsinns ab, auch wenn Henscheid in seiner 1.000-seitigen Trilogie nur wenig Handlung und Wesentliches bietet, scheint es dem Anschein halber im Roman mit den Themen Religion und Sex um durchaus kontroverse Themen zu gehen und die Erwartungshaltung an den Miterfinder des Satiremagazins Titanic in puncto Religionskritik und einem satirischen Umgang mit den Themen Religion und Sex ist verständlicherweise hoch.
Im ersten Teil der Arbeit wird diese hohe Erwartungshaltung als Maßstab genommen und in den Roman eingeführt. In Form einer Analyse des Romantitels und den damit einhergehenden falschen Versprechungen Henscheids und der fehlenden Religiosität des Titels, die mit dem Inhalt des Werkes kontrastiert, erfolgt eine Einordnung der Iberer-Brüder, um die es eigentlich im Roman geht.
Im zweiten Teil der Arbeit stehen die religiösen Motive und Religion im Fokus, die anhand des fiktiven Ortes Dünklingen und der Figur Siegmund Landsherr exemplarisch untersucht werden sowie die (religiöse) Funktion der Iberer-Brüder.
Im letzten Teil erfolgt eine Interpretation der versteckten Religionskritik, um in den abschließenden Bemerkungen dem sinnlosen Roman einen Sinn abzugewinnen, der für die Literaturwissenschaft, den Leser und die Gesellschaft relevant sein könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Als der »Schwachsinn« das Laufen lernte
- Einführung in den Roman »Die Mätresse des Bischofs«
- Von falschen Versprechungen und fehlender Religiosität — der Romantitel
- Die Iberer-Brüder
- Religion & religiöse Motive im Roman
- Das katholische Dünklingen & der unzuverlässige Agnostiker Landsherr
- Sexualität, Obsession & Religion — die Funktion der Iberer-Brüder
- Die versteckte Religionskritik — die Anekdoten vom Marquis und Erzbischof
- Schluss: Ein sinnloser Roman voller Sinn
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Eckhard Henscheids Roman „Die Mätresse des Bischofs“ im Kontext der „Trilogie des laufenden Schwachsinns“. Der Fokus liegt auf der Rolle der Religion und der versteckten Religionskritik im Roman. Die Arbeit untersucht, wie Henscheid die Themen Religion und Sex in seinem Werk behandelt und wie er die Erwartungen des Lesers durch den Titel des Romans und die Darstellung der Iberer-Brüder als zentrale Figuren erfüllt oder enttäuscht.
- Die Rolle der Religion und die versteckte Religionskritik im Roman
- Die Funktion der Iberer-Brüder als Ersatz-Religion und Objekt der Obsession
- Die unzuverlässige Figur des Agnostikers Siegmund Landsherr und seine Suche nach Sinn
- Die Darstellung des fiktiven Ortes Dünklingen als Kontrast zwischen Katholizismus und Agnostizismus
- Die Bedeutung der barocken Regel des Gegensatzes in Henscheids Erzählweise
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in den Roman „Die Mätresse des Bischofs“ ein und beleuchtet die falschen Versprechungen des Titels. Henscheid suggeriert dem Leser, es ginge um einen Bischof und eine Mätresse, doch der Roman handelt tatsächlich von zwei langweiligen Brüdern, den Iberer-Brüdern, die vom Ich-Erzähler Siegmund Landsherr beobachtet werden. Der Titel stellt bereits eine Art Religionskritik dar, die durch Landsherrs Obsession mit den Brüdern und dessen Abkehr vom Katholizismus deutlich wird.
Im zweiten Kapitel werden die religiösen Motive im Roman untersucht. Der fiktive Ort Dünklingen, ein katholisches Umfeld, wird als Schauplatz für Landsherrs Suche nach Sinn und seine Abwendung vom Katholizismus dargestellt. Die Iberer-Brüder fungieren als Ersatz-Religion für Landsherr und werden von ihm als Objekt der Begierde betrachtet. Die Arbeit beleuchtet die Ambivalenz Landsherrs, der sich als Agnostiker bezeichnet, aber gleichzeitig den Katholizismus verteidigt und mit ihm liebäugelt.
Das dritte Kapitel widmet sich der versteckten Religionskritik im Roman. Zwei Anekdoten, die Geschichte vom Marquis und dem Erzbischof Clemente, unterstreichen die Beliebigkeit von Glaube und Religion. Henscheid zeigt die Ersetzbarkeit von Religion und die Sinnlosigkeit der Suche nach einem übergeordneten Sinn im Leben. Landsherrs ständige Wechsel zwischen verschiedenen Ersatz-Religionen, wie den Iberer-Brüdern, dem Igel Charly Mä, und anderen Objekten, verdeutlichen die Fragilität von Glauben und die Beliebigkeit von Sinnfindung.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Religion, Religionskritik, Ersatz-Religion, Agnostizismus, Katholizismus, Sexualität, Obsession, Sinnlosigkeit, „Trilogie des laufenden Schwachsinns“, Eckhard Henscheid, „Die Mätresse des Bischofs“, Siegmund Landsherr, Iberer-Brüder, Dünklingen, barocke Regel des Gegensatzes.
- Quote paper
- B.A. Jan-Christian Hansen (Author), 2014, Religion und die "versteckte" Religionskritik in Eckhard Henscheids "Die Mätresse des Bischofs", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272930