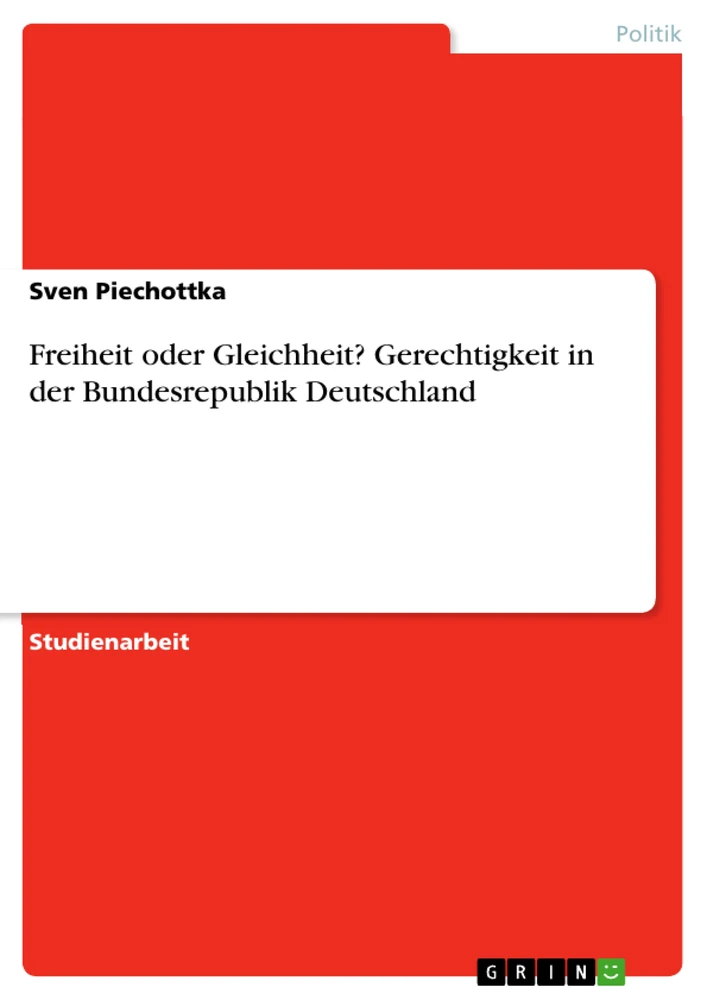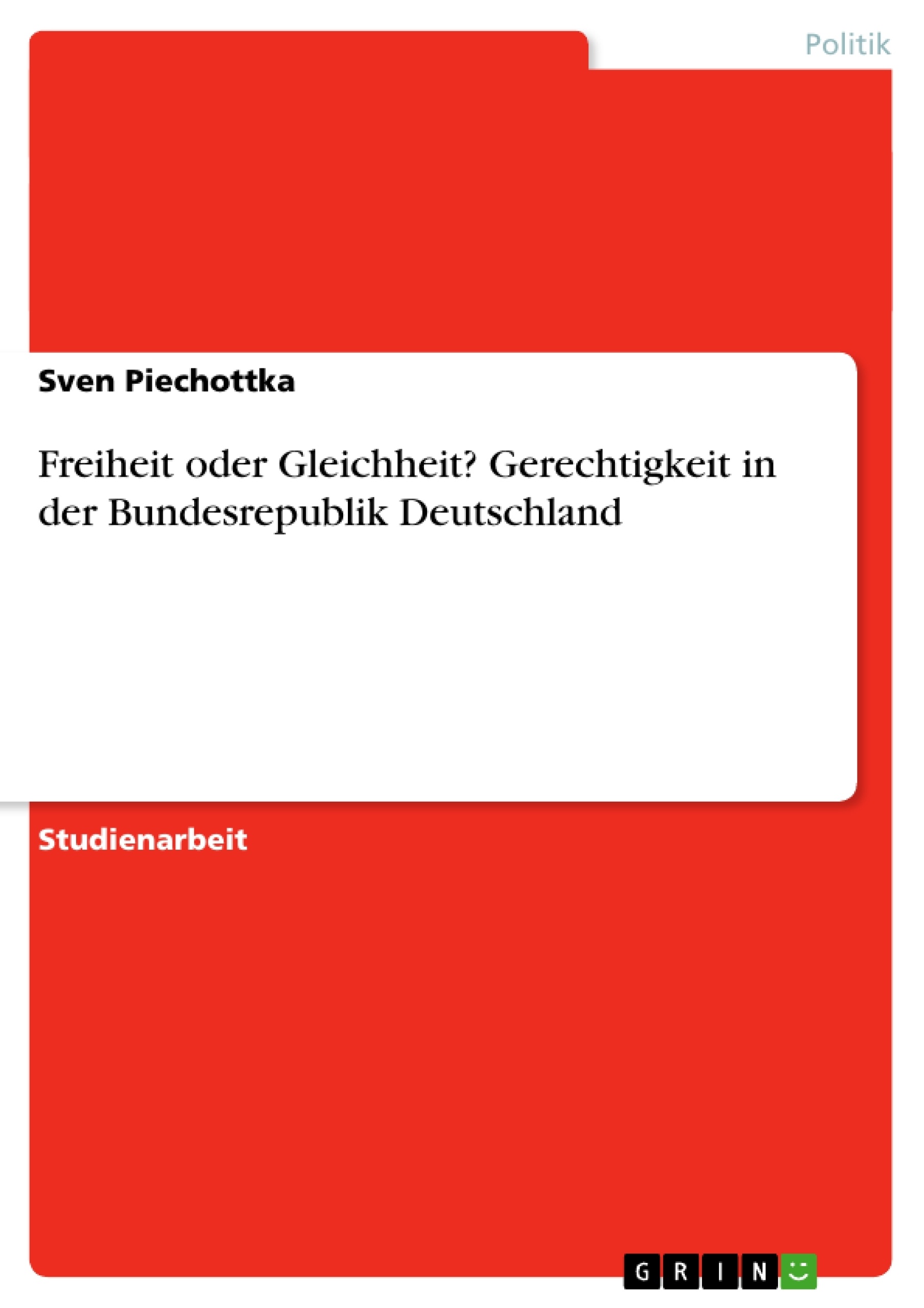Deutschland hat Nachholbedarf in Sachen Gerechtigkeit. Laut Studien im OECD-Vergleich weisen u.a. die Bereiche des Bildungszugangs und der Armutsvermeidung Mängel auf (vgl Bertelsmann Stiftung 2010). Hinzu kommt: laut einer Emnid-Umfrage aus dem Jahre 2008 halten etwa 80 Prozent das Steuersystem für ungerecht; 70 Prozent sagen dies vom Renten- und Gesundheitssystem (vgl Reader’s Digest 2008: 29). Hüther und Straubhaar (2009) bringen es in ihrem Buch „Die gefühlte Ungerechtigkeit“ auf den Punkt: „Gefühlt leben die Deutschen in einem zutiefst ungerechten Land“ (Hüther/Straubhaar 2009:312). Im Kontext des o.g. Zitates lautet daher die Gretchenfrage der deutschen Politik: Deutschland sag, wie hältst du’s mit der Gerechtigkeit? Die empirische Gerechtigkeitsforschung beschäftigt sich indes besonders mit der Frage, wie Gerechtigkeit in Deutschland wahrgenommen wird. Aus Sicht des Autors muss allerdings zuvor die Frage geklärt werden, was die Deutschen überhaupt unter dem Begriff der Gerechtigkeit anstreben! Die Leitfrage dieser Seminararbeit soll daher lauten: welches Gerechtigkeitsbild, ein liberales, ein kommunitaristisches oder ein egalitäres, ist in der deutschen Politik vorherrschend?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsdefinitionen
- Forschungsstand
- Vorstellung verschiedener Gerechtigkeitstheorien
- Robert Nozick
- John Rawls
- Axel Honneth
- Gerechtigkeit anhand konkreter Politikfeldanalysen: Sozialpolitik
- Krankheit und Gesundheit
- Arbeitslosenversicherung und Arbeitsmarktpolitik
- Rente
- Annex: Ein Plädoyer für „echte“ Solidarität
- Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das vorherrschende Gerechtigkeitsbild in der deutschen Politik. Sie beleuchtet, ob ein liberales, kommunitaristisches oder egalitäres Verständnis von Gerechtigkeit in der deutschen Politik dominiert. Die Arbeit analysiert die deutsche Sozialpolitik als Beispiel für verschiedene Politikfelder, um diese Frage zu beantworten.
- Begriffsdefinitionen von Gerechtigkeit und Solidarität
- Vorstellung verschiedener Gerechtigkeitstheorien (Nozick, Rawls, Honneth)
- Analyse der deutschen Sozialpolitik im Hinblick auf Gerechtigkeitsvorstellungen
- Der Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Solidarität
- Empirische Befunde zur "gefühlten Gerechtigkeit" in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Gerechtigkeit in Deutschland heraus, indem sie auf Studien und Umfragen verweist, die auf eine weit verbreitete Wahrnehmung von Ungerechtigkeit hinweisen. Sie zitiert Theodor Storm und führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: Welches Gerechtigkeitsbild (liberal, kommunitaristisch oder egalitär) dominiert in der deutschen Politik? Die Arbeit kündigt einen Vergleich verschiedener Gerechtigkeitstheorien und eine Analyse der deutschen Sozialpolitik an, um diese Frage zu beantworten. Der Fokus liegt auf der Klärung dessen, was Deutsche unter Gerechtigkeit verstehen.
Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe wie Sozialpolitik (im engeren und weiteren Sinne) und Solidarität. Es betont die unterschiedlichen Auffassungen von Gerechtigkeit in der Fachliteratur und beschränkt sich auf die für die Fragestellung relevanten Begriffe. Die Definition der Sozialpolitik nach Manfred Schmidt wird als besonders geeignet hervorgehoben, da sie Anknüpfungspunkte an egalitaristische und nonegalitaristische Sichtweisen bietet. Die Definition von Solidarität nach Schubert und Klein wird präsentiert und in Bezug zum Kommunitarismus gesetzt.
Forschungsstand: Der Forschungsstand beschreibt die Lücke in der Forschung, die diese Arbeit zu schließen versucht: nämlich den direkten Zusammenhang zwischen einzelnen Theorien der Gerechtigkeitsphilosophie und den aggregierten Vorstellungen von Gerechtigkeit in der Bevölkerung. Es werden existierende Studien zur "gefühlten Gerechtigkeit" und zur sozialen Gerechtigkeit erwähnt, wobei die Arbeit von Roswitha Pioch und die Dissertation von Kristina Köhler besonders hervorgehoben werden. Pioch analysiert verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen, ohne diese jedoch direkt mit philosophischen Theorien zu verknüpfen. Köhler untersucht die Gerechtigkeitsvorstellungen von CDU-Anhängern und -Abgeordneten und stellt deren nonegalitäre Werthaltungen fest, jedoch nur für einen Teil der Bevölkerung.
Vorstellung verschiedener Gerechtigkeitstheorien: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Gerechtigkeitstheorien von Robert Nozick, John Rawls und Axel Honneth. Es legt dar, wie diese Theorien unterschiedliche Konzepte von Gerechtigkeit definieren und welche Implikationen diese für die Gestaltung der Politik haben. Es wird eine vergleichende Analyse der jeweiligen Positionen präsentiert, die in ihrer Zusammenfassung die unterschiedlichen Ansätze und deren Relevanz für die Fragestellung hervorhebt. Die Kapitel 4.1, 4.2 und 4.3 würden hier detailliert zusammengefasst.
Gerechtigkeit anhand konkreter Politikfeldanalysen: Sozialpolitik: Dieses Kapitel analysiert die deutsche Sozialpolitik (Krankheit und Gesundheit, Arbeitslosenversicherung und Arbeitsmarktpolitik, Rente) im Hinblick auf die zugrunde liegenden Gerechtigkeitsvorstellungen. Es wird untersucht, inwieweit die verschiedenen Politikfelder liberale, kommunitaristische oder egalitäre Prinzipien widerspiegeln. Die Zusammenfassung synthetisiert die Ergebnisse der einzelnen Unterkapitel (5.1, 5.2, 5.3) zu einem umfassenden Bild der Gerechtigkeitsvorstellungen in der deutschen Sozialpolitik.
Schlüsselwörter
Gerechtigkeit, Solidarität, Sozialpolitik, Gerechtigkeitstheorien, Nozick, Rawls, Honneth, liberale Gerechtigkeit, kommunitaristische Gerechtigkeit, egalitäre Gerechtigkeit, Deutschland, Politikfeldanalyse, empirische Gerechtigkeitsforschung, gefühlte Ungerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Gerechtigkeit in der deutschen Politik
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das vorherrschende Gerechtigkeitsbild in der deutschen Politik. Sie analysiert, ob ein liberales, kommunitaristisches oder egalitäres Verständnis von Gerechtigkeit dominiert und verwendet die deutsche Sozialpolitik als Fallbeispiel.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt Begriffsdefinitionen von Gerechtigkeit und Solidarität, stellt verschiedene Gerechtigkeitstheorien (Nozick, Rawls, Honneth) vor und analysiert die deutsche Sozialpolitik (Gesundheit, Arbeitslosenversicherung, Rente) im Hinblick auf zugrundeliegende Gerechtigkeitsvorstellungen. Der Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Solidarität sowie empirische Befunde zur "gefühlten Gerechtigkeit" werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Gerechtigkeitstheorien werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt die Gerechtigkeitstheorien von Robert Nozick, John Rawls und Axel Honneth vor und vergleicht deren unterschiedliche Konzepte von Gerechtigkeit und deren politische Implikationen.
Wie wird die deutsche Sozialpolitik analysiert?
Die deutsche Sozialpolitik wird anhand der Bereiche Krankheit und Gesundheit, Arbeitslosenversicherung und Arbeitsmarktpolitik sowie Rente analysiert. Die Analyse untersucht, inwieweit diese Politikfelder liberale, kommunitaristische oder egalitäre Prinzipien widerspiegeln.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke zwischen einzelnen Theorien der Gerechtigkeitsphilosophie und den aggregierten Vorstellungen von Gerechtigkeit in der Bevölkerung. Sie geht über existierende Studien hinaus, indem sie Theorien direkt mit empirischen Befunden verknüpft.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind Gerechtigkeit, Solidarität, Sozialpolitik, Gerechtigkeitstheorien, Nozick, Rawls, Honneth, liberale Gerechtigkeit, kommunitaristische Gerechtigkeit, egalitäre Gerechtigkeit, Deutschland, Politikfeldanalyse, empirische Gerechtigkeitsforschung und gefühlte Ungerechtigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, Begriffsdefinitionen, Forschungsstand, verschiedenen Gerechtigkeitstheorien, Gerechtigkeit anhand konkreter Politikfeldanalysen (Sozialpolitik), einem Annex ("Plädoyer für 'echte' Solidarität") und einer Konklusion.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält detaillierte Zusammenfassungen jedes Kapitels, die die zentralen Argumente und Ergebnisse jedes Abschnitts hervorheben.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, das vorherrschende Gerechtigkeitsbild in der deutschen Politik zu untersuchen und zu analysieren, ob liberale, kommunitaristische oder egalitäre Konzepte dominieren. Die Analyse der Sozialpolitik soll diese Frage beantworten.
- Arbeit zitieren
- Sven Piechottka (Autor:in), 2013, Freiheit oder Gleichheit? Gerechtigkeit in der Bundesrepublik Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272845