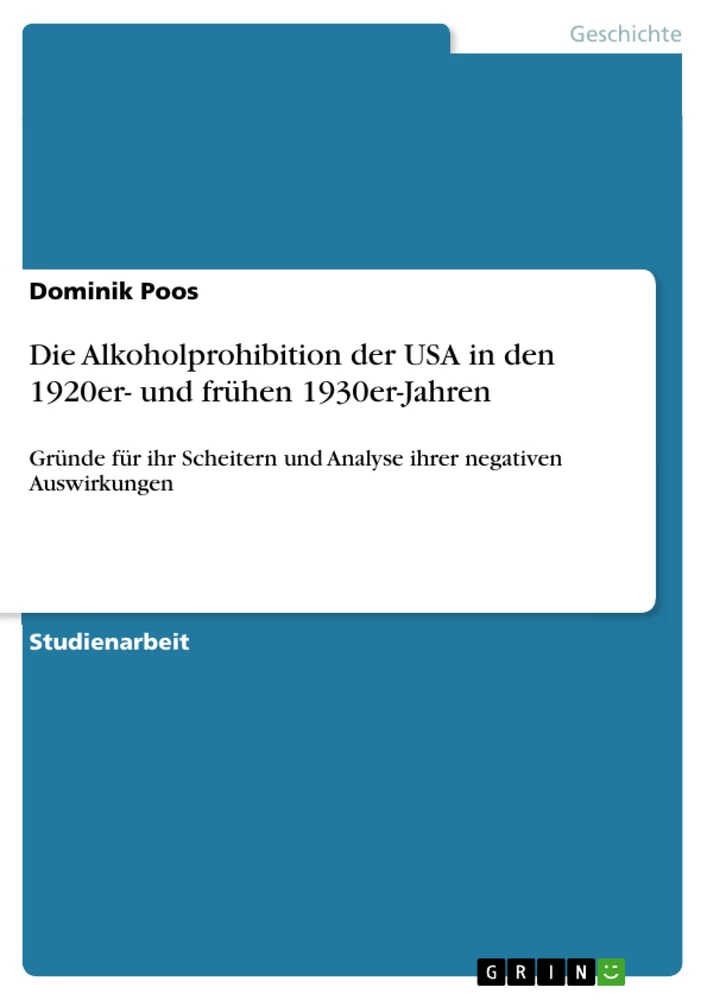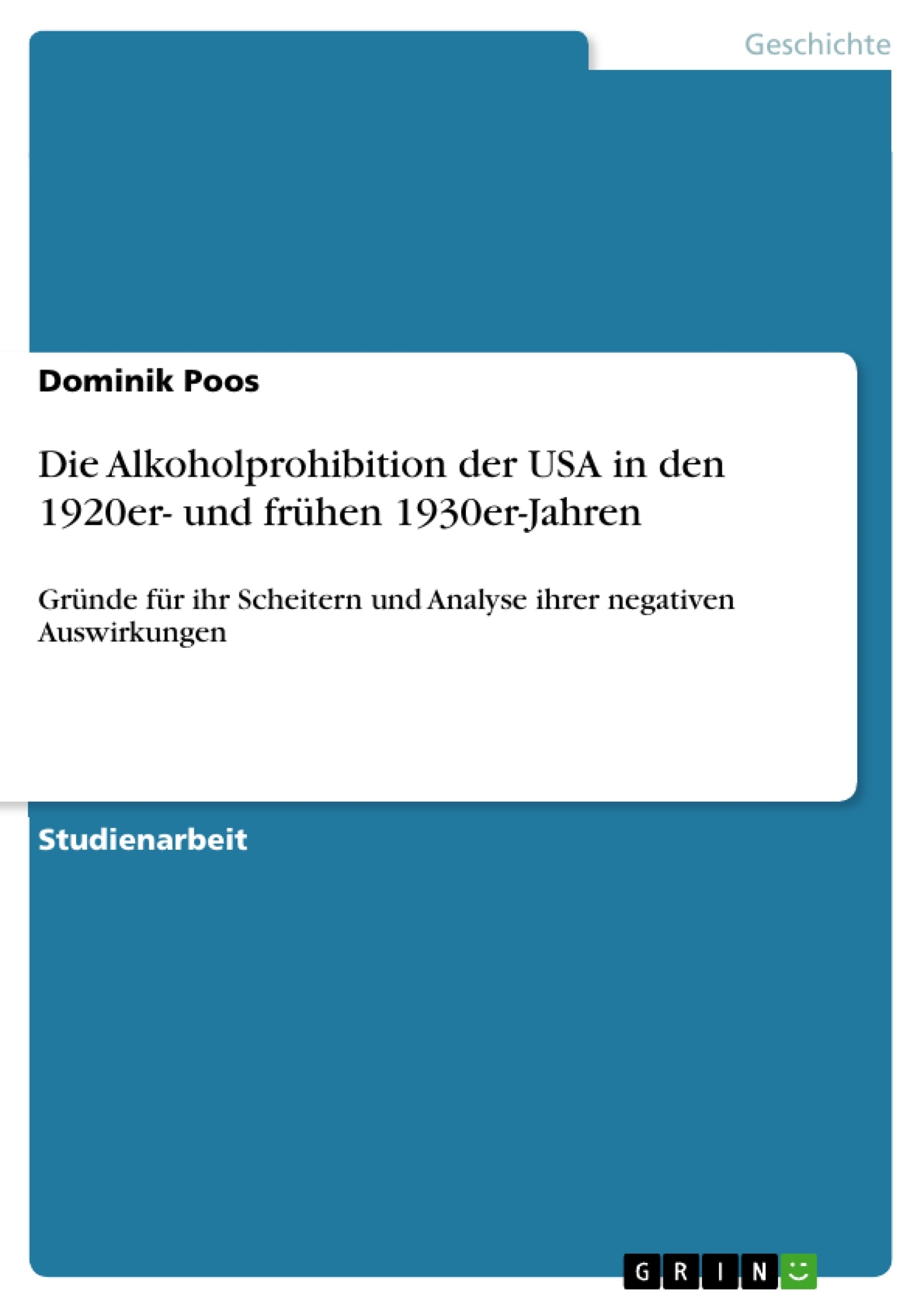Die Alkoholprohibition in den USA der 1920er- und frühen 1930er-Jahre hat sich bis heute als gescheitertes „Nobles Experiment“ in die Köpfe der Menschen eingebrannt.1 Korruption bis auf die höchsten politischen Ebenen, organisierte Kriminalität, die ein bis dahin ungeahntes Ausmaß annahm, sowie eine starke Wandlung der amerikanischen Kultur – all diese Faktoren tragen zum heutigen Image der Prohibition bei. Dem gegenüber stand ein neues amerikanisches Lebensgefühl, das sich besonders durch den Wunsch mit alten Traditionen zu brechen und den ersten Schritt in die Moderne zu tun charakterisieren lässt. Massenproduktion und -konsum, neue Technologien, starke gesellschaftliche Veränderungen2 sowie wirtschaftliche und kulturelle Prosperität3 bestimmten das amerikanische Leben in den 1920er-Jahren. Vor allem ließ sich dies in den Großstädten des Landes spüren. Kollektiv wird dieses Lebensgefühl als „(Spirit of the) Roaring Twenties“ bezeichnet. Die durch den 18. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten am 16. Januar 1920 in Kraft getretene Prohibition trug einen bedeutenden Teil zu diesem „Geist der Goldenen Zwanziger“ bei.
Wo lagen die Gründe für das Ausmaß der negativen Auswirkungen? Und inwiefern ist der Forschung zuzustimmen, dass die Prohibition lediglich ein gescheitertes nobles Experiment war? Diese Fragen zu beantworten wird meine Aufgabe in dieser grundlegend dreigeteilten Arbeit sein. Zu Beginn werde ich dazu die gesellschaftlich/ (trink-)kulturelle Sicht auf die Prohibition mittels einer kritischen Analyse des Saloons und des Speakeasys darstellen. Danach möchte ich mich mit der Bedeutung des Alkoholverbots für die Wirtschaft der USA auseinandersetzen. Dies wird anhand der zwei Faktoren Alkoholproduktion und organisierte Kriminalität geschehen. Anschließend werde ich die zuvor gewonnenen Erkenntnisse miteinander konfrontieren und wesentliche Gründe für die negativen Auswirkungen der Prohibition herausarbeiten. Zum Abschluss werde ich mich der Frage widmen, inwiefern das „Noble Experiment“ scheiterte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gesellschaft und (Trink-)Kultur
- Der Saloon
- Aufstieg, Verbreitung und erste Gegner
- Untergang
- Das „Speakeasy“
- Der Saloon
- Wirtschaft
- Alkoholproduktion
- Organisierte Kriminalität
- Gründe für die Auswirkungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch die amerikanische Alkoholprohibition der 1920er und frühen 1930er Jahre. Ziel ist es, die Gründe für ihr Scheitern und die negativen Auswirkungen zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Interaktion zwischen gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Faktoren gelegt.
- Der Wandel der amerikanischen Trinkkultur durch die Prohibition
- Die Auswirkungen der Prohibition auf die Alkoholproduktion und den Schwarzmarkt
- Der Aufstieg der organisierten Kriminalität im Kontext der Prohibition
- Die Diskrepanz zwischen den Zielen der Prohibition und ihren tatsächlichen Folgen
- Die Relevanz der Prohibition für die Gegenwart
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Alkoholprohibition als gescheitertes „Nobles Experiment“ dar und skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. Sie beschreibt den gesellschaftlichen Kontext der „Roaring Twenties“ und kontrastiert die ursprünglichen Absichten der Prohibition mit ihren tatsächlichen Folgen, wobei Zitate von John Marshall Harlan und John D. Rockefeller Jr. die unterschiedlichen Perspektiven verdeutlichen. Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: die gesellschaftlich-kulturelle Sicht auf die Prohibition, die wirtschaftlichen Auswirkungen und schließlich eine Analyse der Gründe für die negativen Folgen.
Gesellschaft und (Trink-)Kultur: Dieses Kapitel analysiert die amerikanische Trinkkultur vor und während der Prohibition. Der Saloon wird als zentrale Institution der vorprohibitionistischen Gesellschaft dargestellt, seine Entstehung, Verbreitung und der entstehende Widerstand werden beleuchtet. Der Untergang des Saloons im Kontext der Prohibition wird analysiert, seine Rolle als „Sündenpfuhl“ und die „(un-)heilige Dreifaltigkeit“ (Alkohol, Glücksspiel, Prostitution) werden thematisiert. Der Aufstieg des „Speakeasys“ als Ersatz für den Saloon wird ebenfalls untersucht und die Unterschiede zwischen beiden Institutionen hervorgehoben. Die Kapitel erforscht, wie die Prohibition die gesellschaftliche und kulturelle Landschaft Amerikas nachhaltig beeinflusste.
Wirtschaft: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der Prohibition. Die Analyse der Alkoholproduktion zeigt die erzwungene Neuorientierung der Branche und die damit verbundenen Einbußen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss der Prohibition auf die organisierte Kriminalität. Die Herstellung und der Vertrieb von illegalem Alkohol werden untersucht, ebenso wie die Korruption, die durch das Alkoholverbot begünstigt wurde. Zusammenfassend zeigt dieses Kapitel die direkten und indirekten ökonomischen Folgen des Alkoholverbots auf, die weit über die Alkoholindustrie hinausreichten.
Schlüsselwörter
Alkoholprohibition, USA, Roaring Twenties, Saloon, Speakeasy, organisierte Kriminalität, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, „Nobles Experiment“, Gescheiterte Regulierung, Schwarzmarkt.
Häufig gestellte Fragen zur amerikanischen Alkoholprohibition
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert kritisch die amerikanische Alkoholprohibition der 1920er und frühen 1930er Jahre. Sie untersucht die Gründe für ihr Scheitern und die negativen Auswirkungen auf Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. Der Fokus liegt auf der Interaktion verschiedener Faktoren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der amerikanischen Trinkkultur, die Auswirkungen auf die Alkoholproduktion und den Schwarzmarkt, den Aufstieg der organisierten Kriminalität, die Diskrepanz zwischen Zielen und Folgen der Prohibition und deren Relevanz für die Gegenwart. Spezifische Aspekte umfassen den Saloon und das Speakeasy als Institutionen, die wirtschaftlichen Folgen des Alkoholverbots und die Korruption, die damit einherging.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Gesellschaft und (Trink-)Kultur, Wirtschaft und abschließend ein Fazit. Die Einleitung stellt die Prohibition als gescheitertes Experiment dar und skizziert die Forschungsfragen. Die Kapitel analysieren die gesellschaftlich-kulturellen und wirtschaftlichen Auswirkungen detailliert. Die Kapitelzusammenfassungen geben einen Überblick über den Inhalt der einzelnen Abschnitte.
Welche Quellen werden verwendet (implizit)?
Die Arbeit bezieht sich implizit auf historische Quellen, um die Entwicklung des Saloons, des Speakeasys, die Alkoholproduktion und den Schwarzmarkt zu beleuchten. Die Zitate von John Marshall Harlan und John D. Rockefeller Jr. verdeutlichen unterschiedliche Perspektiven auf die Prohibition.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Alkoholprohibition, USA, Roaring Twenties, Saloon, Speakeasy, organisierte Kriminalität, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, „Nobles Experiment“, gescheiterte Regulierung, Schwarzmarkt.
Was ist das Fazit (implizit)?
Ein explizites Fazit wird nicht im gegebenen Text dargestellt, jedoch lässt sich implizit schließen, dass die Arbeit die negativen Folgen der Prohibition und ihr Scheitern als Folge komplexer gesellschaftlicher, kultureller und wirtschaftlicher Faktoren aufzeigen wird. Die Diskrepanz zwischen den Zielen der Prohibition und ihren tatsächlichen Resultaten steht im Mittelpunkt der Analyse.
Welche konkreten Aspekte des Saloons werden behandelt?
Der Saloon wird als zentrale Institution der vorprohibitionistischen Gesellschaft dargestellt. Seine Entstehung, Verbreitung, der entstehende Widerstand und sein Untergang im Kontext der Prohibition werden analysiert. Seine Rolle als „Sündenpfuhl“ und die Verbindung zu Alkohol, Glücksspiel und Prostitution werden thematisiert.
Wie wird der Unterschied zwischen Saloon und Speakeasy dargestellt?
Der Aufstieg des „Speakeasys“ als Ersatz für den Saloon wird untersucht und die Unterschiede zwischen beiden Institutionen werden hervorgehoben. Es wird analysiert, wie die Prohibition die gesellschaftliche und kulturelle Landschaft Amerikas nachhaltig beeinflusste und wie sich dies in den unterschiedlichen Institutionen widerspiegelt.
Welche wirtschaftlichen Auswirkungen der Prohibition werden untersucht?
Die wirtschaftlichen Auswirkungen konzentrieren sich auf die Alkoholproduktion, die erzwungene Neuorientierung der Branche und die damit verbundenen Einbußen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Einfluss der Prohibition auf die organisierte Kriminalität, die Herstellung und den Vertrieb von illegalem Alkohol sowie die damit verbundene Korruption.
- Quote paper
- Dominik Poos (Author), 2014, Die Alkoholprohibition der USA in den 1920er- und frühen 1930er-Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272718