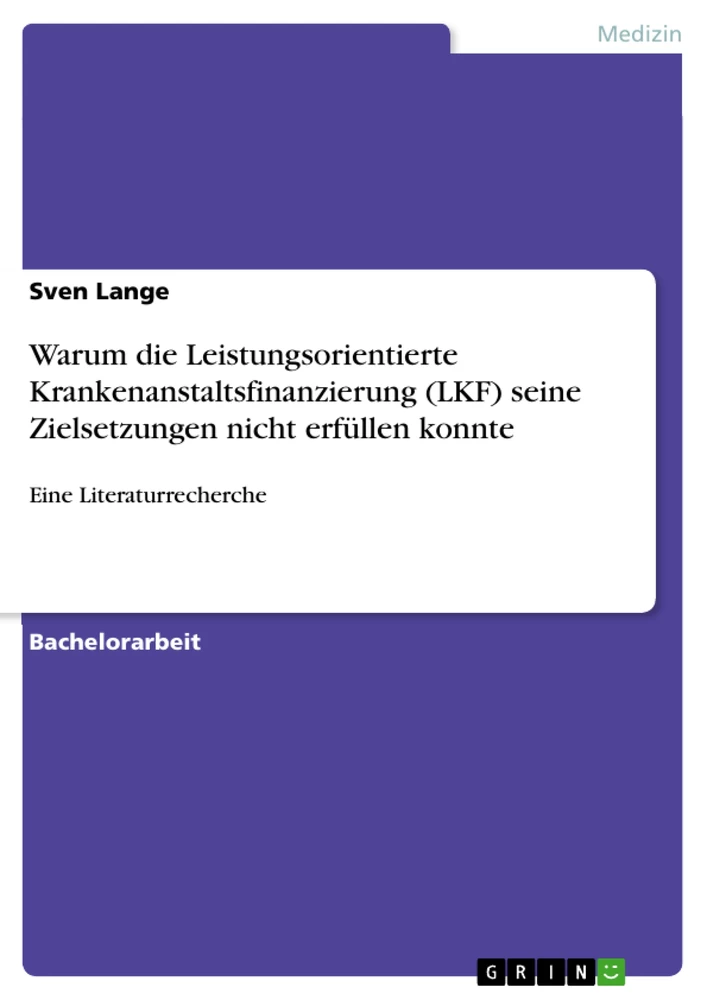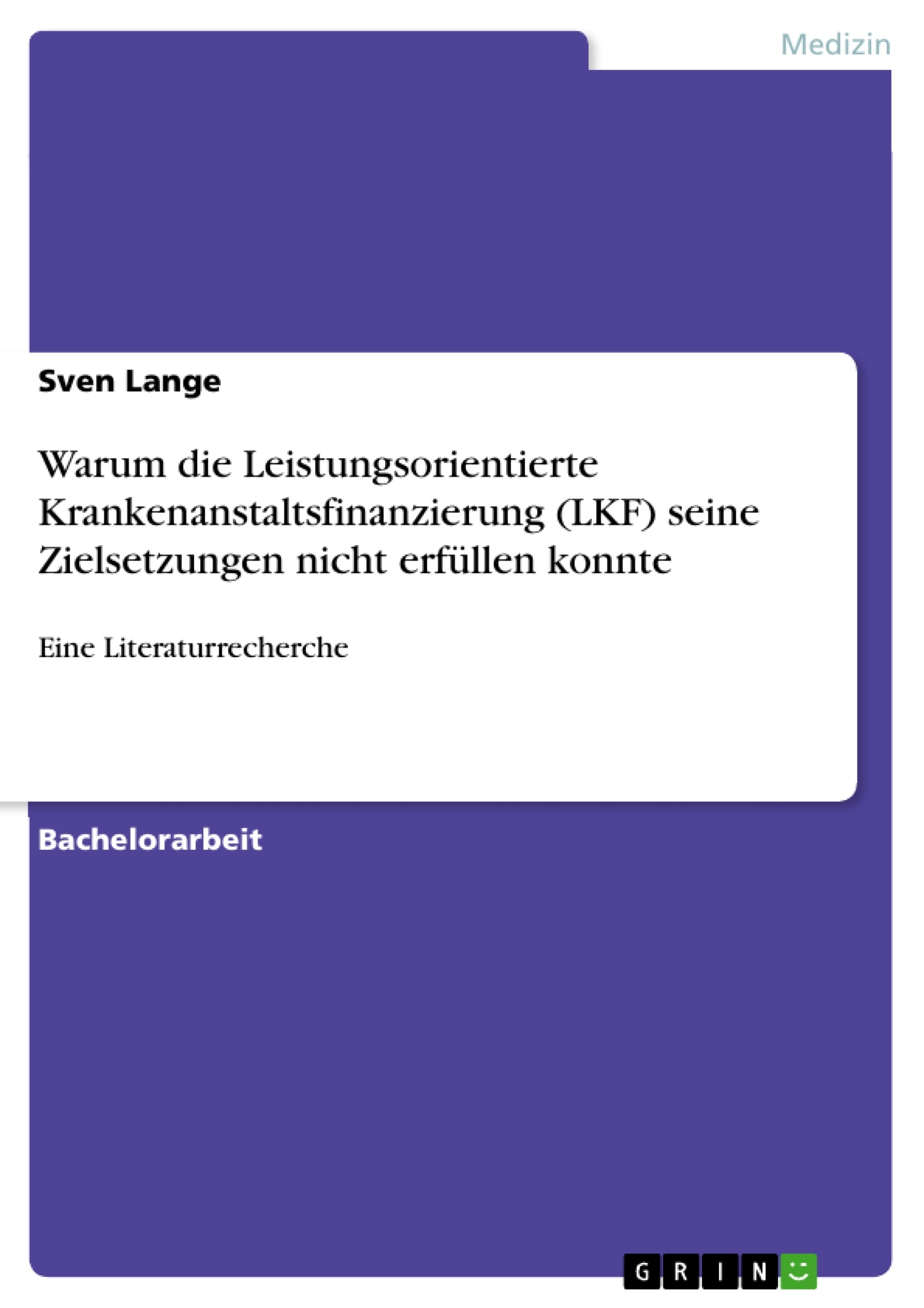Das österreichische Gesundheitssystem ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein Sozialversicherungssystem in der Bismarck’schen Tradition. Dieses System, das
im Wesentlichen im „Bruderladen der Bergleute“ seinen Ursprung hat (Hofmarcher & Rack, 2006), wird getragen von der Tatsache, dass all jene die berufstätig sind einen Teil ihres Einkommens in die allgemeine Sozialversicherung einzahlen. Somit ist dem Versicherungsgedanke einerseits und der solidarischen Umverteilung durch die Pflichtversicherung andererseits
genüge getan.
Aufgrund demographischer Entwicklungen - sinkende durchschnittliche Anzahl der Kinder je Frau (Statistik Austria, 2008) - und wirtschaftlicher Entwicklungen –
Wirtschaftswachstum durch Kapitalertragswachstum (Höß, Staudinger, 2007) - wird seit Ende der 1970er Jahre in Österreich darüber lamentiert, dass das
österreichische Gesundheitssystem in der damaligen Ausprägung im Hinblick auf die Themenkomplexe – Leistungsumfang – Zugangsgerechtigkeit - Finanzierung
- Vergütung, in der damaligen Form nicht mehr im erwünschten Ausmaß finanziert werden konnte. Bedenkt man auch das ausgeprägte Bismarck’sche Dreiecks-Modell in Verbindung mit dem in Österreich geltenden Prinzip
„Föderalismus vor Zentralismus“, so steht dieses Gesundheitssystem für hohe Komplexität und eine Vielzahl von Interessensträgern, die mehr oder weniger pro-aktiv zur Veränderung des Gesundheitssystems beitragen (Höß, Staudinger, 2007; Theurl, 2004).
In Anbetracht der Tatsache, dass erkannt wurde, dass Reformen zur Garantierung des bestehenden Leistungsumfanges und dementsprechend zur
nachhaltigen Finanzierung des Gesundheitssystems notwendig sind, wurden seit Ende der 1970er Jahre zahlreiche mehr oder weniger umfangreiche Reformen
initiiert und umgesetzt. Das Ziel dabei war in fast allen Fällen die langfristige, nachhaltige Sicherstellung qualitativ hochwertiger medizinischer Leistungen für
die österreichische Bevölkerung. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Prospektive Vergütungssysteme allgemein
- 1.2. Das österreichische LKF-System
- 2. Methode und Ziel
- 3. Resultate
- 3.1. Übersicht zu den Ergebnissen der Literatursuche
- 3.2. Resultate (basierend auf Literatursuche)
- 3.2.1. Höhere Kosten- und Leistungstransparenz
- 3.2.2. Langfristige Eindämmung der Kostensteigerungen
- 3.2.3. Reduzierung unnötiger Mehrfachleistungen
- 3.2.4. Strukturveränderungen (u.a. Akutbettenabbau)
- 3.2.5. Einheitliches Planungs- und Steuerungsinstrument
- 3.2.6. Weitere Aspekte
- 4. Diskussion
- 5. Conclusio
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Gründe, warum das österreichische LKF-System (Leistungs- und Kostenführersystem) seine Zielsetzungen nicht erreichen konnte. Die Arbeit analysiert die Literatur zum Thema und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen im österreichischen Gesundheitssystem.
- Analyse des österreichischen Gesundheitssystems und seiner Herausforderungen
- Bewertung der prospektiven Vergütungssysteme im Allgemeinen
- Evaluierung der Zielsetzungen des LKF-Systems
- Untersuchung der Gründe für das Nichterreichen der Zielsetzungen
- Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das österreichische Gesundheitssystem als Sozialversicherungssystem in Bismarck'scher Tradition und beleuchtet die Herausforderungen aufgrund demografischer und wirtschaftlicher Entwicklungen. Sie führt in die Notwendigkeit von Reformen ein, insbesondere im Krankenhaussektor, und die damit verbundene Umstellung von einem System der fixen Taggeldvergütung auf ein prospektives und leistungsorientiertes Vergütungssystem. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit von Reformen zur nachhaltigen Finanzierung und Sicherstellung qualitativ hochwertiger medizinischer Leistungen.
1.1. Prospektive Vergütungssysteme allgemein: Dieses Kapitel erklärt das Prinzip prospektiver Vergütungssysteme, insbesondere die diagnosebezogenen Gruppen (DRGs), die erstmals in den USA eingeführt wurden. Es erläutert, wie DRGs die Kosten je Diagnose nachvollziehbar machen und als Grundlage für eine leistungsorientierte Vergütung von Krankenhäusern dienen. Die Diskussion der zugrundeliegenden Prinzipien und der Verwendung von ICD-10 Codes als Basis für DRGs ist zentral für das Verständnis des gesamten Kontextes.
Schlüsselwörter
Österreichisches Gesundheitssystem, LKF-System, prospektive Vergütung, DRGs, Kosten- und Leistungstransparenz, Kosteneindämmung, Mehrfachleistungen, Strukturveränderungen, Gesundheitsausgaben, Reform des Krankenhaussektors.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Analyse des österreichischen LKF-Systems
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit analysiert die Gründe für das Scheitern des österreichischen LKF-Systems (Leistungs- und Kostenführersystem) in der Erreichung seiner Zielsetzungen. Sie untersucht die Herausforderungen im österreichischen Gesundheitssystem im Zusammenhang mit diesem System der prospektiven Vergütung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Analyse des österreichischen Gesundheitssystems und seiner Herausforderungen, die Bewertung prospektiver Vergütungssysteme im Allgemeinen, die Evaluierung der LKF-System-Zielsetzungen, die Untersuchung der Gründe für deren Nichterreichen und eine abschließende Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Funktionsweise und den Prinzipien von DRGs (diagnosebezogene Gruppen).
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit basiert auf einer Literaturrecherche und Analyse relevanter Publikationen zum Thema. Die Ergebnisse dieser Literaturrecherche werden systematisch dargestellt und diskutiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Literaturanalyse beleuchten verschiedene Aspekte, wie höhere Kosten- und Leistungstransparenz, die langfristige Eindämmung von Kostensteigerungen, die Reduzierung unnötiger Mehrfachleistungen, Strukturveränderungen (z.B. Akutbettenabbau), sowie die Eignung des Systems als Planungs- und Steuerungsinstrument. Zusätzliche Aspekte werden ebenfalls diskutiert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die das österreichische Gesundheitssystem und die Notwendigkeit von Reformen beschreibt. Es folgen Kapitel zu prospektiven Vergütungssystemen im Allgemeinen, den Ergebnissen der Literaturrecherche, einer Diskussion der Ergebnisse und einer abschließenden Conclusio. Ein Literaturverzeichnis rundet die Arbeit ab.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Österreichisches Gesundheitssystem, LKF-System, prospektive Vergütung, DRGs, Kosten- und Leistungstransparenz, Kosteneindämmung, Mehrfachleistungen, Strukturveränderungen, Gesundheitsausgaben, Reform des Krankenhaussektors.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Gründe für das Nichterreichen der Zielsetzungen des österreichischen LKF-Systems aufzuzeigen und zu analysieren. Die Arbeit soll einen Beitrag zum Verständnis der Herausforderungen im österreichischen Gesundheitssystem leisten.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit dem österreichischen Gesundheitssystem, dem Krankenhaussektor und den Herausforderungen der Gesundheitsfinanzierung befassen. Sie ist insbesondere für Studierende, Wissenschaftler und Praktiker im Gesundheitswesen von Interesse.
- Quote paper
- Sven Lange (Author), 2009, Warum die Leistungsorientierte Krankenanstaltsfinanzierung (LKF) seine Zielsetzungen nicht erfüllen konnte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272552