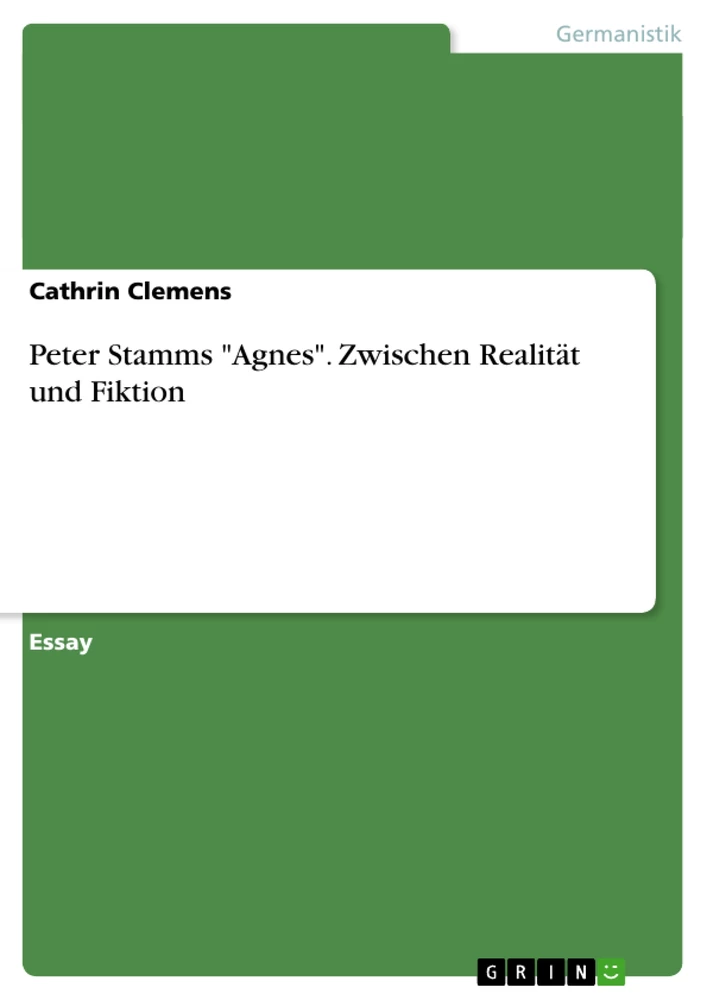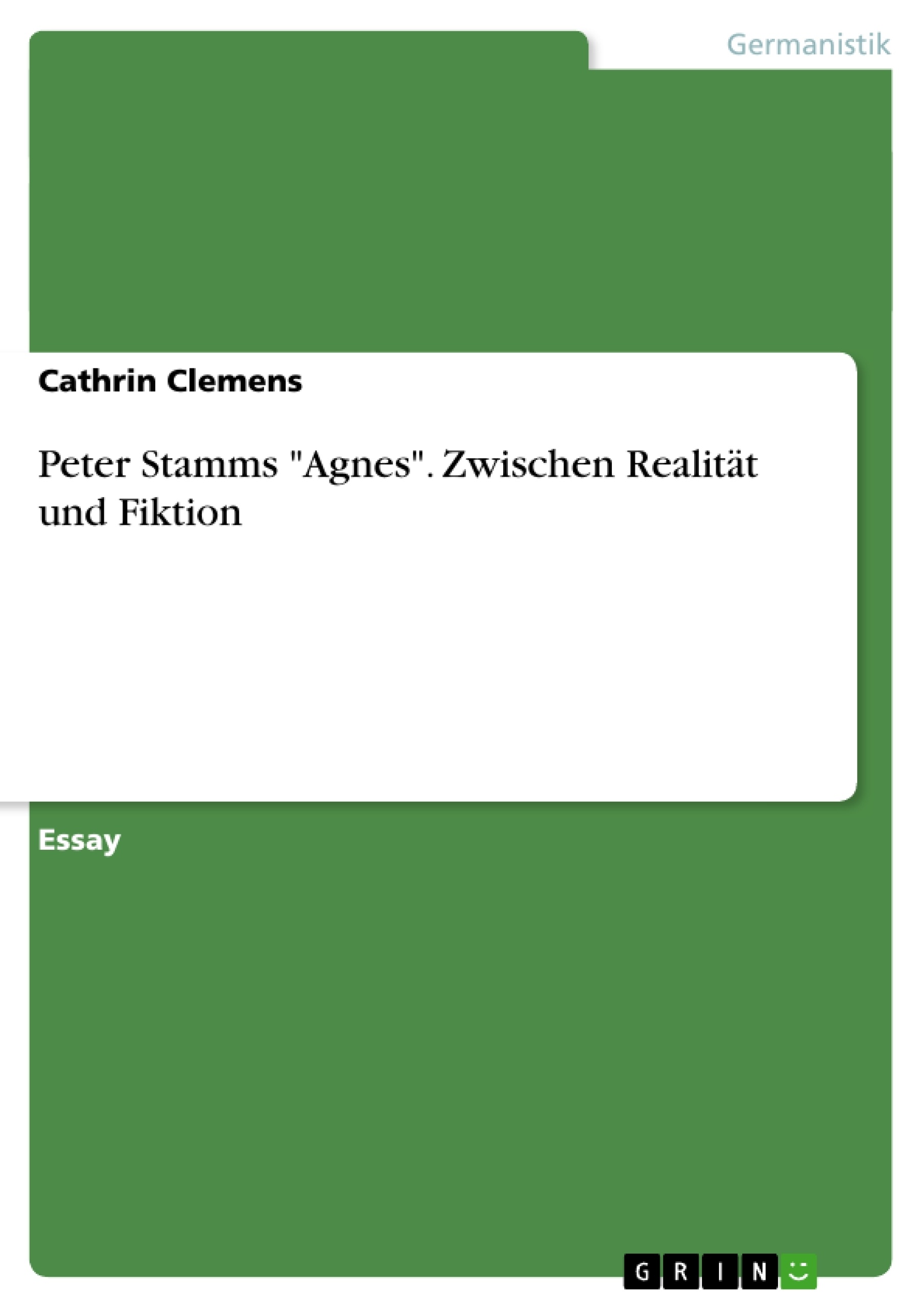Eine junge italienische Mutter stand unter dem Verdacht ihren dreijährigen Sohn
ermordet zu haben. Zuletzt gelesen hatte sie in dem Buch Agnes von Peter Stamm.
Darin hatte sie die folgenden Sätze unterstrichen: „Wie uns das Kind
auseinandergebracht hatte, führte sein Verlust uns wieder zusammen. Der Schmerz
verband uns enger, als uns das Glück verbunden hatte“. Stamm berichtete von diesen
Vorkommnissen in einem Zeitungsartikel und kommentierte jene unterstrichenen Sätze
mit den Worten: „Sätze, die ich geschrieben, die Francesca Gimelli übersetzt hatte und
die doch weder ihre noch meine Sätze waren. Es waren Sätze jener verzweifelten Frau,
Sätze, die für sie etwas bedeuteten, was ich nie gedacht hatte. Im Buch waren diese
Sätze eine Lüge, eine Fiktion in der Fiktion.“
Der Schweizer Autor äußert sich bewusst nicht zur Interpretation seiner Werke und
überlässt dem Leser die freie Obhut über seine Texte. Zeigt dabei das Beispiel der
italienischen Mutter nicht, wie viel Macht Peter Stamm trotz seines Schweigens über
die Gedanken seiner Leser besitzt? Und gleichzeitig wie machtlos er sich seinen
eigenen Sätzen hingeben muss, weil er nie sicher gehen kann, dass beim Leser die
gleichen Bilder geweckt werden wie bei ihm während des Schreibprozesses? Und
klingt nicht eine Art Kontrollverlust über die Figuren aus seinen Worten heraus? [...]
Inhaltsverzeichnis
1. Die Macht der geschriebenen Worte
2. Von der Besonderheit des Erzählens
3. Im virtuellen Raum
4. Verschwimmende Grenzen
5. Von Metaebene zu Metaebene
6. Literaturverzeichnis
1. Die Macht der geschriebenen Worte
Eine junge italienische Mutter stand unter dem Verdacht ihren dreijährigen Sohn ermordet zu haben. Zuletzt gelesen hatte sie in dem Buch Agnes von Peter Stamm. Darin hatte sie die folgenden Sätze unterstrichen: „Wie uns das Kind auseinandergebracht hatte, führte sein Verlust uns wieder zusammen. Der Schmerz verband uns enger, als uns das Glück verbunden hatte“[1]. Stamm berichtete von diesen Vorkommnissen in einem Zeitungsartikel und kommentierte jene unterstrichenen Sätze mit den Worten: „Sätze, die ich geschrieben, die Francesca Gimelli übersetzt hatte und die doch weder ihre noch meine Sätze waren. Es waren Sätze jener verzweifelten Frau, Sätze, die für sie etwas bedeuteten, was ich nie gedacht hatte. Im Buch waren diese Sätze eine Lüge, eine Fiktion in der Fiktion.“[2]
Der Schweizer Autor äußert sich bewusst nicht zur Interpretation seiner Werke und überlässt dem Leser die freie Obhut über seine Texte. Zeigt dabei das Beispiel der italienischen Mutter nicht, wie viel Macht Peter Stamm trotz seines Schweigens über die Gedanken seiner Leser besitzt? Und gleichzeitig wie machtlos er sich seinen eigenen Sätzen hingeben muss, weil er nie sicher gehen kann, dass beim Leser die gleichen Bilder geweckt werden wie bei ihm während des Schreibprozesses? Und klingt nicht eine Art Kontrollverlust über die Figuren aus seinen Worten heraus?
Die Macht der Literatur und die Herausforderungen des Schreibens werden in seinem 1999 erschienen Roman Agnes zum Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Auf seine ganz besondere Art und Weise beleuchtet Stamm durch seinen Erzählstil und durch die Installation mehrerer Erzählebenen wie sich Wirklichkeit und Fiktion vermischen können und wie viel Macht das geschriebene Wort ausüben kann.
2. Von der Besonderheit des Erzählens
Das Wesen der Worte ist eng gebunden an ihre Darstellung. Also gilt es zu fragen: Wie erzählt der Autor? Aber auch: Was erzählt der Erzähler?
Peter Stamm sah sich oft mit der Schlichtheit und Lakonie seiner Schreibweise konfrontiert. Dennoch gelingt es ihm mit seiner „Sprache, die in ihrer Kühle fast an den Bericht eines Wissenschaftlers erinnert“[3] in seinem Leser die Fantasie zu wecken, so dass ihm dieser treu bleibt. Diese Ökonomie des Erzählens spiegelt sich in der Struktur der Dialoge wider. Die Figuren reden oft aneinander vorbei, erklären ihren Themenwechsel nicht, genauso wie Stamm auch keine erklärenden Übergänge zwischen den episodenhaften Kapiteln schafft. Kurze Aussage- und Fragesätze, die durchgängige Verwendung von ‚sagte ich‘ und ‚sagte Agnes‘ ebenso ins Leere verlaufene Sätze in den Gesprächen unterstreichen nur noch mehr die Monotonie, den unterkühlten Eindruck und das Scheitern der Gefühle wie es sich inhaltlich abspielt und damit auf der stilistischen Ebene aufgegriffen wird. Doch auch trotz seiner schmucklosen Sprache, flicht Stamm geschickt Metaphern, Vergleiche und Motive in die Geschichte ein. Der „Wille zur Form“[4] ist es, der überzeugt. Am Ende ist es das Schweigen als Ausdruck gestörter Kommunikation, welches dem Tod vorauseilt.
Doch hat hier ein Autor nicht nur einen Roman geschrieben, er lässt genauso seine Hauptfigur schreiben, so dass der Erzähler der Geschichte ebenso zu einem Autor wird. Die Rahmenhandlung wird somit nicht nur durch eine Binnenhandlung, sondern auch durch eine Binnengeschichte gefüllt. So kommt es zu Verdoppelungen und der Existenz der Figuren auf mehreren Ebenen. Betrachtet man beispielsweise die Protagonisten Agnes so lässt diese sich in der fiktiven Realität (der erzählten Liebesgeschichte) genauso wie in der fiktiven Geschichte (der intradiegetischen Binnenerzählung) des Erzählers lokalisieren.[5]
Und so bietet sich die Gelegenheit den Akt des Schreibens, die Herausforderungen eines Schriftstellers, und seine Konsequenzen innerhalb des Romans zu thematisieren. Einen Akt, welcher –um die Illusion zu verstärken˗ in dem virtuellen Raum eines Computers stattfindet und der offenlegt wie wenig das von einem anderen Menschen verschriftlichte Bild einer Person mit der eigenen Wahrnehmung seiner Selbst und der Umstände übereinstimmt. Peter Stamm geht es dabei darum zu zeigen, „dass wir immer mit Bildern leben, die wir uns von Menschen machen, und dass wir auch im Kopf Menschen manipulieren und sie uns vorstellen und sie gar nicht mehr richtig sehen“[6]. Durch das Drehbuch der Liebesbeziehung werden Unstimmigkeiten der Erinnerungen und in der Wahrnehmung von Erlebnissen bei dem Erzähler und Agnes zu Tage gefördert. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung des Gemäldes von Seurat, wobei sie nicht nur sich selbst, sondern auch den jeweils anderen in unterschiedliche Figuren hineinprojizieren.[7]
[...]
[1] Stamm, Peter: Agnes, 2009, S.136 (im Folgenden zitiert unter dem Kürzel: Agnes).
[2] Stamm, Peter: Die meisten meiner Vorschläge waren einfach falsch, in: Der kleine Bund vom 04.05.2002, S.1-2.
[3] Nahaufnahme, in: DER SPIEGEL, Nr.43 vom 19.10.1998, S.259.
[4] Reinacher, Pia: Es zerstört die Phantasie die Liebe, in: Tages-Anzeiger vom 26.10.1998.
[5] Dreier, Ricarda: Literatur der 90er-Jahre in der Sekundarstufe II. Judith Hermann, Benjamin von Stuckrad-Barre und Peter Stamm, Hohengehren, 2005, S.102.
[6] Hoppe, Almut: Gespräch mit Peter Stamm über den Roman ‚Agnes‘, die Konstruktion des Ich-Erzählers, die Produktion und Wirkung von Literatur, in: Literatur im Unterricht, Nr.13/1, 2012, S.18.
[7] Rowinska-Januszweska, Barbara: Liebe, Tod und virtuelle Realität. Zum Roman Agnes von Peter Stamm, in: Komorowski, Dariusz (Hg.): Jenseits von Frisch und Dürrenmatt. Raumgestaltung in der gegenwärtigen Deutschschweizer Literatur, Würzburg, 2009, S.99-104.
- Quote paper
- Cathrin Clemens (Author), 2013, Peter Stamms "Agnes". Zwischen Realität und Fiktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272419