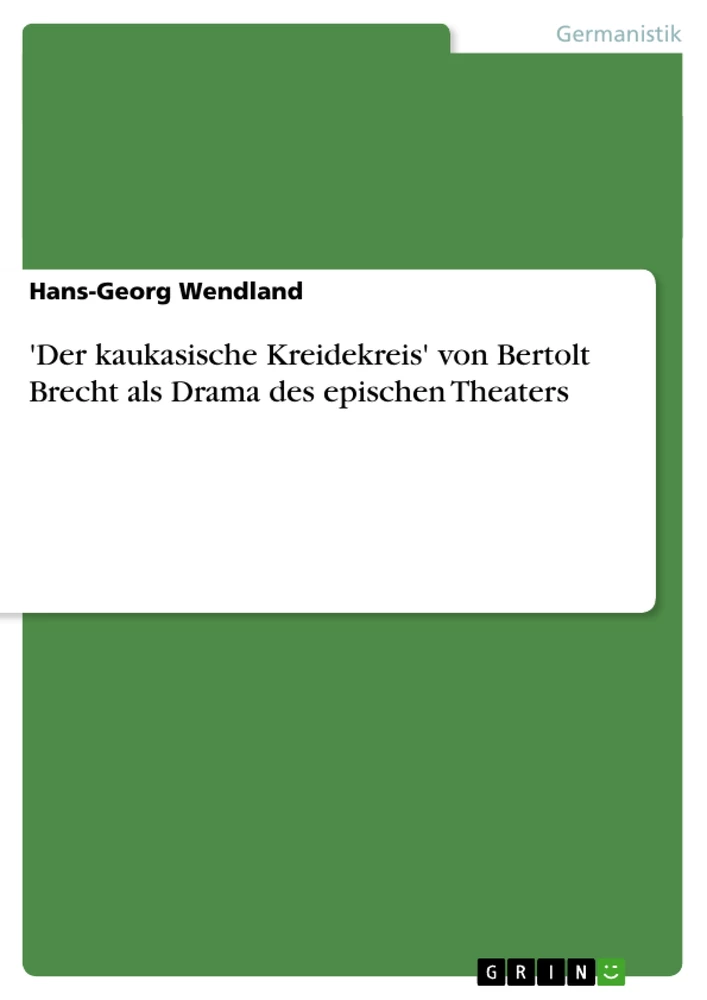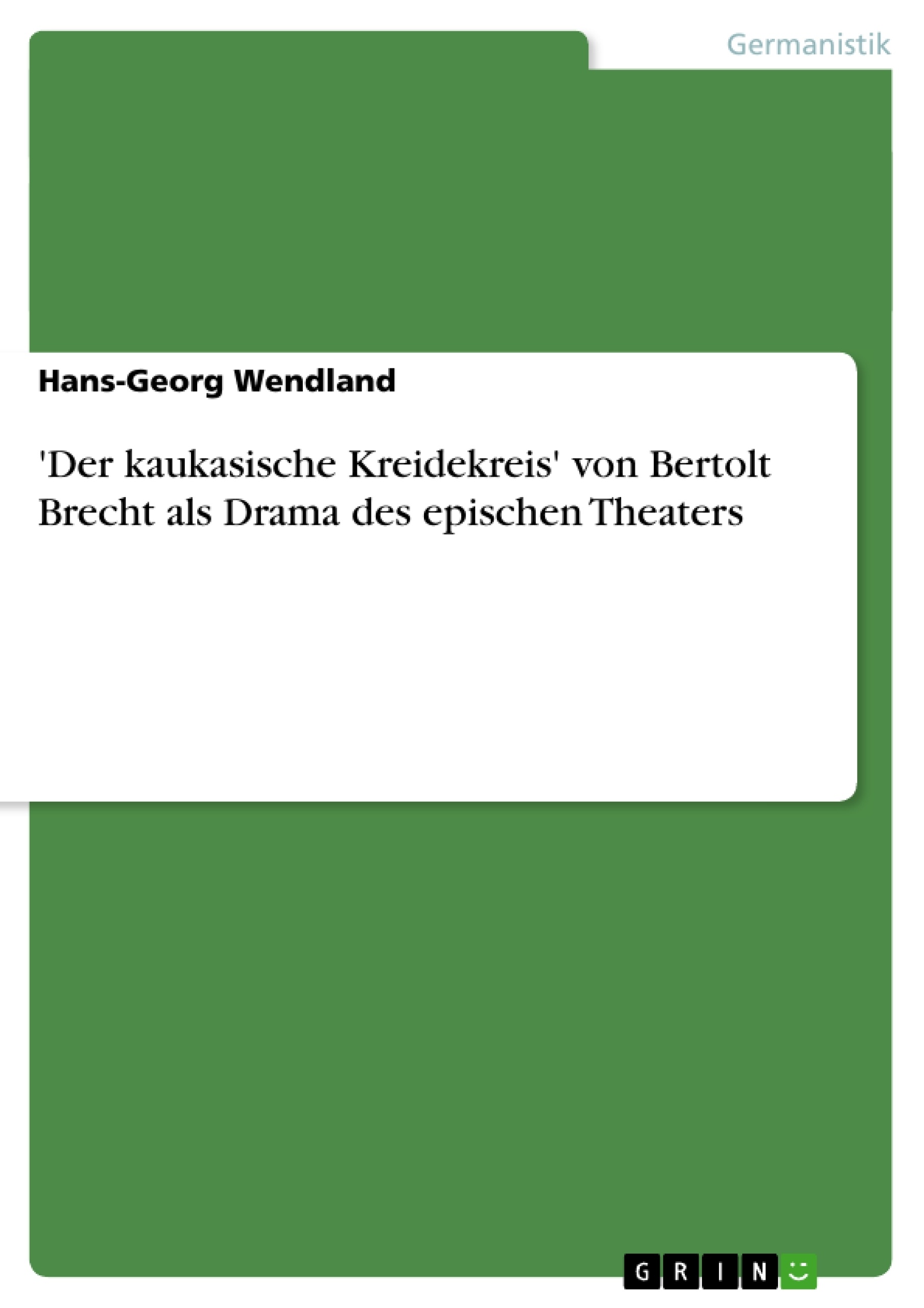"In alter Zeit, in blutiger Zeit ..." Mit diesen Worten eröffnet der Sänger Arkadi Tscheidse im ersten Akt von Bertolt Brechts Theaterstück "Der kaukasische Kreidekreis" seinen Bericht über ein Geschehen aus dem mittelalterlichen Grusinien (Georgien) , das sich in der Stadt Nukha am Südhang des östlichen Kaukasus abgespielt hat. Wie im Märchen wird der Zeitraum nur vage umrissen und bleibt ungewiss. Die Lebensverhältnisse in dieser Stadt werden durch das strenge Regiment des Gouverneurs Georgi Abaschwili bestimmt, der vom Sänger als grausame Herrscher- und Ausbeuterfigur, "reich wie der Krösus", vorgestellt wird. Die eigentliche Erzählung beginnt mit einer genaueren Zeitangabe: "An einem Ostersonntagmorgen ..." An diesem Ostersonntagmorgen begibt sich der Gouverneur in die Kirche und wird von seiner "aus edlem Geschlecht" stammenden Frau Natella sowie einem "kerngesunden Kind" namens Michel begleitet. Dieses Geschehen markiert den Ausgangspunkt zweier parallel verlaufender Handlungsstränge des Dramas (die Grusche-Handlung und die Azdak-Handlung), die aber nacheinander geschildert werden, und zwar so, dass das Geschehen nach der Grusche-Handlung zum Ausgangspunkt zurückkehrt, um dann mit der Azdak-Handlung neu anzusetzen. Beide Handlungsstränge werden im 5. Akt ("Der Kreidekreis") wieder zusammengeführt. Daher kann man mit Henning Rischbieter von einem "Doppel-Drama" sprechen.
Nach den knappen einführenden Worten des Sängers handelt es sich um eine Zeit voller Entbehrungen und Gewalt, die - wie der Leser / Zuschauer gleich darauf erfährt - durch einen gnadenlosen Macht- und Unterdrückungsapparat selbstherrlicher Feudalherren bestimmt wird, deren willige Vollstrecker, die Panzerreiter, zum lebenden Symbol dieses unmenschlichen Systems werden. Im Wechsel zwischen Sängervortrag und szenischer Darstellung erzählen die Akte 1 - 3 die Geschichte des Küchenmädchens Grusche Vachnadze, die sich mit dem Soldaten Simon Chachava verlobt hat, von ihm aber kurz darauf durch die Kriegswirren dieser unruhigen Zeit getrennt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Zum Inhalt und Aufbau des Stückes
- Grusche-Handlung (Akte 1-3)
- Azdak-Handlung (Akt 4)
- Kreidekreis-Probe (Akt 5)
- Vorspiel
- 2. Episches Erzählen
- Erzähler als Vermittler
- Erzählte Zeit und Erzählzeit
- Introspektives Erzählen
- Auktoriale Erzählperspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Bertolt Brechts "Der kaukasische Kreidekreis" im Kontext des epischen Theaters. Die Zielsetzung ist es, den Aufbau des Stückes, die Erzähltechnik und die zentralen Themen zu untersuchen und deren Bedeutung im Gesamtkontext zu beleuchten.
- Die Struktur des "Doppel-Dramas" und die parallelen Handlungsstränge
- Brechts epische Erzähltechnik und die Rolle des Erzählers
- Das Verhältnis von Gerechtigkeit und Recht im Stück
- Die Charakterisierung der zentralen Figuren (Grusche, Azdak, Natella)
- Die soziale und politische Kritik Brechts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Zum Inhalt und Aufbau des Stückes: Dieser Abschnitt beschreibt die komplexe Struktur des "Kaukasischen Kreidekreises" als "Doppel-Drama," bestehend aus der Grusche-Handlung (Akte 1-3) und der Azdak-Handlung (Akt 4), die im fünften Akt ("Der Kreidekreis") zusammenlaufen. Die Grusche-Handlung folgt dem Küchenmädchen Grusche, die das Kind des ermordeten Gouverneurs rettet und aufzieht. Die Azdak-Handlung konzentriert sich auf den korrupten, aber letztlich gerechten Richter Azdak. Das Vorspiel, angesiedelt im Nachkriegs-Kaukasus, dient als Rahmenhandlung und zeigt eine Gesellschaft, die produktives Verhalten über herkömmliche Besitzansprüche stellt, was einen Kontrast zum mittelalterlichen Setting des Hauptteils bildet. Der Abschnitt beleuchtet die Parallelen und Kontraste der beiden Haupthandlungsstränge und deren Bedeutung für das Gesamtverständnis des Stückes.
2. Episches Erzählen: Dieser Teil der Analyse konzentriert sich auf Brechts epische Erzähltechnik. Die Arbeit untersucht die Rolle des Erzählers als Vermittler zwischen dem Geschehen und dem Zuschauer, die flexible Handhabung von Erzählzeit und erzählter Zeit, inklusive Rückblenden und Vorausdeutungen. Die Analyse beleuchtet verschiedene Erzählperspektiven, insbesondere die auktoriale Perspektive des allwissenden Sängers, der sich gelegentlich direkt an das Publikum wendet, um dessen Urteil herauszufordern. Die Verwendung introspektiver Erzählformen wie erlebte Rede und innerer Monolog wird ebenfalls untersucht. Die Untersuchung hebt hervor, wie diese Erzähltechniken die epische Distanz und die kritische Distanzierung des Zuschauers fördern, welche kennzeichnend für Brechts episches Theater sind.
Häufig gestellte Fragen zu Bertolt Brechts "Der kaukasische Kreidekreis"
Was ist der Inhalt des HTML-Dokuments?
Das HTML-Dokument bietet eine umfassende Vorschau auf eine wissenschaftliche Arbeit über Bertolt Brechts "Der kaukasische Kreidekreis". Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und die wichtigsten Themen der Analyse, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Analyse des epischen Erzählens und der Struktur des Stücks.
Welche Kapitel werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt im Wesentlichen zwei Kapitel: "1. Zum Inhalt und Aufbau des Stückes" und "2. Episches Erzählen". Das erste Kapitel beschreibt die komplexe Struktur des "Doppel-Dramas" mit den Handlungssträngen um Grusche und Azdak sowie das Vorspiel. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf Brechts epische Erzähltechnik, die Rolle des Erzählers, die Erzählperspektiven und die Verwendung von Erzählzeit und erzählter Zeit.
Was ist die Zielsetzung der Analyse?
Die Analyse zielt darauf ab, den Aufbau von Brechts "Der kaukasische Kreidekreis", seine Erzähltechnik und die zentralen Themen des Stücks zu untersuchen und deren Bedeutung im Gesamtkontext zu beleuchten. Besondere Aufmerksamkeit wird der Struktur des "Doppel-Dramas", Brechts epischer Erzähltechnik, dem Verhältnis von Gerechtigkeit und Recht, der Charakterisierung der Hauptfiguren und der sozialen und politischen Kritik Brechts gewidmet.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Analyse behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Struktur des "Doppel-Dramas" und die parallelen Handlungsstränge, Brechts epische Erzähltechnik und die Rolle des Erzählers, das Verhältnis von Gerechtigkeit und Recht im Stück, die Charakterisierung der zentralen Figuren (Grusche, Azdak, Natella) und die soziale und politische Kritik Brechts.
Wie wird die Struktur des Stückes beschrieben?
Das Stück wird als "Doppel-Drama" beschrieben, bestehend aus der Grusche-Handlung (Akte 1-3), der Azdak-Handlung (Akt 4) und dem zusammenführenden fünften Akt ("Der Kreidekreis"). Das Vorspiel dient als Rahmenhandlung. Die Analyse beleuchtet Parallelen und Kontraste zwischen den Handlungssträngen.
Wie wird Brechts epische Erzähltechnik beschrieben?
Die Analyse untersucht die Rolle des Erzählers als Vermittler, die flexible Handhabung von Erzählzeit und erzählter Zeit (inklusive Rückblenden und Vorausdeutungen), verschiedene Erzählperspektiven (insbesondere die auktoriale Perspektive), und den Einsatz introspektiver Erzählformen. Der Fokus liegt auf der Förderung der epischen Distanz und der kritischen Distanzierung des Zuschauers.
Welche Figuren werden im Dokument erwähnt?
Die zentralen Figuren, deren Charakterisierung analysiert wird, sind Grusche, Azdak und Natella.
- Quote paper
- Hans-Georg Wendland (Author), 2014, 'Der kaukasische Kreidekreis' von Bertolt Brecht als Drama des epischen Theaters, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272394