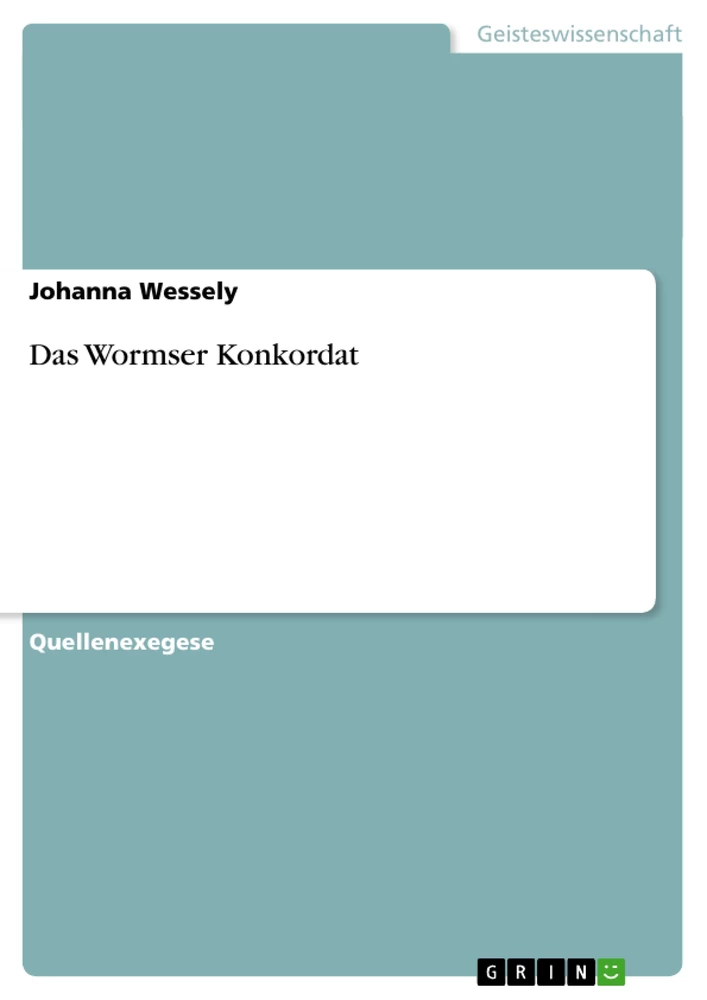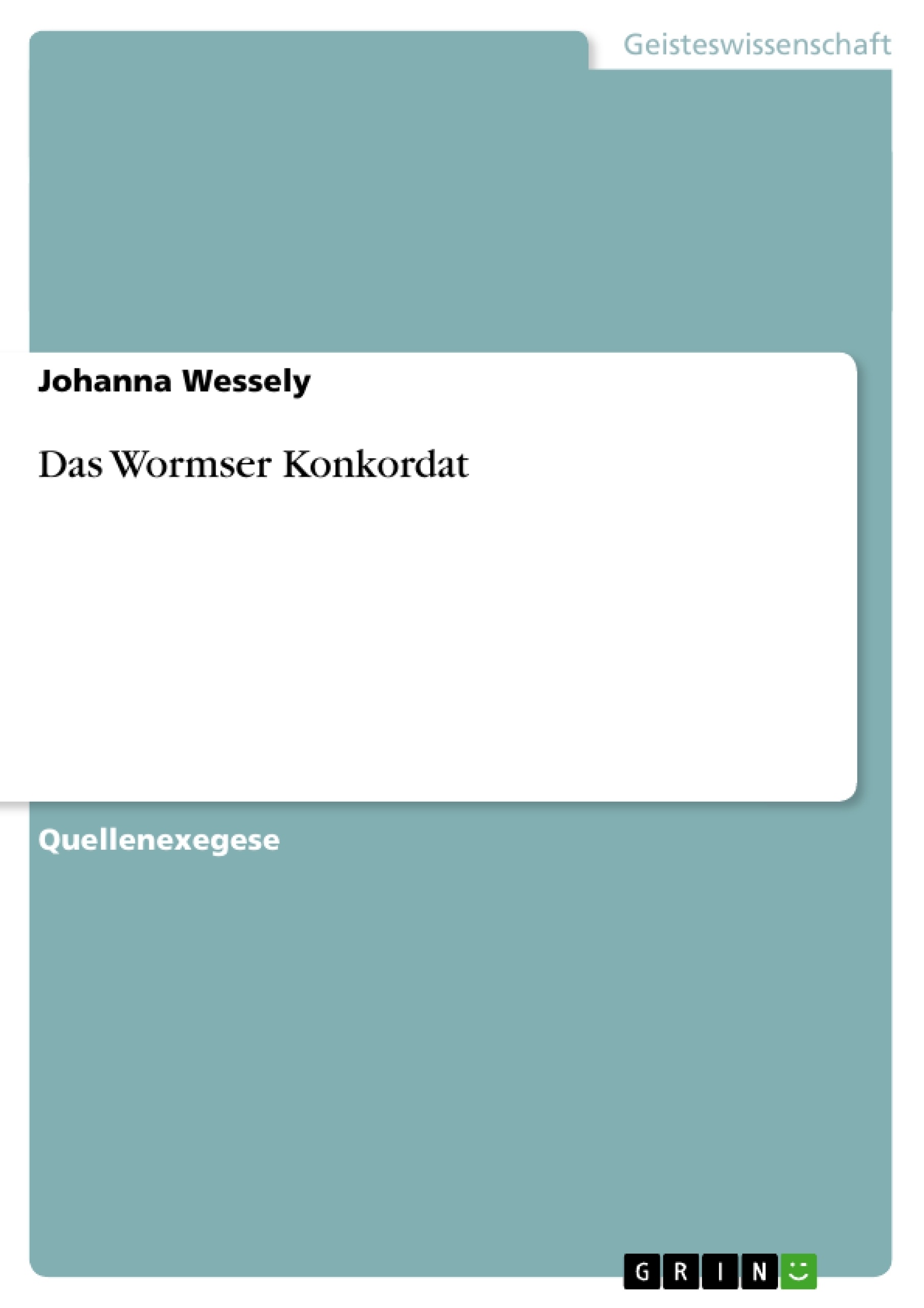Diese Quellenanalyse beschäftigt sich mit dem Wormser Konkordat: Dabei wird zum einen auf die kaiserliche Urkunde von Heinrich V. ("Pactum Calixtinum sive Heinricianum") eingegangen, und auf der anderen Seite werden Informationen zu Heinrich V. gegeben: zu seinem Leben, seinem Handeln und den Hintergründen.
In dieser vorliegenden Quellenanalyse wird es um das Wormser Konkordat gehen. Dabei wird die kaiserliche Urkunde von Heinrich V. analysiert, das sogenannte Pactum Calixtinum sive Heinricianum.
Zunächst einige Informationen zu Heinrich V., seinem Leben, Handeln und dessen Hintergründen.
Der römisch-deutsche Kaiser ist am 11.08.1081 oder aber am 11.08.1086 geboren worden, genau kann man das nicht sagen, da es für beide Jahreszahlen Quellen gibt, die jeweils für das eine bzw. das andere Datum sprechen. Gestorben ist er am 23. Mai 1125 in Utrecht. Er ist das fünfte Kind von Kaiser Heinrich IV. und Bertha von Turin gewesen und ist der Nachfolger von seinem Vater geworden, nachdem der eigentliche Nachfolger, sein Bruder Konrad, 1093 in das päpstliche Lager gewechselt ist. Seit dem Jahre 1099 ist er Mitkönig gewesen, nachdem er am 06.01.1099 in Aachen vom Kölner Erzbischof Hermann III. dazu ernannt worden ist. Ab 1106 ist er dann König gewesen und 1111 ist es dann schließlich zur Kaiserkrönung gekommen. Am 06.01.1114 hat er dann die 12-jährige Königstochter Mathilde in Mainz geheiratet, diese Ehe ist allerdings kinderlos geblieben.
Charakterlich lässt sich sagen, dass Heinrich V. zwei Gesichter gehabt hat. Auf der einen Seite war er süchtig nach Macht und hat auch nicht davor zurückgescheut, Gewalt anzuwenden, um seine Ziele durchzusetzen. So hat er zum Beispiel auch seinen Vater gefangen genommen, um dessen Abdankung zu erzwingen, damit er alleine König und somit Herrscher sein konnte. Dies ist im Jahre 1105 geschehen. Auf der anderen Seite ist er auch durchaus zu Kompromissen bereit gewesen, was durch das Wormser Konkordat zu erkennen ist. Mit diesem Konkordat hat Heinrich V. es geschafft, den seit Jahrzehnten herrschenden Investiturstreit zwischen Kaiser und Papsttum beizulegen.
Bei dem Wormser Konkordat handelt sich um eine Urkunde und somit um einen Vertrag zwischen dem Papst Calixt II. und dem römisch-deutschen Kaiser Heinrich V., welcher am 23. September 1122 in Worms veröffentlicht worden ist.
Die Intention dabei ist die Beilegung des Investiturstreits gewesen und das Verzichten des Kaisers auf Investitur mit Ring uns Stab, sprich die Einsetzung von Bischöfen in das Amt. Zudem ist es um die Gewährleistung von der Wahlfreiheit der Investitur jeder Kirche gegangen.
Bevor näher auf die Urkunde, deren Inhalt und Auswirkungen eingegangen wird, kann zunächst der historische Hintergrund näher betrachtet, und die Frage, was unter einem Investiturstreit zu verstehen ist, beantwortet werden.
Allgemein lässt sich sagen, dass es sich bei einem Investiturstreit um einen Konflikt zwischen der geistlichen und der weltlichen Macht um die Amtseinsetzung Geistlicher handelt. Es sind zwei Seiten entstanden, die sich gegenübergestanden sind und beide sind davon ausgegangen, dass sie über der jeweils anderen Seite stehen. Die Namensgebung lässt sich aus dem Lateinischen herleiten: investire = bekleiden. Bei der Investitur geht es um den Akt der symbolischen Verleihung eines Lehns oder bestimmten Rechts.
Der genaue Anfangspunkt dieses Streits ist allerdings schwer zu bestimmen, denn es ist eher als eine Bewegung zu sehen und nicht als ein bestimmtes Ereignis. Aber man kann ihn in etwa um die Zeit Gregor VII. einordnen, da zu dieser Zeit die Situation eskaliert ist. Vor seiner Zeit hat es eine große Einflussnahme seitens der deutschen Könige in geistliche Belange gegeben.
Am Anfang hat es ein sogenanntes Reichskirchensystem gegeben. Dabei hat man den Herrscher als Stellvertreter Gottes angesehen, welcher die Kirche mit einbeziehen kann. Hierbei liegt es in der Macht des Königs oder des Kaisers, Bischöfen besondere Rechte zu verleihen. Das Bestreben ist darin zu sehen, dass die Geistlichen ohne Ehe lebten und es somit nach dessen Tod keine Erben gegeben hat. Somit sind Lehen und Ämter dem König/ Kaiser wieder zugefallen. Damit dieses Reichskirchensystem auch funktionieren kann, müssen verschiedene Faktoren beachtet und eingehalten werden. Zum Einen muss das Papsttum einverstanden damit sein, er hat sich dem Herrscher unterzuordnen. Zum Anderen muss der König im Besitz von uneingeschränktem Recht der Investitur sein, sprich Geistliche seiner Wahl einsetzen und ernennen.
Allerdings ist es schließlich im 11. Jahrhundert zu einer Reformbewegung der Kirche und somit zu einer Stärkung des Papsttums gekommen. Hiermit ist das Reichskirchensystem zunichte gemacht, denn diese beiden Ansichten sind nicht mehr miteinander zu vereinbaren.
Die Reformbewegung hat ein Verbot für Priesterehen und das Simonieverbot, also das Verbot von Ämterkauf, mit sich gebracht, und somit dafür gesorgt, dass der Status des Herrschers angegriffen ist.
[...]
- Quote paper
- Johanna Wessely (Author), 2012, Das Wormser Konkordat, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/272367