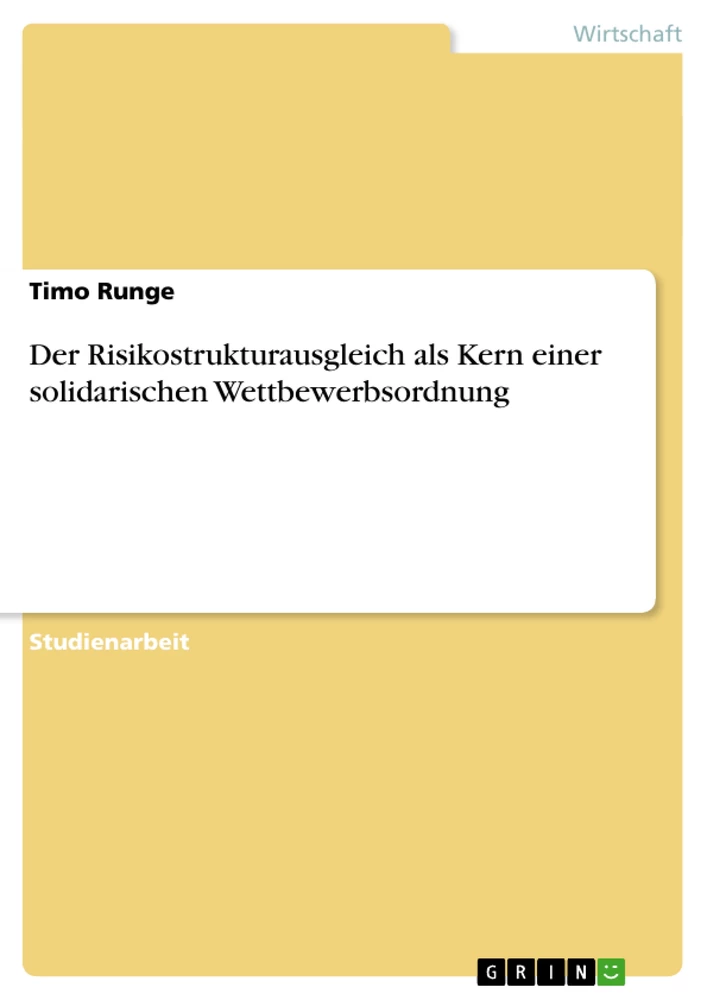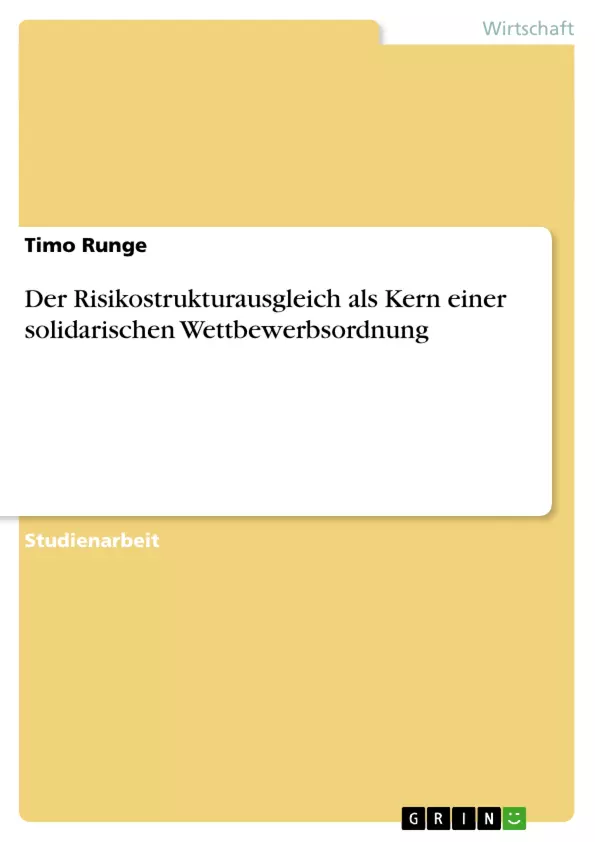Mit dem Gesundheitsstrukturgesetz (GSG) vom 01.01.1992 wurde nach einer Reihe unterschiedlicher
Kostendämpfungsgesetze der Versuch unternommen, eine stärkere Wettbewerbsund
Leistungsorientierung im Gesundheitswesen zu implementieren. Primäres Ziel war es
hierbei Anreize für die gesetzlichen Krankenkassen zu schaffen, qualitativ hochwertige Gesundheitsleistungen
bei gleichzeitig effizienter und effektiver Faktorallokation zu erbringen.1 Allerdings führt eine Organisation eines wettbewerbsorientierten Gesundheitswesens als „laissez faire“ durch Informationsasymmetrien zu einer Risikoselektion seitens der Krankenkassen und somit zu Allokations- und Distributionsproblemen. Daher bedarf es eines wettbewerblichen
Ordnungsrahmens, der vor dem Hintergrund des Solidarprinzips Wettbewerbsverzerrungen
verhindert und gleichzeitig Anreize zur Risikoselektion begrenzt.2 In diesem Kontext
bildet der Risikostrukturausgleich (RSA) als konstitutives und dauerhaftes Element den
Kern einer solidarischen Wettbewerbsordnung, die Effizienz und Effektivität im Gesundheitswesen
fördert und gleichzeitig den Solidaritätsgedanken wahrt. Im Folgenden soll nun zunächst dargestellt werden, welche Gestaltungsprinzipien einer solidarischen Wettbewerbsordnung in der GKV zu Grunde liegen und welche Ziele mit einem
regulierten Wettbewerb verfolgt werden. Anschließend wird der RSA als das zentrale Element
einer solidarischen Wettbewerbsordnung in seinen Grundzügen skizziert und des Weiteren
erörtert, warum der zum 01.01.1994 in Kraft getretene RSA in seiner originären Form
nicht zu der erhofften Erfüllung sämtlicher mit ihm verbundenen Ziele geführt hat. Aus dieser
Reformnotwendigkeit heraus wird die Neugestaltung des RSA aus dem Jahre 2001 erläutert
und einer kritischen Betrachtung unterzogen. Anschließend werden in knapper Form zusätzliche
Erweiterungsvorschläge bzgl. einer „verbesserten“ Ausgestaltung des solidarischen Wettbewerbs
kurz skizziert. 1 Vgl. Pfaff, M.; Wassener, D., (Bedeutung), 1998, S. 9 und Kasper, S., (Der Risikostrukturausgleich), 2002, S. 1 bzw. Cassel, D.; Janssen, J., (Wettbewerbssichernden), 1999, S. 11 2 Vgl. Kasper, S., (Der Risikostrukturausgleich), 2002, S. 1-2
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die solidarische Wettbewerbsordnung in der GKV
- Gestaltungsprinzipien
- Solidaritätsprinzip
- Wettbewerbsprinzip
- Wettbewerb vor dem Hintergrund des Solidaritätsprinzips
- Gestaltungsprinzipien
- Der Risikostrukturausgleich
- Ziele des RSA
- Funktionen des RSA
- Wettbewerbssichernde Funktionen
- Solidaritätssichernde Funktionen
- Ausgestaltung des RSA
- Neugestaltung des Risikostrukturausgleichs
- Anlass der Reform
- Beseitigung von Anreizen zur Risikoselektion
- Anreize zu Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitssteigerungen in der Leistungserbringung
- Darstellung der Neuregelung
- Disease-Management-Programme
- Risikopool
- Morbiditätsorientierung
- Kritik an der Neuregelung
- Anlass der Reform
- Erweiterungsbedarf auf dem Weg zu einer solidarischen Wettbewerbsordnung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Risikostrukturausgleich (RSA) als zentralem Element einer solidarischen Wettbewerbsordnung in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Sie analysiert die Gestaltungsprinzipien einer solchen Ordnung, beleuchtet die Ziele und Funktionen des RSA und untersucht die Neugestaltung des RSA im Jahr 2001.
- Die Gestaltungsprinzipien einer solidarischen Wettbewerbsordnung in der GKV
- Die Ziele und Funktionen des Risikostrukturausgleichs
- Die Neugestaltung des RSA im Jahr 2001
- Kritik an der Neuregelung
- Erweiterungsbedarf auf dem Weg zu einer solidarischen Wettbewerbsordnung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Risikostrukturausgleichs für die GKV im Kontext des Gesundheitsstrukturgesetzes (GSG) heraus. Sie verdeutlicht, dass ein wettbewerbsorientierter Gesundheitsmarkt ohne Regulierung zu Problemen wie Risikoselektion und Allokations- und Distributionsproblemen führen kann. Der Risikostrukturausgleich wird als Kern einer solidarischen Wettbewerbsordnung präsentiert, die Effizienz und Effektivität im Gesundheitswesen fördert und gleichzeitig den Solidaritätsgedanken wahrt.
Kapitel 2 analysiert die Gestaltungsprinzipien einer solidarischen Wettbewerbsordnung in der GKV, insbesondere das Solidaritäts- und das Wettbewerbsprinzip. Es beschreibt, wie diese Prinzipien im Kontext der GKV Anwendung finden und welche sozialpolitischen Umverteilungsprozesse sich aus dem Solidaritätsprinzip ergeben.
Kapitel 3 beleuchtet den Risikostrukturausgleich (RSA) als zentrales Element einer solidarischen Wettbewerbsordnung. Es stellt die Ziele und Funktionen des RSA, sowohl im Hinblick auf die Sicherung des Wettbewerbs als auch die Wahrung von Solidarität, dar. Darüber hinaus wird die ursprüngliche Ausgestaltung des RSA und die Problematik seiner Effektivität beschrieben.
Kapitel 4 befasst sich mit der Neugestaltung des RSA aus dem Jahr 2001. Es beschreibt die Reformnotwendigkeit, die Ursachen für die Reform und die Kernpunkte der Neuregelung. Die Darstellung der Neuregelung beinhaltet die Einführung von Disease-Management-Programmen, die Gestaltung des Risikopools und die verstärkte Orientierung am Morbiditätsgrad. Darüber hinaus wird die Neuregelung kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Solidarische Wettbewerbsordnung, Risikostrukturausgleich (RSA), Gesundheitsstrukturgesetz (GSG), Gesetzliche Krankenversicherung (GKV), Solidaritätsprinzip, Wettbewerbsprinzip, Risikoselektion, Effizienz, Effektivität, Disease-Management-Programme, Risikopool, Morbiditätsorientierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Risikostrukturausgleich (RSA) in der GKV?
Der RSA ist ein Finanzausgleichsmechanismus zwischen den gesetzlichen Krankenkassen, der verhindern soll, dass Kassen mit kränkeren Versicherten finanzielle Nachteile haben.
Warum ist der RSA für den Wettbewerb wichtig?
Er verhindert die sogenannte Risikoselektion (Cherry-Picking), bei der Kassen nur versuchen, junge und gesunde Mitglieder anzuwerben, statt über Qualität und Effizienz zu konkurrieren.
Was bedeutet Morbiditätsorientierung im RSA?
Es bedeutet, dass die Zuweisungen an die Krankenkassen nicht nur nach Alter und Geschlecht, sondern auch nach dem tatsächlichen Gesundheitszustand (Krankheiten) der Versicherten berechnet werden.
Welche Rolle spielen Disease-Management-Programme (DMP)?
DMPs sind strukturierte Behandlungsprogramme für chronisch Kranke, deren Einführung durch Reformen des RSA gefördert wurde, um die Versorgungsqualität zu verbessern.
Was ist das Solidaritätsprinzip in der GKV?
Es besagt, dass die Beiträge nach der finanziellen Leistungsfähigkeit (Einkommen) erhoben werden, die Leistungen aber nach dem medizinischen Bedarf erfolgen, unabhängig vom Beitrag.
- Quote paper
- Timo Runge (Author), 2004, Der Risikostrukturausgleich als Kern einer solidarischen Wettbewerbsordnung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27200