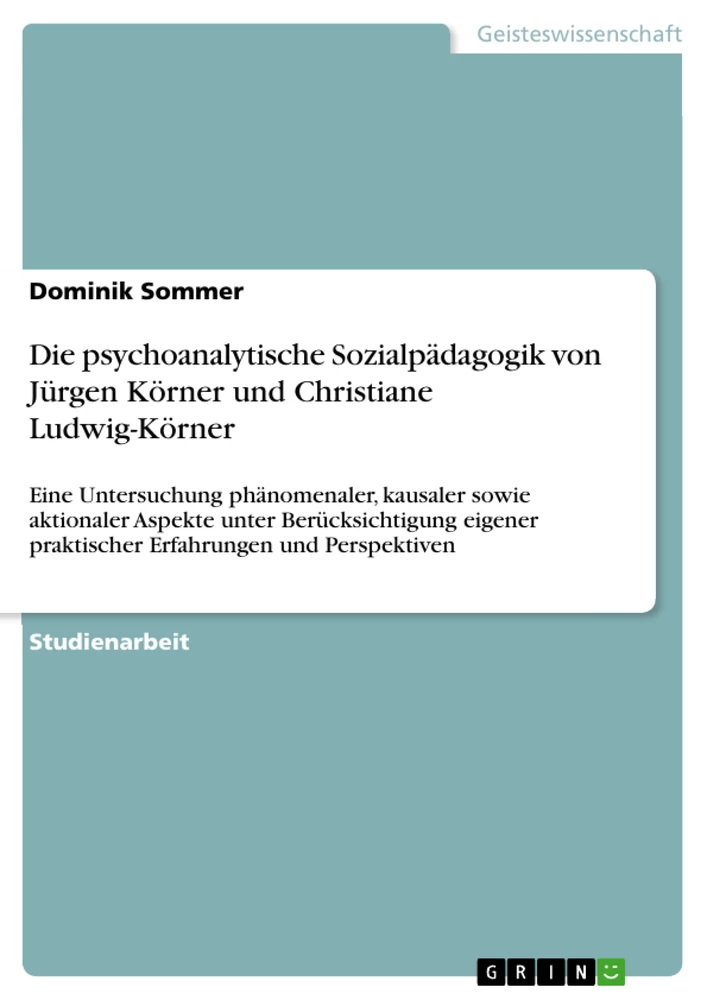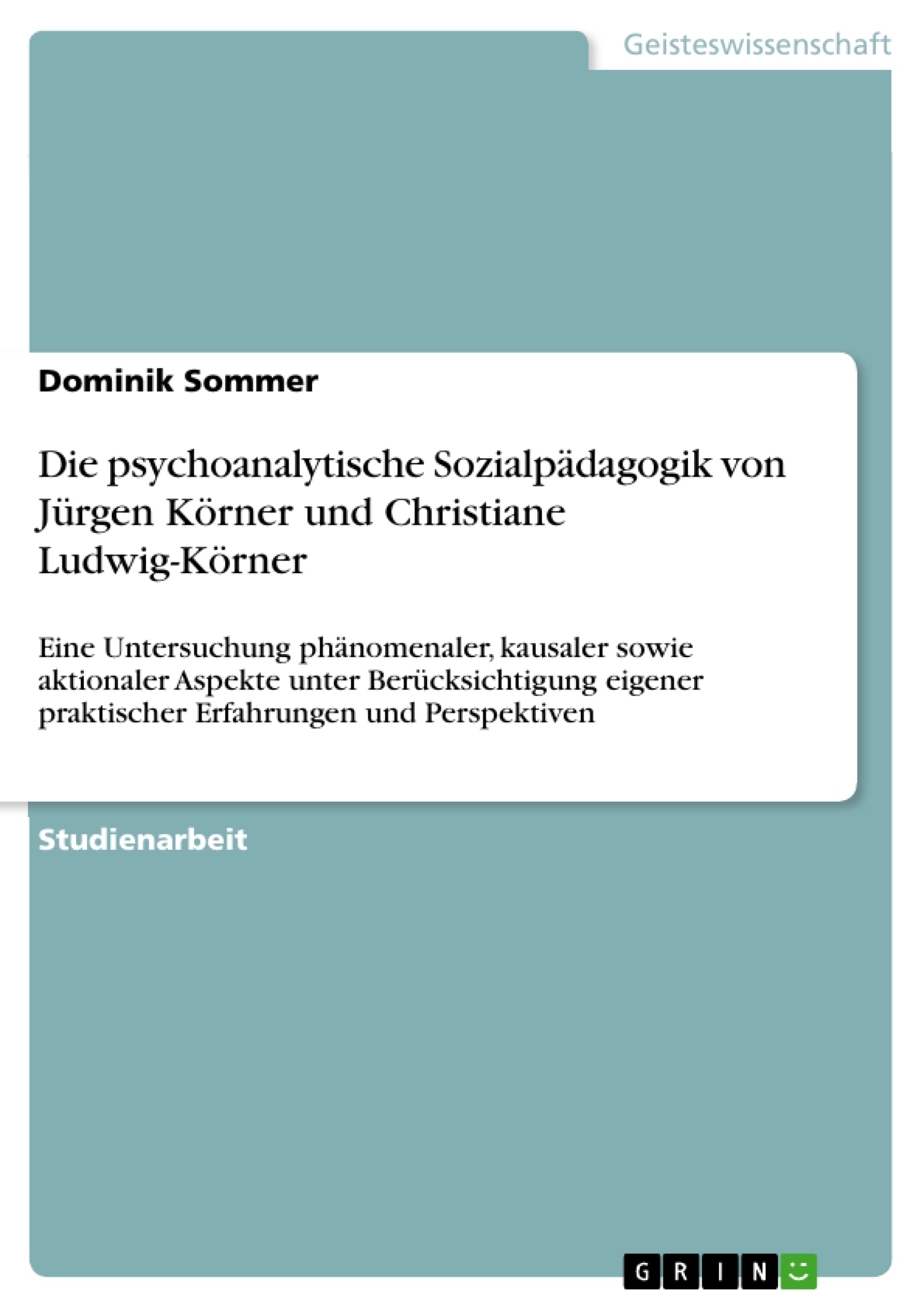Jürgen Körner und Christiane Ludwig-Körner legen mit ihrem 1997 erschienen Buch „Psychoanalytische Sozialpädagogik. Eine Einführung in vier Fallgeschichten“ eine grundsätzliche Hinführung an eine psychoanalytisch orientierte Ausrichtung sozialer Arbeit mit theoretischer Fundierung vor. An vier Fallbeispielen werden der theoretische wie auch der praktische Gehalt psychoanalytischer Gestaltungsmöglichkeiten in der sozialen Arbeit dargestellt. Bemerkenswert ist bei der Ausführung des Buches die innere logische Kohärenz: Die drei von den Autoren vorgestellten Modelle menschlichen Verhaltens (Maschinenmodell/ Handlungsmodell/ Erzählermodell) korrelieren stark mit den nach Körner und Ludwig-Körner drei möglichen Zugängen des Pädagogen zum inneren Konflikt des Klienten (Ursache des Beratungsgesprächs/ aktuelle sozialpädagogische Beziehung zwischen Klientin und Pädagogin/ Lebensgeschichte des Klienten) sowie mit dem praktischen Umgang des Pädagogen in der Arbeit mit dem Klienten (quasi-kausal erklärend/ intentional beschreibend/ hermeneutisch verstehende Zugangsmöglichkeiten).
1.1.2 Vorstellung des Analyseinstruments
Es soll hier vorausgesetzt werden, dass jede Theorie, so auch die hier untersuchte, Beschreibungs-, Erklärungs- und Handlungswissen produziert. Darauf aufbauend wähle ich als Methode und Werkzeug zur Untersuchung der von mir gewählten psychoanalytischen Theorie sozialer Arbeit folgende, in Kleve/ Wirth (2009: 129ff.) vorgeschlagene Systematisierung: Die Unterscheidung zwischen phänomenalen (also beschreibenden), kausalen (also der theorieeigenen Art, Ursache-Wirkungsbeziehungen herzustellen) und aktionalen (also der vermittelten Handlungsempfehlungen und ihre Brauchbarkeit betrachtenden) Theorieebenen.
Dabei folgt die Analyse des Beschreibungswissens der Frage, was die psychoanalytischen Termini in der vorliegenden Theorie beschreiben. Die Analyse des Begründungswissen folgt den Fragen, welche Erklärungen vorgetragen werden, welche Ursache-Wirkungen-Zusammenhänge es gibt. Wie begründet diese Theorie sich selbst und damit ihre eigene Wirksamkeit und Wichtigkeit (Legitimität); wie werden die axiomatischen Grundannahmen und Grundbegriffe begründet und erklärt? Die Analyse des Handlungswissens zeigt abschließend Handlungsoptionen für die sozialarbeiterische Praxis auf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Vorstellung des Analyseinstruments
- Einleitung: Psychoanalytische Pädagogik an vier Beispielen
- Vorstellung des Analyseinstruments
- Die Phänomenologie der psychoanalytischen Sozialarbeit
- Die Kausalität der psychoanalytischen Sozialarbeit
- Psychoanalytisches Handlungswissen im Ansatz der psychoanalytischen Sozialarbeit
- Eigene Erfahrungen mit und Perspektiven der psychoanalytischen Sozialarbeit im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens für HIV/ Hepatitis C infizierte Menschen mit psychischen Auffälligkeiten
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die psychoanalytische Sozialpädagogik anhand des Buches „Psychoanalytische Sozialpädagogik. Eine Einführung in vier Fallgeschichten" von Jürgen Körner und Christiane Ludwig-Körner. Die Arbeit analysiert die Phänomenologie, Kausalität und Handlungswissen des Ansatzes unter Berücksichtigung eigener praktischer Erfahrungen im Bereich des Betreuten Einzelwohnens für HIV/Hepatitis C-infizierte Menschen mit psychischen Auffälligkeiten.
- Übertragungsphänomene in der psychoanalytischen Sozialarbeit
- Die Bedeutung des Unbewussten in der psychoanalytischen Theorie sozialer Arbeit
- Die Rolle des „Rahmens der Situation" in der psychoanalytischen Pädagogik
- Psychoanalytisches Handlungswissen und Abstinenz des Sozialpädagogen
- Anwendung der psychoanalytischen Theorie in der Praxis des Betreuten Einzelwohnens
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die psychoanalytische Sozialpädagogik nach Körner und Ludwig-Körner ein und stellt das Analyseinstrument vor. Es werden die drei von den Autoren vorgestellten Modelle menschlichen Verhaltens (Maschinenmodell, Handlungsmodell, Erzählermodell) erläutert, die mit den drei möglichen Zugängen des Pädagogen zum inneren Konflikt des Klienten (Ursache des Beratungsgesprächs, aktuelle sozialpädagogische Beziehung zwischen Klientin und Pädagogin, Lebensgeschichte des Klienten) korrelieren. Die drei Modelle werden in der praktischen Arbeit des Pädagogen mit dem Klienten (quasi-kausal erklärend, intentional beschreibend, hermeneutisch verstehend) angewendet.
Das zweite Kapitel behandelt die Phänomenologie der psychoanalytischen Sozialarbeit. Übertragung und Gegenübertragung werden als zentrale Begrifflichkeiten beschrieben. Das Konzept der Übertragung wird anhand der drei Dimensionen (erklärende, zielgerichtete und gemeinsame Interpretation) beleuchtet. Die psychoanalytische Theorie sozialer Arbeit beschreibt individuelle Prozesse der Veränderung, die durch die Bewusstmachung von unbewussten Konflikten ermöglicht werden. Der „Rahmen der Situation" wird als ein egalitärer, dialogisch geteilter Raum zwischen Klient und Pädagogen definiert, in dem Übertragungen akzeptiert und bearbeitet werden können.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Kausalität der psychoanalytischen Sozialarbeit. Die Ursache-Wirkungszusammenhänge beruhen auf der Annahme des Primats des Unbewussten. Menschliches Konflikt- und Fehlverhalten wird aus unbewussten Konflikten erklärt, die ihren Ausdruck in Übertragungsverhalten finden. Die psychoanalytische Pädagogik thematisiert die „ungemerkte Rückwärtsgewandtheit" als Ursache für soziale oder materielle Probleme. Die emotionale Prägung der frühkindlichen Entwicklung spielt eine zentrale Rolle in der Entstehung von Übertragungsprozessen.
Das vierte Kapitel beleuchtet das psychoanalytische Handlungswissen im Ansatz der psychoanalytischen Sozialarbeit. Das Wissen um die Bedeutung unbewusster Übertragungsprozesse ermöglicht dem Sozialpädagogen Reflexionsmöglichkeiten zur eigenen Interaktion sowie zu den Aktionen des Klienten. Der psychoanalytische Ansatz zielt auf eine antiautoritäre pädagogische Haltung, die ein auf egalitäres Aushandeln gestütztes Hilfemodell vertritt. Die psychoanalytische Pädagogik strebt nach einer „schwebende Haltung" des Sozialpädagogen, die den Klienten zur Integration von subjekthaftem Entwurf und sozialem Ereignis anregt.
Das fünfte Kapitel beschreibt die eigenen Erfahrungen mit und Perspektiven der psychoanalytischen Sozialarbeit im Rahmen des Betreuten Einzelwohnens. Die psychoanalytische Theorie sozialer Arbeit bietet Handlungs- und Reflexionsperspektiven für die Arbeit mit HIV/Hepatitis C-infizierten Menschen mit psychischen Auffälligkeiten. Der Einsatz der psychoanalytischen Theorie ermöglicht die Analyse von Übertragungen und Gegenübertragungen, den Aufbau eines starken Arbeitsbündnisses sowie die Bewusstmachung intrapsychischer Konflikte des Klienten. Die Arbeit am „Rahmen der Situation" und die darauf aufbauende Reflexion innerpsychischer Konflikte können neue Stadien in der Betreuungsbeziehung einleiten.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die psychoanalytische Sozialpädagogik, Übertragung und Gegenübertragung, das Unbewusste, den „Rahmen der Situation", die Bewusstmachung intrapsychischer Konflikte und die Anwendung der psychoanalytischen Theorie in der Praxis des Betreuten Einzelwohnens. Die Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der psychoanalytischen Sozialpädagogik nach Körner und Ludwig-Körner und deren Anwendung in der Praxis der sozialen Arbeit. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Übertragungsphänomenen, die Rolle des Unbewussten und die Notwendigkeit einer „schwebende Haltung" des Sozialpädagogen. Der Text analysiert die psychoanalytische Theorie unter Berücksichtigung eigener Erfahrungen im Bereich des Betreuten Einzelwohnens für HIV/Hepatitis C-infizierte Menschen mit psychischen Auffälligkeiten.
- Quote paper
- Dominik Sommer (Author), 2009, Die psychoanalytische Sozialpädagogik von Jürgen Körner und Christiane Ludwig-Körner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271824