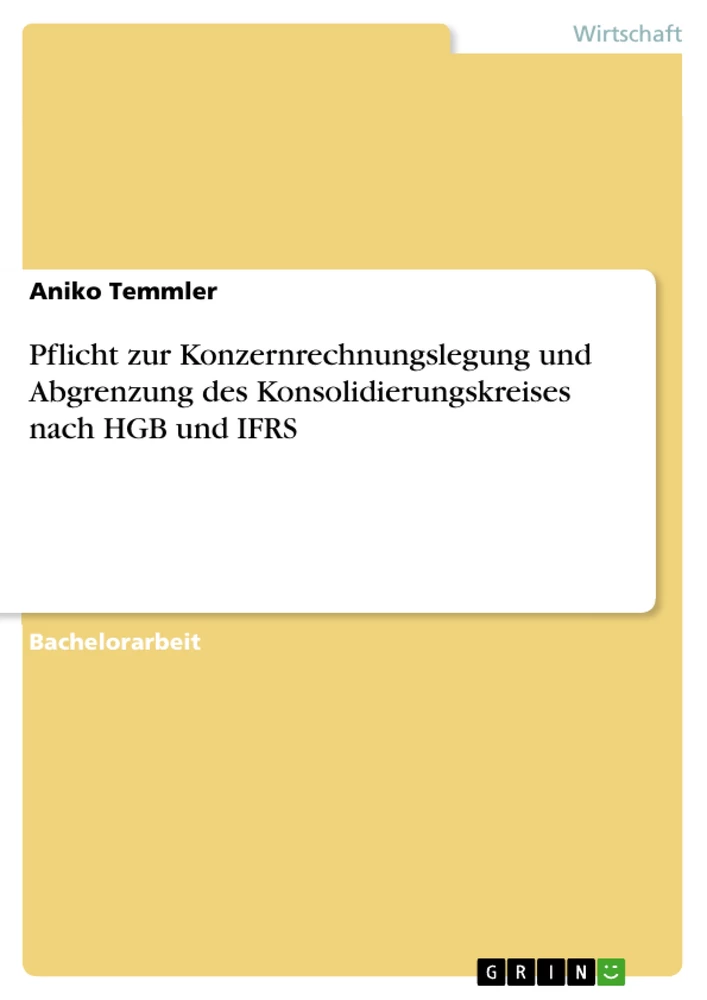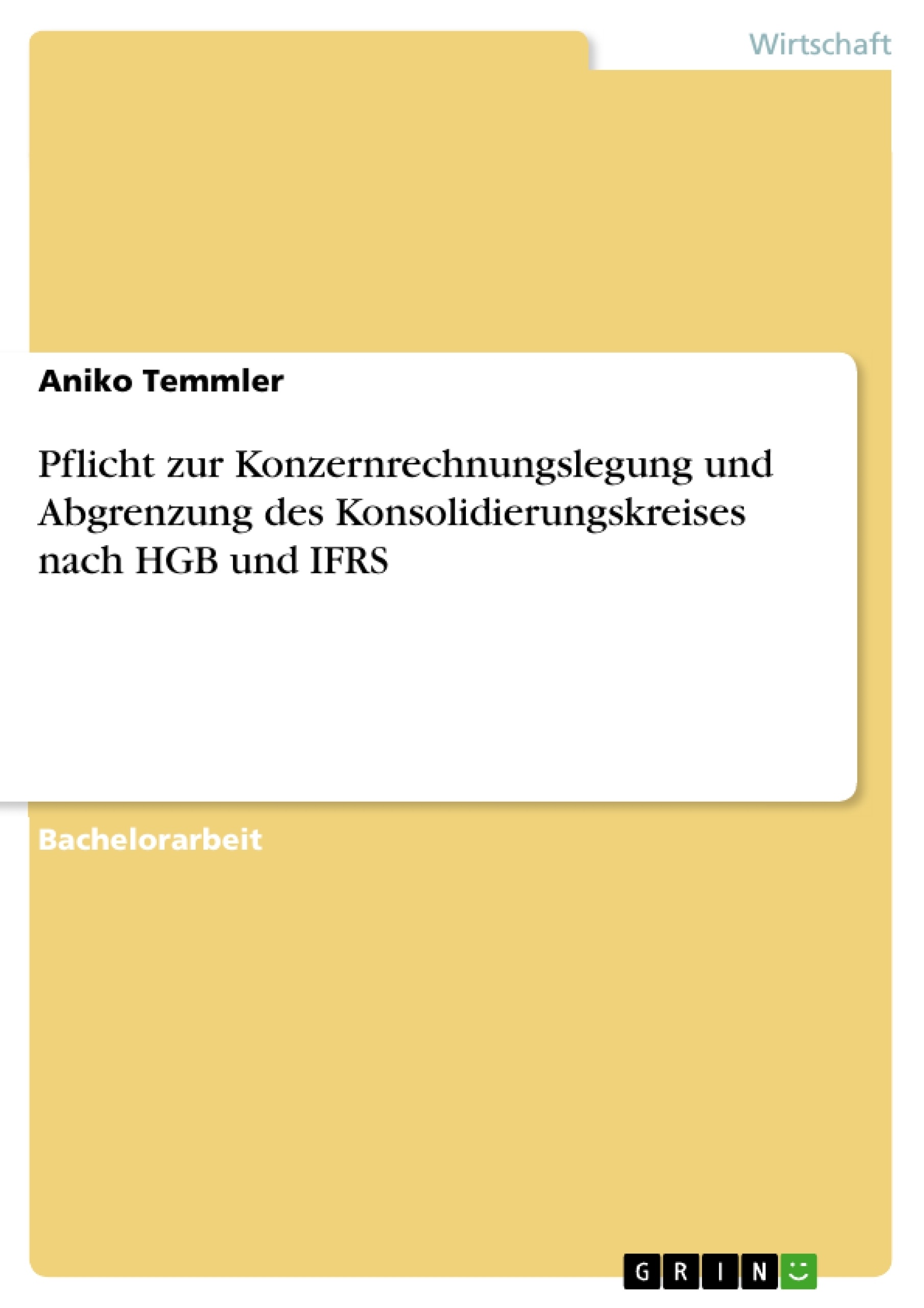Die zunehmende Globalisierung der Märkte, verbunden mit verschärften Wettbewerbsbedingungen und verkürzten Produktionszyklen, haben in den letzten Jahrzehnten eine verstärkte Kooperationswelle ausgelöst, sodass zahlreiche
Unternehmen nicht mehr selbständig sondern in unterschiedlichen Arten von Unternehmensverbindungen agieren. Eine besondere und eine der wichtigsten
Organisationsformen stellt der Konzern dar. Nicht nur international erlangen Konzerne zunehmend an Bedeutung. Auch im deutschen Wirtschaftsraum wählen viele Unternehmen bewusst diese Unternehmensverbindung, um ihre Macht zu stärken respektive am Markt eine tragfähige Wettbewerbsposition zu etablieren. Häufig versprechen sich Unternehmen aus der Konzernierung Effizienzvorteile
hinsichtlich der eigenen ökonomischen Zielsetzung. Da von der Konzernbildung neben den einzelnen Konzernunternehmen ebenso die am Konzern beteiligten Anteilseigner, Gläubiger, Arbeitnehmer und Geschäftspartner unmittelbar
betroffen sind, gewinnt auch die Rechnungslegung von Konzernen an Bedeutung. Als ein wesentliches Instrument der Außendarstellung vermittelt die Konzernrechnungslegung
externen Adressaten bedeutsame Informationen über das
wirtschaftliche Gebaren des Konzerns. Im deutschen Handelsrecht sind Regelungen zur Konzernrechnungslegung sowohl im HGB als auch im PublG kodifiziert. Für international agierende Unternehmen rücken die nationalen Vorschriften jedoch zugunsten internationaler Rechnungslegungsgrundsätze zunehmend in den Hintergrund. Dies ist unter anderem auf die mangelnde Akzeptanz der
deutschen Rechnungslegung auf dem internationalen Markt zurückzuführen.
Die Notwendigkeit einer vergleichbaren und transparenten Rechnungslegung nach weltweit einheitlichen Standards zeigte insbesondere die jüngste internationale
Finanzkrise. Daher befinden sich sowohl die internationale Rechnungslegung, welche für ihre hohe Änderungsdynamik ohnehin schon bekannt ist, als
auch die nationale Rechnungslegung seit den letzten Jahren in einem tiefgreifenden Umbruch. Nachdem das deutsche Handelsrecht im Zuge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) im Jahre 2009 der bis dato ausgesetzten Kritik einer unzureichenden internationalen Vergleichbarkeit – durch eine weitgehende Angleichung an die IFRS – aufgewartet hat, so sah sich auch die internationale Rechnungslegung in der jüngsten Vergangenheit umfangreichen Änderungen ausgesetzt.[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlegende Begriffsklärungen
- 2.1 Konzern
- 2.2 Konzernabschluss
- 2.3 Konsolidierungskreis
- 3 Grundlagen der Konzernrechnungslegung
- 3.1 Theoretische Konzeptionen der Konzernrechnungslegung
- 3.2 Zweck des Konzernabschlusses
- 4 Pflicht zur Konzernrechnungslegung
- 4.1 Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes nach nationalem Recht
- 4.1.1 Die Aufstellungspflicht im Wandel der Gesetzgebung
- 4.1.2 Aufstellungspflicht nach HGB
- 4.1.2.1 Mutter-Tochter-Verhältnis (Subordinationsverhältnis)
- 4.1.2.2 Konzept des beherrschenden Einflusses
- 4.1.2.3 Tatbestände des beherrschenden Einflusses
- 4.1.3 Aufstellungspflicht nach PublG
- 4.1.4 Aufstellungsfrist und Bestandteile des Konzernabschlusses
- 4.2 Befreiungen von der Aufstellungspflicht nach nationalem Recht
- 4.2.1 Befreiender Konzernabschluss nach § 291 und § 292 HGB
- 4.2.2 Größenabhängige Befreiungen nach § 293 HGB
- 4.2.3 Befreiung mangels konsolidierungspflichtiger Tochterunternehmen nach § 290 Abs. 5 HGB
- 4.3 Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses nach internationalen Rechnungslegungsstandards
- 4.4 Befreiungen von der Aufstellungspflicht nach IFRS
- 4.1 Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichtes nach nationalem Recht
- 5 Abgrenzung des Konsolidierungskreises – Systematischer Vergleich zwischen nationaler und internationaler Rechnungslegung
- 5.1 Konsolidierungskreis im engeren Sinne
- 5.1.1 Gesetzlicher Anwendungsbereich / Regelungssystematik
- 5.1.2 Konsolidierungsgebot nach dem Weltabschlussprinzip
- 5.1.3 Konsolidierungswahlrechte und Konsolidierungsverbot
- 5.2 Konsolidierungskreis im weiteren Sinne
- 5.3 Angaben zum Konsolidierungskreis im Konzernanhang
- 5.1 Konsolidierungskreis im engeren Sinne
- 6 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Pflicht zur Konzernrechnungslegung und die Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist ein systematischer Vergleich beider Regelwerke und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
- Pflicht zur Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS
- Konzept des beherrschenden Einflusses
- Abgrenzung des Konsolidierungskreises
- Befreiungen von der Konzernrechnungslegungspflicht
- Systematischer Vergleich HGB und IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit. Es wird die Relevanz des Themas im Kontext der nationalen und internationalen Rechnungslegung hervorgehoben.
2 Grundlegende Begriffsklärungen: Hier werden grundlegende Begriffe wie Konzern, Konzernabschluss und Konsolidierungskreis definiert und abgegrenzt. Es wird die Basis für das Verständnis der folgenden Kapitel gelegt, indem die zentralen Begriffe der Konzernrechnungslegung präzise erläutert werden. Der Fokus liegt auf einer klaren und eindeutigen Definition, um Missverständnisse zu vermeiden.
3 Grundlagen der Konzernrechnungslegung: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Konzeptionen der Konzernrechnungslegung und den Zweck des Konzernabschlusses. Es werden verschiedene theoretische Ansätze vorgestellt und deren Bedeutung für die Praxis diskutiert. Der Zweck des Konzernabschlusses als Instrument zur Informationsversorgung der Stakeholder wird detailliert beschrieben.
4 Pflicht zur Konzernrechnungslegung: Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der detaillierten Darstellung der Aufstellungspflicht für Konzernabschlüsse nach nationalem Recht (HGB und PublG) und nach IFRS. Die verschiedenen Regelungen und Ausnahmeregelungen werden verglichen und analysiert. Die Kapitel 4.1.2, 4.2 und 4.3 befassen sich mit der Aufstellungspflicht und den damit verbundenen Kriterien, den Befreiungsmöglichkeiten und den Vorschriften der internationalen Rechnungslegung im Detail. Es werden unterschiedliche Fallbeispiele und Gesetzesinterpretationen untersucht.
5 Abgrenzung des Konsolidierungskreises – Systematischer Vergleich zwischen nationaler und internationaler Rechnungslegung: Dieses Kapitel bietet einen detaillierten Vergleich der Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IFRS. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Systematik und den Regelungen herausgearbeitet. Dabei wird der Konsolidierungskreis im engeren und weiteren Sinne betrachtet und die Bedeutung der Angaben zum Konsolidierungskreis im Konzernanhang erläutert. Der Vergleich dient dem Verständnis der unterschiedlichen Herangehensweisen beider Rechnungslegungsstandards.
Schlüsselwörter
Konzernrechnungslegung, HGB, IFRS, Konsolidierungskreis, beherrschender Einfluss, Mutter-Tochter-Verhältnis, Konzernabschluss, Aufstellungspflicht, Befreiungen, nationaler und internationaler Vergleich.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Konzernrechnungslegung im Vergleich von HGB und IFRS
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Pflicht zur Konzernrechnungslegung und die Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS). Ziel ist ein systematischer Vergleich beider Regelwerke und die Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Pflicht zur Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS, das Konzept des beherrschenden Einflusses, die Abgrenzung des Konsolidierungskreises, Befreiungen von der Konzernrechnungslegungspflicht und einen systematischen Vergleich von HGB und IFRS. Detailliert werden die Aufstellungspflicht für Konzernabschlüsse, die verschiedenen Regelungen und Ausnahmeregelungen sowie die unterschiedlichen Herangehensweisen beider Rechnungslegungsstandards untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Grundlegende Begriffsklärungen (Konzern, Konzernabschluss, Konsolidierungskreis), Grundlagen der Konzernrechnungslegung (theoretische Konzeptionen und Zweck des Konzernabschlusses), Pflicht zur Konzernrechnungslegung (nationales und internationales Recht, Aufstellungspflicht und Befreiungen), Abgrenzung des Konsolidierungskreises (systematischer Vergleich HGB und IFRS), und Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel baut aufeinander auf und vertieft die Thematik schrittweise.
Was sind die zentralen Begriffe der Arbeit?
Zentrale Begriffe sind Konzernrechnungslegung, HGB, IFRS, Konsolidierungskreis, beherrschender Einfluss, Mutter-Tochter-Verhältnis, Konzernabschluss, Aufstellungspflicht, Befreiungen, nationaler und internationaler Vergleich.
Wie werden HGB und IFRS in der Arbeit verglichen?
Der Vergleich von HGB und IFRS erfolgt systematisch, indem die Regelungen zur Aufstellungspflicht, zu den Befreiungen von der Aufstellungspflicht und zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises gegenübergestellt und analysiert werden. Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Regelwerke werden herausgearbeitet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der Pflicht zur Konzernrechnungslegung und der Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IFRS zu vermitteln und die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Regelwerke aufzuzeigen. Sie dient als systematische Analyse und Vergleich dieser wichtigen Aspekte der nationalen und internationalen Rechnungslegung.
Welche Kapitel befassen sich im Detail mit der Aufstellungspflicht und den Befreiungen?
Kapitel 4.1.2, 4.2 und 4.3 befassen sich detailliert mit der Aufstellungspflicht und den damit verbundenen Kriterien, den Befreiungsmöglichkeiten und den Vorschriften der internationalen Rechnungslegung. Es werden unterschiedliche Fallbeispiele und Gesetzesinterpretationen untersucht.
Wie wird der Konsolidierungskreis definiert und abgegrenzt?
Der Konsolidierungskreis wird sowohl im engeren als auch im weiteren Sinne betrachtet. Die Arbeit analysiert die gesetzliche Regelung, das Weltabschlussprinzip, Konsolidierungswahlrechte und -verbote sowie die Angaben zum Konsolidierungskreis im Konzernanhang, und vergleicht dies im Hinblick auf HGB und IFRS.
- Quote paper
- Aniko Temmler (Author), 2013, Pflicht zur Konzernrechnungslegung und Abgrenzung des Konsolidierungskreises nach HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271413