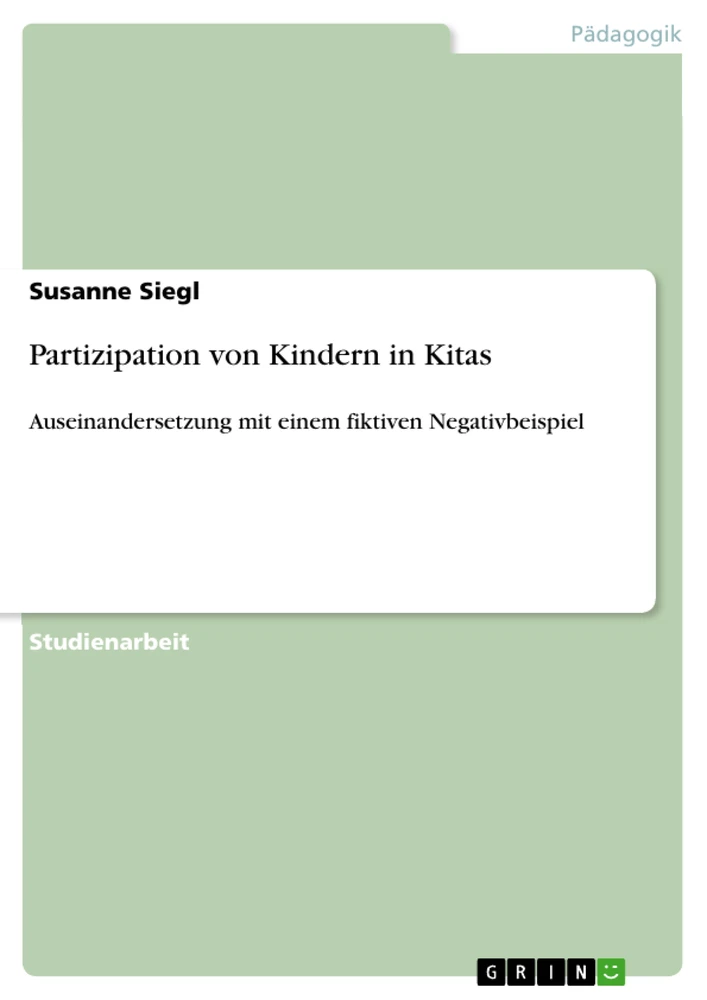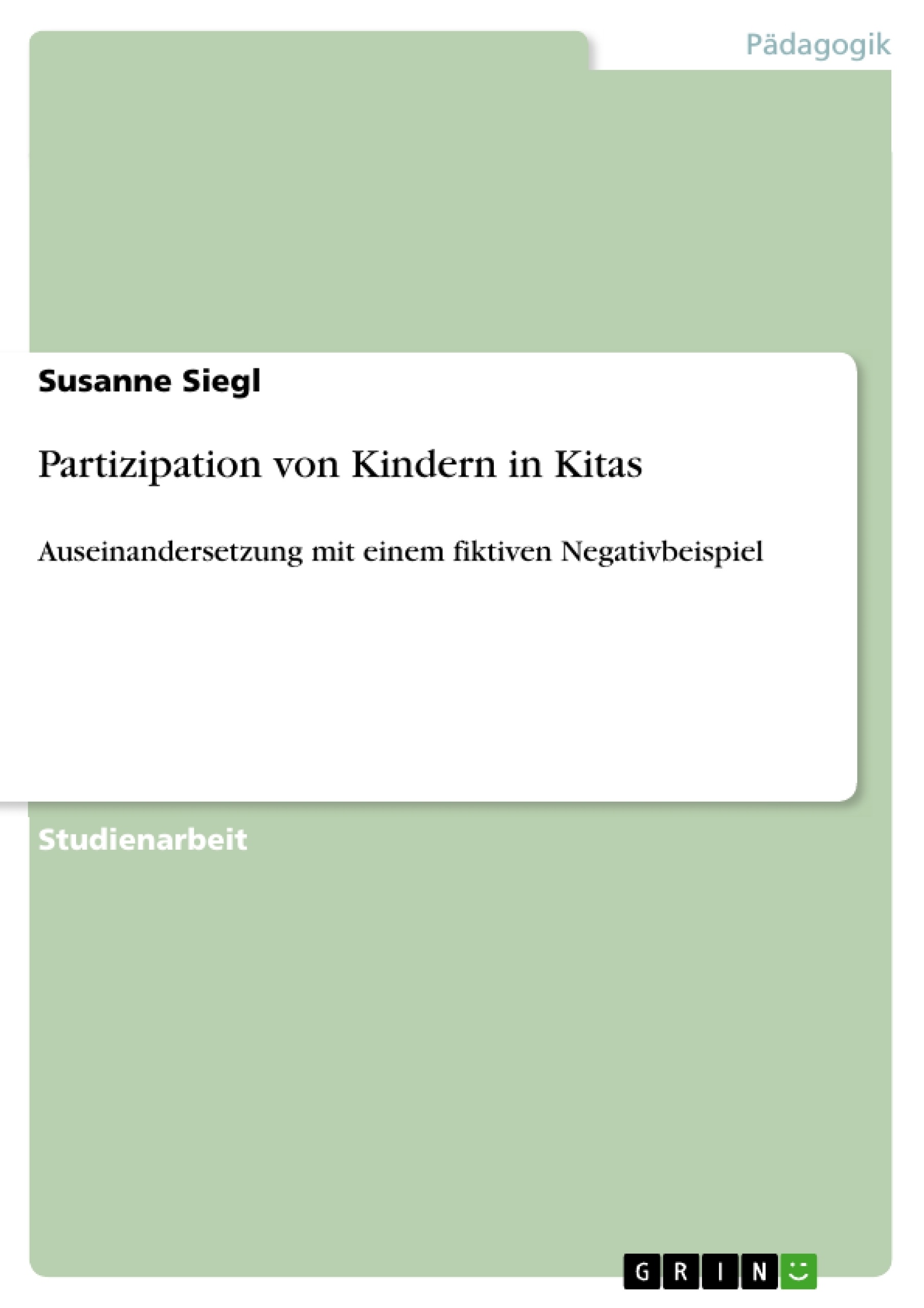Wenn Kinder „im Sinne von Partizipation“ in einem bestimmten Zeitraum selbst entscheiden dürfen, ob und wann sie rausgehen, sich bei der Erzieherin nur noch ab- und wieder rückmelden müssen – ist das die Umsetzung von „Partizipation von Kindern“ in Kindertagesstätten?! Ist es das was der 22. Paragraph des Sozialgesetzbuches mit „Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (SGB VIII § 22) meint? Weswegen ist Partizipation von Kindern damit verbunden? Alles nur wegen den Gesetzen – oder was lernen Kinder wenn sie „partizipiert“ werden? Welche Vorstellung von Partizipation von Kindern steckt hinter diesem Umsetzungsbeispiel und wie steht aktuelle Fachliteratur dazu? Diese Fragen werden behandelt.
Der Verständlichkeit wegen, werden hier die Begriffe „Partizipation“, „Bildung“ und „Wissen“ im Zusammenhang mit diesem Thema erläutert.
Das Wort „Partizipation“ übersetze ich mit „Teilhabe“, „Teilnahme“ (lat.: „pars“ Teil, „-cipere“ nehmen, sich geben lassen“). Partizipation ist eine Bedingung von Demokratie und lebt von Verantwortungsfähigkeit und Verantwortungsübernahme (vgl. Prote 2007, S. 262). Rückschließend wird Partizipation von Kindern als Kern vom „Demokratie-lernen“ gesehen (vgl. Prote 2007, S. 262). In dieser Arbeit verlangt sie „demokratische Beteiligung der Kinder“ (Knauer 2011, S. 7), um „Demokratie zu lernen“ (ebd., S. 7), mit dem Ziel eigenverantwortliches, gemeinschaftliches Denken und Handeln zu fördern. Partizipation von Kindern verlangt eine kontinuierliche Einbeziehung von Kindern in Entscheidungen bei denen sie, ihre Gruppe, ihr Kitaalltag oder ihr Umfeld betroffen sind. (vgl. Prote 2007, S. 263) Mit den „ungleichen Machtverhältnis[sen] in pädagogischen Beziehungen“ (vgl. Knauer 2010, S. 24, Hinzufügung: S.S.) wird ganz verschieden umgegangen.
(...) Bildung geschieht nicht durch klassische Wissensvermittlung; nicht nach dem Schema: Eine Frage – eine Antwort zum (Auswendig-)Lernen. Sondern Bildungsprozesse werden hier als vorhanden gesehen, wenn der sich bildende Mensch zum Nachdenken kommt, seine bisherige Haltung zur Welt und sich neu überdenkt, als unvollständig erkennt und versucht dieses neu zu konstruieren. Bildungsprozesse solcher Art entstehen bei aktiver Beteiligung, was wieder auf die Verbindung von Bildung und Partizipation hinweist. Ist dies der Grund, dass Partizipation von Kindern Einzug in die Kitas hält?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Partizipation von Kindern – eine Herleitung
- 2.1 Legitimation durch SGB und Orientierungsplan
- 2.2 Legitimation durch Bildungsprozesse
- 3. Partizipation von Kindern - Ein Elternbrief überprüft mit ausgewählter Fachliteratur
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Partizipation von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die pädagogischen Implikationen von Kinderbeteiligung. Die Arbeit analysiert, wie Partizipation Bildungsprozesse fördert und welche Rolle sie im Kontext von Demokratieerziehung spielt.
- Rechtliche Grundlagen der Partizipation von Kindern (SGB VIII, Orientierungspläne)
- Zusammenhang zwischen Partizipation, Bildung und Wissen
- Machtverhältnisse in Kindertageseinrichtungen und deren Einfluss auf Partizipation
- Analyse eines Elternbriefs im Hinblick auf die Umsetzung von Partizipation
- Pädagogische Implikationen und Herausforderungen der Partizipation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verständnis und der Umsetzung von Partizipation von Kindern in Kindertagesstätten. Sie hinterfragt gängige Praxisbeispiele und verknüpft sie mit den gesetzlichen Vorgaben des SGB VIII. Die Begriffe Partizipation, Bildung und Wissen werden im Kontext der Arbeit definiert, wobei der Fokus auf aktiven Beteiligungsprozessen und der Konstruktion von Wissen liegt, im Gegensatz zu reiner Wissensvermittlung. Die Einleitung skizziert den weiteren Aufbau der Arbeit und die zu behandelnden Forschungsfragen.
2. Partizipation von Kindern – eine Herleitung: Dieses Kapitel untersucht die Legitimation von Partizipation von Kindern aus rechtlicher und bildungstheoretischer Perspektive. Im Abschnitt 2.1 wird die Legitimation durch das SGB VIII und den Orientierungsplan für baden-württembergische Kitas herausgearbeitet, wobei die Betonung auf der Förderung eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Denkens und Handelns liegt. Abschnitt 2.2 beleuchtet den Zusammenhang zwischen Partizipation und Bildungsprozessen, indem er die aktive Beteiligung als Katalysator für Lernen und Entwicklung beschreibt, im Gegensatz zu einer rein passiven Wissensvermittlung. Das Kapitel betont, dass Partizipation nicht nur gesetzlich gefordert, sondern auch aus bildungsintrinsischen Gründen essentiell ist. Es werden die Machtverhältnisse zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern angesprochen, und die Notwendigkeit ihrer bewussten und reflektierten Gestaltung im Sinne der Kinderbeteiligung wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Partizipation, Kinder, Kindertageseinrichtung, SGB VIII, Orientierungsplan, Bildung, Wissen, Demokratieerziehung, Machtverhältnisse, Eigenverantwortung, Gemeinschaftsfähigkeit, Bildungsprozesse.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Partizipation von Kindern in Kindertageseinrichtungen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Partizipation von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Sie beleuchtet die rechtlichen Grundlagen und die pädagogischen Implikationen der Kinderbeteiligung, analysiert deren fördernde Wirkung auf Bildungsprozesse und ihre Rolle in der Demokratieerziehung.
Welche rechtlichen Grundlagen werden behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf das SGB VIII (Sozialgesetzbuch VIII) und die Orientierungspläne (z.B. für baden-württembergische Kitas) als rechtliche Grundlage für die Partizipation von Kindern. Der Fokus liegt auf der Förderung eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Denkens und Handelns.
Wie wird der Zusammenhang zwischen Partizipation und Bildung dargestellt?
Die Arbeit beschreibt Partizipation als aktiven Katalysator für Lernen und Entwicklung, im Gegensatz zu passiver Wissensvermittlung. Aktive Beteiligung wird als essentiell für Bildungsprozesse betrachtet, nicht nur aus rechtlicher Sicht, sondern auch aus bildungsintrinsischen Gründen.
Welche Rolle spielen Machtverhältnisse?
Die Arbeit thematisiert die Machtverhältnisse zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern und betont die Notwendigkeit ihrer bewussten und reflektierten Gestaltung im Sinne der Kinderbeteiligung.
Wie wird Partizipation in der Praxis untersucht?
Ein Elternbrief wird analysiert, um die Umsetzung von Partizipation in der Praxis zu überprüfen und zu bewerten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Herleitung der Partizipation von Kindern (mit Unterkapiteln zur rechtlichen und bildungstheoretischen Legitimation), ein Kapitel zur Analyse eines Elternbriefs und ein Fazit.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Schlüsselbegriffe sind: Partizipation, Kinder, Kindertageseinrichtung, SGB VIII, Orientierungsplan, Bildung, Wissen, Demokratieerziehung, Machtverhältnisse, Eigenverantwortung, Gemeinschaftsfähigkeit, Bildungsprozesse.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit dem Verständnis und der Umsetzung von Partizipation von Kindern in Kindertagesstätten. Weitere Forschungsfragen untersuchen den Zusammenhang zwischen Partizipation, Bildung und Wissen sowie die pädagogischen Implikationen und Herausforderungen der Partizipation.
- Quote paper
- Susanne Siegl (Author), 2014, Partizipation von Kindern in Kitas, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271405