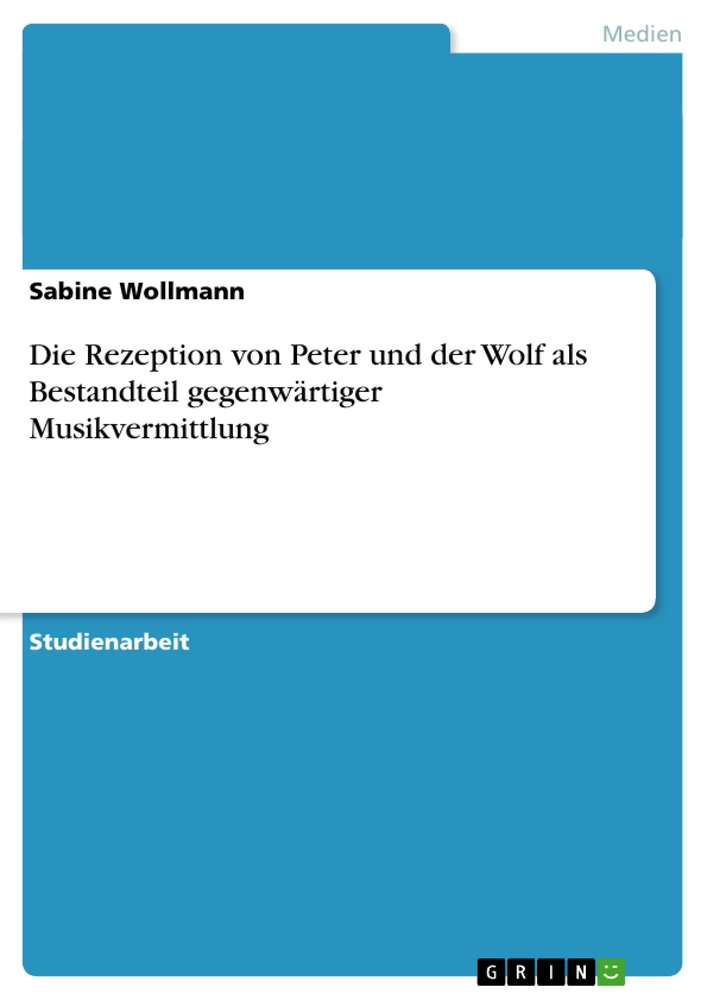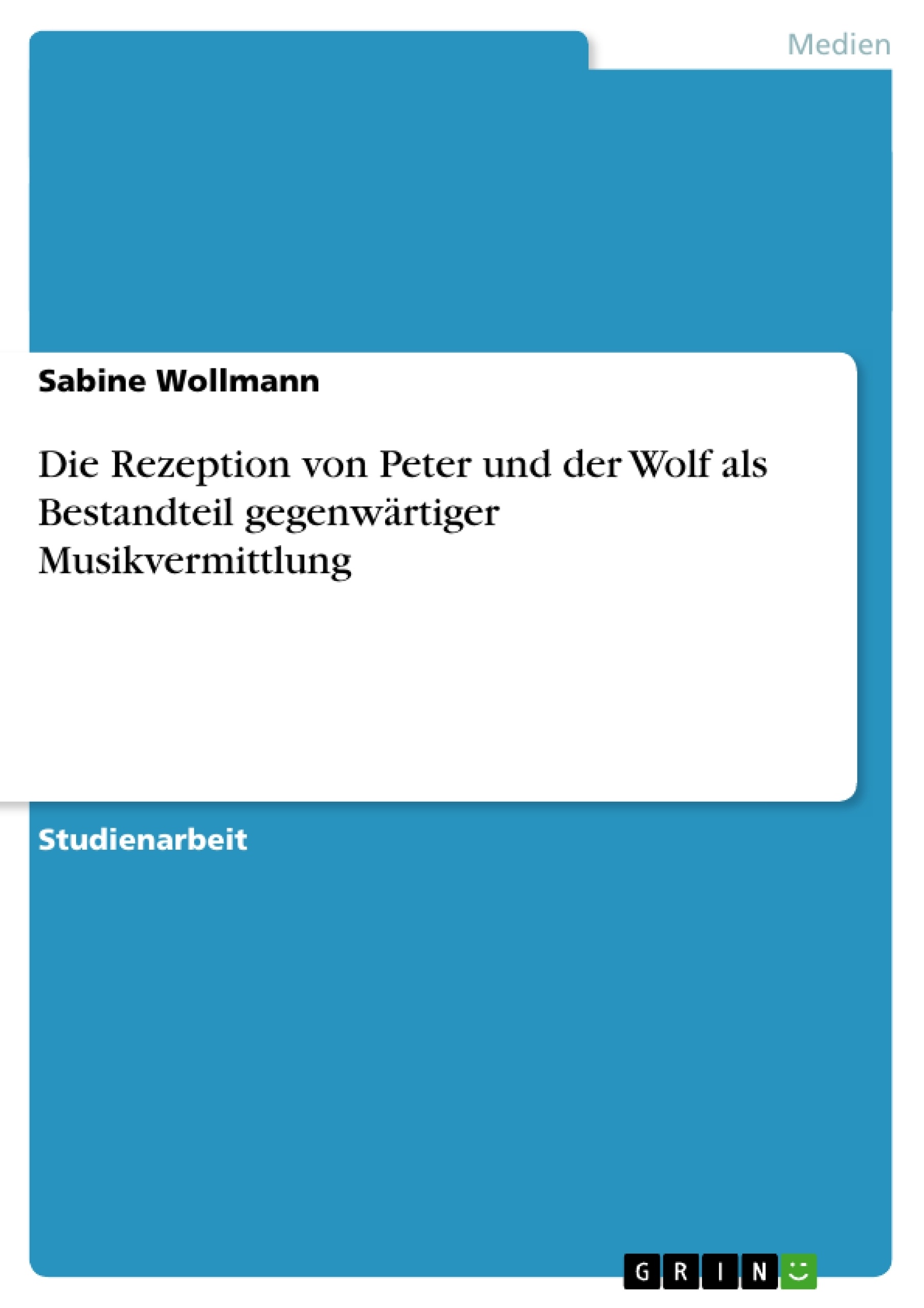In der folgenden schriftlichen Ausarbeitung werde ich exemplarisch anhand des Werkes Peter und der Wolf einen Einblick in die Praxis der Musikvermittlung geben und einige Thesen in Bezug auf die Nachhaltigkeit dieses musikalischen Märchens erarbeiten. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Arbeit ist der zeitgeschichtliche und politische Hintergrund vor dem das Werk entstanden ist. Als besonders erwähnenswert erweist sich für mich dabei die Tatsache, dass der russische Komponist Sergej Prokofjew dem Stück nachweisbar eine eindeutige pädagogische ‚Werksidee‘ zu Grunde gelegt hat und diese Komposition nunmehr seit etwa 50 Jahren fortwährend in die Unterrichtspraxis an Schulen eingebunden wird. Somit wird Peter und der Wolf gegenwärtig zumeist ausschließlich unter dem Aspekt einer didaktisch-vermittelnden Sinfonie für Kinder behandelt. Dennoch ist es meiner Meinung nach durchaus relevant, die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Werkes in den Fokus zu nehmen, vor allem da hier aus musikgeschichtlicher Perspektive immer wieder eine massive Veranschaulichung von Indoktrination angenommen wird. Es erscheint mir daher wichtig aufzuzeigen, wie die Machtpolitik der 19030er Jahre die Kunst instrumentalisiert hat und wie sich das kulturpolitische Umfeld auf die Biografie Prokofjews‘ und somit auf sein musikalisches Schaffen ausgewirkt hat. Weiterhin versuche ich einige Überlegungen bezüglich der Wirkung und Beliebtheit des Stückes bei jungen Menschen festzuhalten und die Besonderheiten hervorzuheben, die das Stück innerhalb des pädagogischen Standardrepertoires der Gegenwart etablierten.
Da sich die Quellenlage bei dieser Arbeit als sehr schwierig erwies und nur wenig Forschungsliteratur zu diesem spezifischen Themengegenstand vorhanden ist, werde ich vor allem eigene Annahmen und Ergebnisse festhalten, die ich durch das Heranziehung von Unterrichtsmaterialien aus dem Bereich der elementaren Musikpädagogik gewinnen konnte. Im Schlussteil werde ich meine eigenen Ergebnisse zusammentragen und ein Fazit hinsichtlich des didaktischen Potenzials des Werkes bei der Ausbildung von musikalischer Kompetenz im Schulunterricht der Gegenwart ziehen.
I. Zielsetzung der Arbeit und Erläuterung des inhaltlichen Aufbaus
In der folgenden schriftlichen Ausarbeitung werde ich exemplarisch anhand des Werkes Peter und der Wolf einen Einblick in die Praxis der Musikvermittlung geben und einige Thesen in Bezug auf die Nachhaltigkeit dieses musikalischen Märchens erarbeiten. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Arbeit ist der zeitgeschichtliche und politische Hintergrund vor dem das Werk entstanden ist. Als besonders erwähnenswert erweist sich für mich dabei die Tatsache, dass der russische Komponist Sergej Prokofjew dem Stück nachweisbar eine eindeutige pädagogische ‚Werksidee‘ zu Grunde gelegt hat und diese Komposition nunmehr seit etwa 50 Jahren fortwährend in die Unterrichtspraxis an Schulen eingebunden wird. Somit wird Peter und der Wolf gegenwärtig zumeist ausschließlich unter dem Aspekt einer didaktisch-vermittelnden Sinfonie für Kinder behandelt. Dennoch ist es meiner Meinung nach durchaus relevant, die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte des Werkes in den Fokus zu nehmen, vor allem da hier aus musikgeschichtlicher Perspektive immer wieder eine massive Veranschaulichung von Indoktrination angenommen wird. Es erscheint mir daher wichtig aufzuzeigen, wie die Machtpolitik der 19030er Jahre die Kunst instrumentalisiert hat und wie sich das kulturpolitische Umfeld auf die Biografie Prokofjews‘ und somit auf sein musikalisches Schaffen ausgewirkt hat. Weiterhin versuche ich einige Überlegungen bezüglich der Wirkung und Beliebtheit des Stückes bei jungen Menschen festzuhalten und die Besonderheiten hervorzuheben, die das Stück innerhalb des pädagogischen Standardrepertoires der Gegenwart etablierten.
Da sich die Quellenlage bei dieser Arbeit als sehr schwierig erwies und nur wenig Forschungsliteratur zu diesem spezifischen Themengegenstand vorhanden ist, werde ich vor allem eigene Annahmen und Ergebnisse festhalten, die ich durch das Heranziehung von Unterrichtsmaterialien aus dem Bereich der elementaren Musikpädagogik gewinnen konnte. Im Schlussteil werde ich meine eigenen Ergebnisse zusammentragen und ein Fazit hinsichtlich des didaktischen Potenzials des Werkes bei der Ausbildung von musikalischer Kompetenz im Schulunterricht der Gegenwart ziehen.
II. Zur Entstehungsgeschichte
Als Sergej Prokofjew 1936 Peter und der Wolf komponierte, konnte er sich vorteilhafterweise einer Arbeit zuwenden, die keinen Zündstoff für politisch-ideologische Kontroversen darstellte, was in dieser Zeit vornehmlich eine Seltenheit darstellte. Zudem konnte er einen festen Zeitraum abstecken, in dem er berufliche und kreative Betätigung fand.
Die Grundlage für die Entstehung des Werkes ergab sich bereits im vorrausgehenden Jahr, in dem Prokofjew das erste Mal nähere Bekanntschaft mit Natalja Saz machte, Intendantin des ersten Moskauer Kindertheaters und Tochter des verstorbenen Dirigenten und Komponisten Ilja Saz.
In ihrer Erinnerung erschien Prokofjew gehemmt und eitel, auf ein Gespräch ließ er sich nur mit lakonischen Entgegnungen ein. Die Initiative zur Beauftragung an der Komposition ergriff Saz erst nachdem Prokofjew mehrmals daraufhin das Kindertheater mit seiner Familie besuchte und ihr ernstzunehmender Aufgeschlossenheit symbolisierte.[1] In ihren Novellen des Lebens hält Saz als den Grundgedanken der Komposition fest, dass die Kinder „alle ohne Ausnahme großes Interesse am Orchester“[2] haben und die Erwachsenen sich sehr wünschten, dass die Kinder „von klein auf erfahren, was Musik ist, sich für sie interessieren, Gefallen an ihr finden“[3] und dass „so ein Märchen die Kinder in fesselnder, verständlicher Form mit den Instrumenten bekanntmacht, die zu einem Sinfonieorchester gehören“[4].
Als Prokofjew sich dazu bereit erklärt das Stück zu verfassen, verlangt er als Honorar von Saz nur so viel wie ihr institutionell zur Verfügung stand. Die Arbeiten an der ‚kleinen Sinfonie‘ begannen im Frühjahr 1936. Neben seiner großen Kinderliebe könnten auch Prokofjews eigenen glücklichen Kindheitserinnerungen dazu beigetragen haben, das sinfonische Märchen zu schreiben.
Geboren auf einem beschaulichen Landgut in der Ukraine wächst er „inmitten einer ausgedehnten Steppenlandschaft und schier endlos verlaufender Weizenfelder“[5] heran.
Schon in seinen jungen Jahren erweist sich Prokofjew als lernbegierig, gewissenhaft und in mancher Hinsicht provokant und überheblich.[6]
Bei der Arbeit an Peter und der Wolf sah Prokofjew vor jede Gestalt mit einem Instrument zu untermalen, die Figur des Peters sollte mit der Mannigfaltigkeit eines Streichquartetts zum Ausdruck kommen.[7] Das Stück wurde in seinem gesamten Klangcharakter anschaulich sowie einprägsam konstituiert und jeder handelnder Charakter wurde mit spezifischen musikalischen Attributen vertont.
Besonders wichtig schien es Prokofjew dabei wohl Kontraste zwischen den einzelnen Protagonisten zu schaffen und diese durch eine kontinuierliche, stetig wiederkehrende Klangfarbe zu verdeutlichen. Die Librettistin Nina Saksonkaja war ursprünglich von Saz für das Verfassen der begleitende Texte für die Sprecherstimme vorgesehen, jedoch schien sie in ihrer Rolle nicht Prokofjews konkreten Kriterien zu entsprechen, sodass dieser zusätzlich noch in Zusammenarbeit mit Saz die Erzählung des Märchens formulierte. Das Stück erfreute sich auf Anhieb einer großen Beliebtheit, als Saz und Prokofjew kurz nach der Fertigstellung von Text und Klavierpartitur am 15. April eine Demonstration des Werkes vor einer ausgewählten Zuhörerschaft aus Kindern veranlassten. Daraufhin fertigte Prokofjew unverzüglich die Orchesterfassung von Peter und der Wolf, op. 67 an.[8]
Die Uraufführung am 2. Mai 1936 erwies sich noch als weniger erfolgsversprechend, stattdessen war es die nachfolgende Darbietung, welche den ersehnten Beifall hervorbrachte.[9] Obwohl sich Prokofjew wünschte, Natalja Saz namentlich für das Mitwirken am Libretto zu erwähnen, konnte er diesem Vorhaben nicht nachkommen, da sie im August 1937 als die ehemalige Frau des Parteigegners Marshall Tuchatschewskis für fünf Jahre ins Straflager gewiesen wurde und allein die öffentliche Benennung ihrer Person Gefahrenpotenzial für Prokofjew barg.[10]
[...]
[1] Vgl. Biesold, Maria: Sergej Prokofjew. Komponist im Schatten Stalins, Weinheim und Berlin 1996, S. 209.
[2] Zitiert nach: Saz, Natalja: Novellen des Lebens, Berlin 1986, URL: http://www.ljo-bremen.de/00000096180a8c707/00000096180a9db31/00000096180b24876/index.html, Stand: 05.08.2012.
[3] Ebd.
[4] Ebd.
[5] Biesold, S. 15.
[6] Vgl. ebd., S. 18.
[7] Vgl. ebd., S. 110.
[8] Vgl. ebd.
[9] Vgl. ebd., S. 211.
[10] Vgl. ebd., S. 210f.
- Quote paper
- Sabine Wollmann (Author), 2012, Die Rezeption von Peter und der Wolf als Bestandteil gegenwärtiger Musikvermittlung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271347