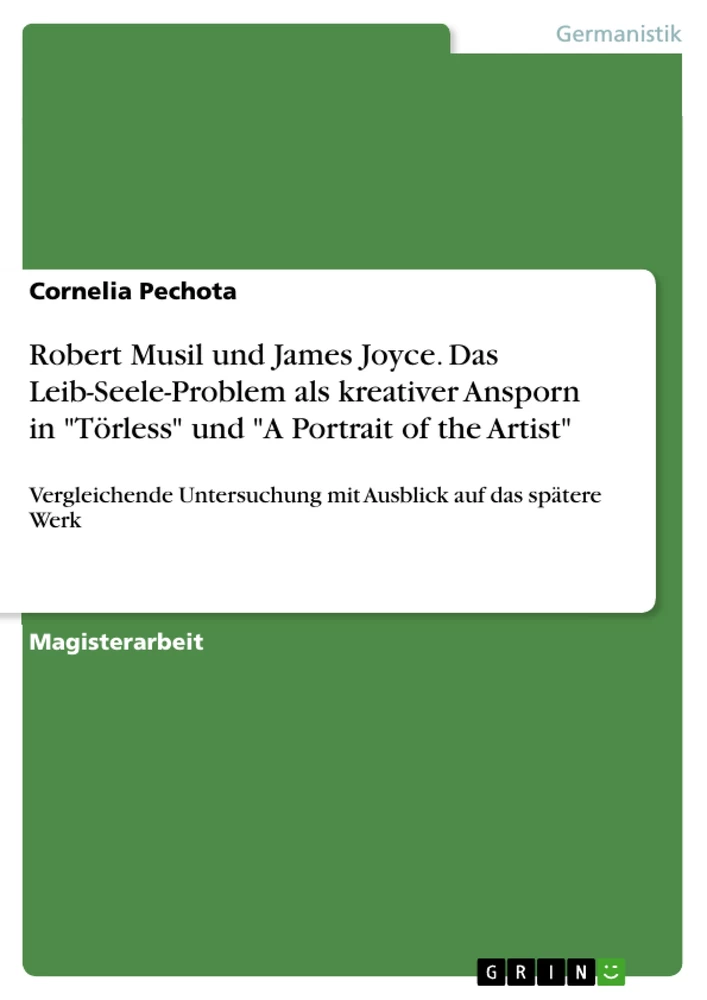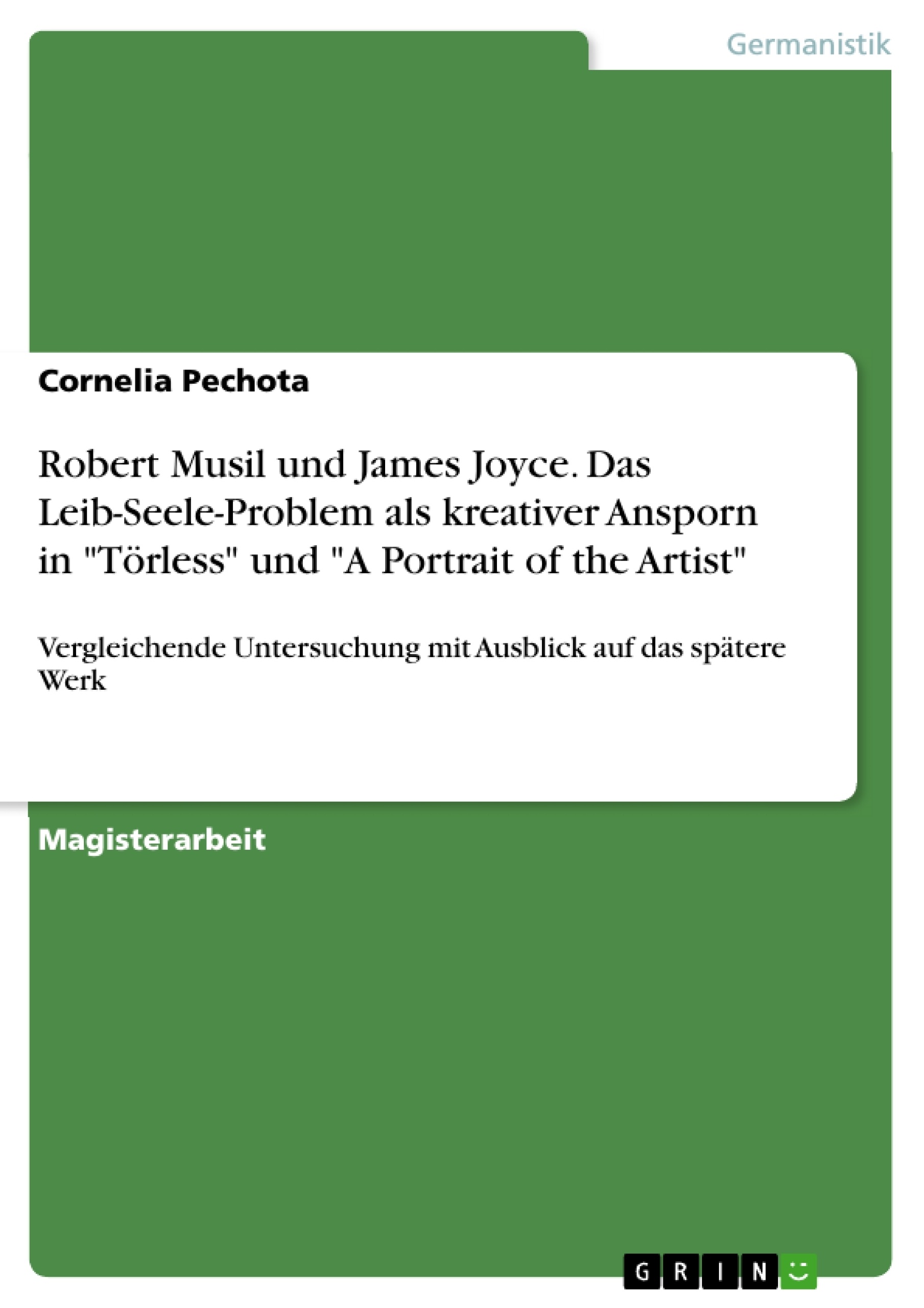„Ist es ein allgemeines Gesetz, das etwas in uns ist, das stärker, größer, schöner, leidenschaftlicher, dunkler ist als wir? Worüber wir so wenig Macht haben, dass wir nur ziellos tausend Samenkörner streuen können, bis aus einem plötzlich eine Saat wie eine dunkle Flamme schießt, die weit über uns hinauswächst?”
Diese Überlegung, die der junge Törless mit einer Erinnerung an den Gesang einer italienischen Schauspielerin verbindet, folgt einem Augenblick größter Erregung, dem „Gefühl, dass etwas in ihm wie ein toller Kreisel aus der zusammengeschnürten Brust zum Kopfe hinaufwirble”. Zustände, die sich der sprachlichen Wiedergabe entziehen, überwältigen den Knaben, fordern ihn aber gerade durch ihre ‚Unsagbarkeit’ auf, sie sezierend zu bändigen und ihnen ein gedankliches Substrat abzugewinnen. Die „noch unbeschriebenen Beziehungen des Lebens”, die ihn als dunkle prima materia erschrecken und verunsichern, erfährt er gleichzeitig als erotische Verlockung, an der sein innerstes Ich zu wachsen sucht. Robert Musil (1880-1942), der Rationales und Irrationales nicht als unversöhnliche Gegensätze begriff , sondern beide Dimensionen aus wissenschaftlicher Sicht dichterisch miteinander verknüpfte, schildert in seinem ersten Roman Die Verwirrungen des Zöglings Törless (1906) geistige und körperliche Grenzüberschreitungen, die den Protagonisten dazu führen, „Dinge, Vorgänge und Menschen als etwas Doppelsinniges zu empfinden”. Das so entstandene Spannungsfeld fördert in Törless eine kreative Betrachtungsweise, die sich von gesellschaftlicher Wohlanständigkeit distanziert, dafür aber eine Selbstfindung ermöglicht, die unbewusste Zonen integriert und ihnen deshalb nicht zu verfallen braucht.
In der Konzentration auf die Innerlichkeit eines Jugendlichen mit Törless vergleichbar, lässt der Entwicklungsroman A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) den stolzen Stephen Dedalus einen Weg beschreiten, der sein Selbstbewusstsein stärkt und ihm neue Perspektiven eröffnet. Anders als Musil spiegelt James Joyce (1882-1941) in seinem irischen Helden jedoch eine traditionelle Dichotomie katholischer Prägung, die seiner Dichtung ebenso eigen ist wie ihre stilistischen Erneuerungen: [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. RELIGIÖSE VORAUSSETZUNGEN
- 2.1 Das Leib-Seele-Problem in der christlichen Tradition
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht das Leib-Seele-Problem als kreativen Impuls in Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törless“ und James Joyces „A Portrait of the Artist as a Young Man“. Die Arbeit vergleicht die Darstellung dieses Problems bei beiden Autoren und betrachtet dessen Einfluss auf ihr späteres Schaffen.
- Der Einfluss religiöser Traditionen auf die Konzeption des Leib-Seele-Problems
- Vergleichende Analyse der Darstellung des Leib-Seele-Problems bei Musil und Joyce
- Die Rolle des Leib-Seele-Problems als kreativer Antrieb für die künstlerische Entwicklung der Protagonisten
- Untersuchung der unterschiedlichen Lösungsansätze im Umgang mit dem Leib-Seele-Konflikt
- Ausblick auf das spätere Werk beider Autoren im Kontext der behandelten Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Untersuchung des Leib-Seele-Problems als kreativer Ansporn in Musils „Törless“ und Joyces „A Portrait of the Artist“. Sie führt die Problematik anhand von Zitaten aus beiden Werken ein, hebt die unterschiedlichen Zugänge zu dem Thema hervor und kündigt den vergleichenden Ansatz der Arbeit an. Die Einleitung skizziert Musils integrative Betrachtung von Rationalität und Irrationalität im Gegensatz zu Joyces traditioneller, durch die katholische Religion geprägten Dichotomie. Der Vergleich legt bereits die gegensätzlichen Wege zur Bewältigung des Leib-Seele-Konflikts bei den Protagonisten und Autoren vorweg.
2. RELIGIÖSE VORAUSSETZUNGEN: Dieses Kapitel, genauer der Abschnitt 2.1, befasst sich mit dem Leib-Seele-Problem im Kontext der christlichen Tradition. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von Körper und Seele, beginnend mit der Antike und der Herausbildung der Vorstellung von Körper und Seele als konstitutive Elemente des Menschen. Der Fokus liegt auf dem Mittelalter, wo ein Dualismus zwischen Körper und Seele betont wird, mit dem Körper als Hindernis auf dem Weg zur Erlösung. Augustinus' Sexualpessimismus und Thomas von Aquinos Lehre werden als Beispiele für die mittelalterliche Abwertung des Körpers und die Unterordnung der Sexualität unter religiöse Dogmen analysiert. Das Kapitel legt den historischen Hintergrund für das Verständnis des Leib-Seele-Problems bei Joyce und implizit dessen Einfluss auf die Darstellung bei Musil dar.
Schlüsselwörter
Leib-Seele-Problem, Robert Musil, James Joyce, Die Verwirrungen des Zöglings Törless, A Portrait of the Artist as a Young Man, Vergleichende Literaturwissenschaft, Religiöse Tradition, Katholische Theologie, Kreativität, Künstlerische Entwicklung, Dualismus, Moderne Literatur.
Häufig gestellte Fragen zu: Magisterarbeit zum Leib-Seele-Problem bei Musil und Joyce
Was ist das zentrale Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht das Leib-Seele-Problem als kreativen Impuls in Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törless“ und James Joyces „A Portrait of the Artist as a Young Man“. Im Mittelpunkt steht ein Vergleich der Darstellung dieses Problems bei beiden Autoren und dessen Einfluss auf ihr späteres Schaffen.
Welche Aspekte des Leib-Seele-Problems werden untersucht?
Die Arbeit betrachtet den Einfluss religiöser Traditionen auf die Konzeption des Leib-Seele-Problems, analysiert vergleichend die Darstellung bei Musil und Joyce, untersucht die Rolle des Problems als kreativer Antrieb für die künstlerische Entwicklung der Protagonisten, beleuchtet unterschiedliche Lösungsansätze im Umgang mit dem Leib-Seele-Konflikt und gibt einen Ausblick auf das spätere Werk beider Autoren im Kontext der Thematik.
Wie wird das Leib-Seele-Problem in der Einleitung eingeführt?
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung vor: die Untersuchung des Leib-Seele-Problems als kreativer Ansporn in Musils „Törless“ und Joyces „A Portrait of the Artist“. Sie führt die Problematik anhand von Zitaten ein, hebt unterschiedliche Zugänge hervor und kündigt den vergleichenden Ansatz an. Es wird ein Gegensatz zwischen Musils integrativer Betrachtung von Rationalität und Irrationalität und Joyces traditioneller, katholisch geprägter Dichotomie skizziert.
Was ist der Inhalt des Kapitels zu den religiösen Voraussetzungen?
Kapitel 2.1 befasst sich mit dem Leib-Seele-Problem im Kontext der christlichen Tradition. Es beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses von Körper und Seele, mit Fokus auf das Mittelalter und dem dort betonten Dualismus zwischen Körper und Seele. Augustinus' Sexualpessimismus und Thomas von Aquinos Lehre werden als Beispiele für die mittelalterliche Abwertung des Körpers analysiert. Das Kapitel legt den historischen Hintergrund für das Verständnis des Leib-Seele-Problems bei Joyce und dessen impliziten Einfluss auf Musil dar.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die Schlüsselwörter umfassen: Leib-Seele-Problem, Robert Musil, James Joyce, Die Verwirrungen des Zöglings Törless, A Portrait of the Artist as a Young Man, Vergleichende Literaturwissenschaft, Religiöse Tradition, Katholische Theologie, Kreativität, Künstlerische Entwicklung, Dualismus, Moderne Literatur.
Welche Werke werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert im Detail Robert Musils „Die Verwirrungen des Zöglings Törless“ und James Joyces „A Portrait of the Artist as a Young Man“ im Hinblick auf die Darstellung und Bewältigung des Leib-Seele-Problems.
Welchen Ansatz verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verfolgt einen vergleichenden Ansatz, der die Darstellung des Leib-Seele-Problems bei Musil und Joyce kontrastiert und die Einflüsse religiöser Traditionen und die daraus resultierende künstlerische Entwicklung der Protagonisten beleuchtet.
- Quote paper
- Cornelia Pechota (Author), 1995, Robert Musil und James Joyce. Das Leib-Seele-Problem als kreativer Ansporn in "Törless" und "A Portrait of the Artist", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271209