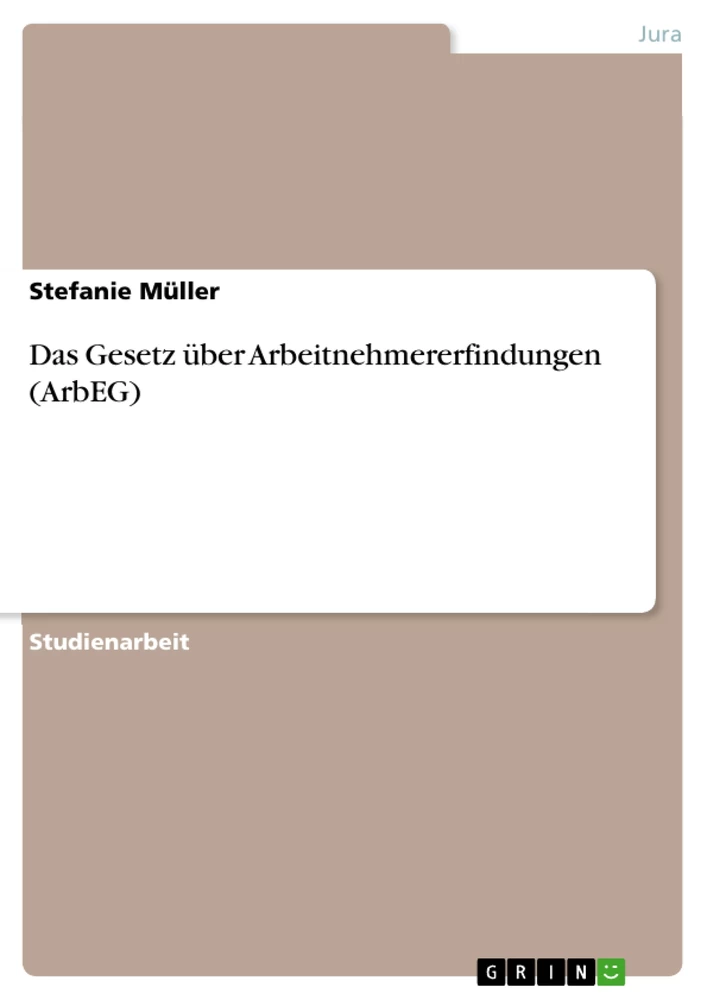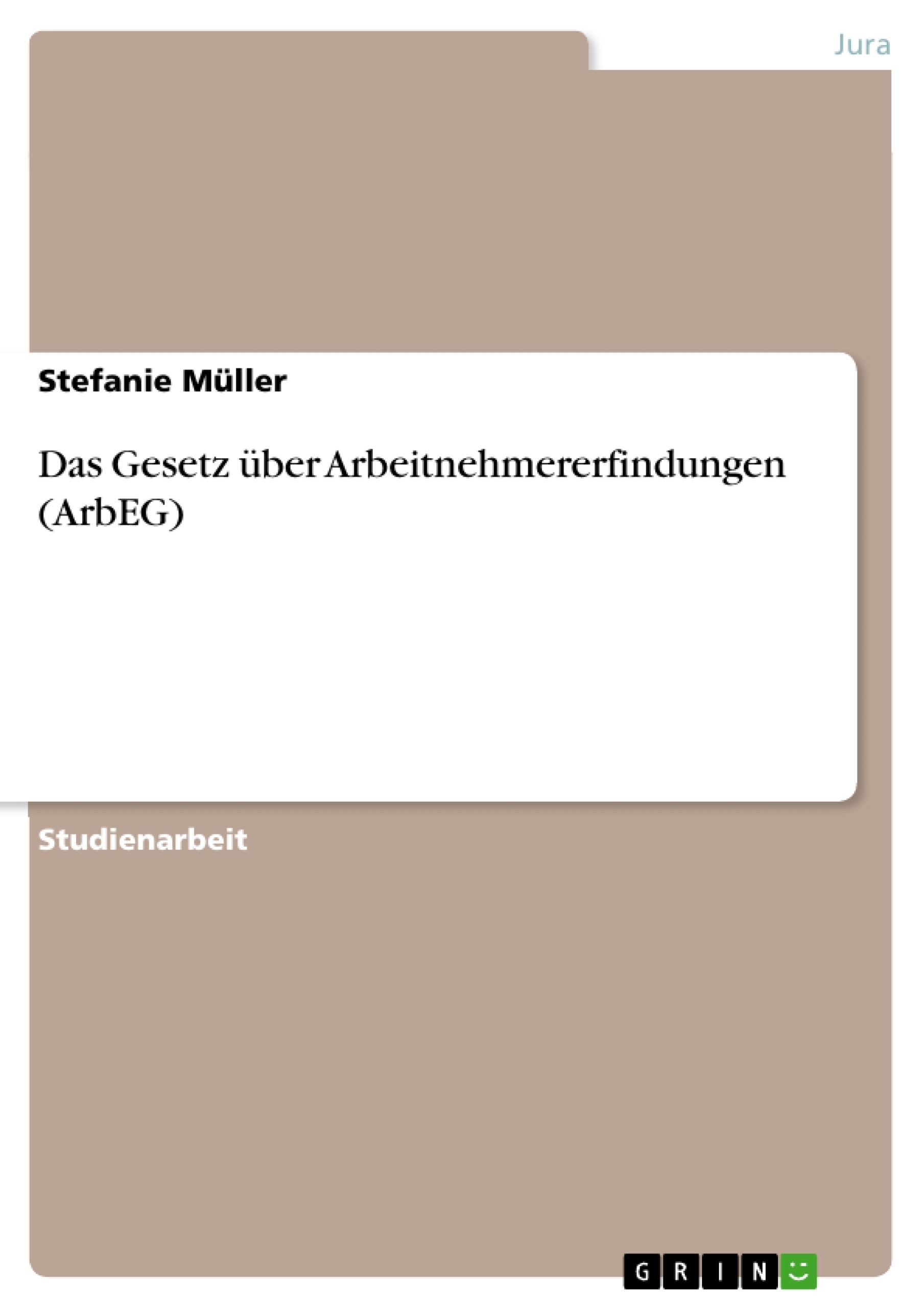„Jedem Erfolg geht eine Idee voraus.“1
Das Verständnis dieser auf den ersten Blick recht simpel erscheinenden Aussage ist von enormer Wichtigkeit. Denn überträgt man diesen Gedanken auf die Wirtschaft und die Unternehmen eines Landes, so wird verdeutlicht, was teilweise selbstverständlich erscheinen könnte: die Gedanken und Ideen der Mitarbeiter tragen entscheidend zum Erfolg eines Unternehmens bei und sind ein bedeutender Faktor für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft mit innovativen Produkten und Dienstleistungen.2 In der Rolle als Arbeitnehmer entwickelte Ideen sind kostbares geistiges Eigentum mit hohem wirtschaftlichen Potential, welche es zu schützen gilt. In diesem Zusammenhang tauchen konsequenterweise verschiedene Fragen auf: „gehört“ die Idee oder die Erfindung dem Arbeitnehmer oder dem Arbeitgeber? Wer ist berechtigt die Erfindung schützen zu lassen und wer darf die Erfindung nutzen? Das am 25. Juli 1957 in Kraft getretene Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)3 liefert Antworten auf diese Fragestellungen. Die vorliegende Arbeit skizziert die Grundzüge des Gesetzes und vermittelt dem Leser einen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung des Gesetzes
- Anwendungsbereich
- Diensterfindungen und freie Erfindungen
- Regelungen bei Diensterfindungen
- Erfindungsmeldung
- Inanspruchnahme oder Freigabe
- Schutzrechtsanmeldung
- Vergütungsanspruch
- Regelungen bei freien Erfindungen
- Regelungen bei technischen Verbesserungsvorschlägen
- Regelungen bei Diensterfindungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) und dessen Zielsetzung, den Interessenkonflikt zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber auszugleichen. Die Arbeit gibt einen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes.
- Die Interessen von Arbeitnehmererfindern und Arbeitgebern im Kontext von Erfindungen.
- Die Unterscheidung zwischen Diensterfindungen und freien Erfindungen.
- Die Regelungen des ArbEG bezüglich der Anmeldung und des Schutzes von Erfindungen.
- Die Vergütungsansprüche von Arbeitnehmererfindern.
- Der Anwendungsbereich des ArbEG im privaten und öffentlichen Dienst.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung von Mitarbeiterideen für den Unternehmenserfolg und die Notwendigkeit, diese zu schützen. Sie führt in die Problematik des Eigentums an Arbeitnehmererfindungen ein und kündigt eine Übersicht über das ArbEG an.
Zielsetzung des Gesetzes: Dieses Kapitel beschreibt die Zielsetzung des ArbEG als Ausgleich der Interessen zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber. Es erklärt das Erfinderprinzip und betont die besondere Stellung von Arbeitnehmererfindungen, da der Arbeitgeber ebenfalls einen Beitrag zur Erfindung leistet (Bereitstellung von Mitteln, Vergütung, Tragen des wirtschaftlichen Risikos). Das ArbEG fungiert als Kollisionsnorm zwischen arbeitsrechtlichen und erfinderrechtlichen Grundsätzen.
Anwendungsbereich: Der Anwendungsbereich des ArbEG umfasst Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen und privaten Dienst, sowie von Beamten und Soldaten. Sachlich beschränkt sich das Gesetz auf technische Neuerungen, die patent- und gebrauchsmusterfähig sind, und schließt urheberrechtlich geschützte Werke aus.
Diensterfindungen und freie Erfindungen: Dieses Kapitel differenziert zwischen Diensterfindungen (gebundene Erfindungen, die aus der Tätigkeit des Arbeitnehmers resultieren oder auf Erfahrungen/Arbeiten des Arbeitgebers beruhen) und freien Erfindungen. Es erläutert den Unterschied zwischen Auftrags- und Erfahrungserfindungen und hebt die Bedeutung der Verbindung zwischen der Arbeitnehmertätigkeit und der Erfindung hervor.
Schlüsselwörter
Arbeitnehmererfindungen, ArbEG, Diensterfindung, freie Erfindung, Erfinderprinzip, gewerblicher Rechtsschutz, Arbeitsrecht, Vergütung, Patent, Gebrauchsmuster, Interessenkonflikt, Anwendungsbereich.
Häufig gestellte Fragen zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG)
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) und dessen Zielsetzung, den Interessenkonflikt zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber auszugleichen. Sie gibt einen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Interessen von Arbeitnehmererfindern und Arbeitgebern im Kontext von Erfindungen, die Unterscheidung zwischen Diensterfindungen und freien Erfindungen, die Regelungen des ArbEG bezüglich Anmeldung und Schutz von Erfindungen, die Vergütungsansprüche von Arbeitnehmererfindern und den Anwendungsbereich des ArbEG im privaten und öffentlichen Dienst.
Was ist die Zielsetzung des ArbEG?
Das ArbEG zielt darauf ab, den Interessenkonflikt zwischen Arbeitnehmererfinder und Arbeitgeber auszugleichen. Es berücksichtigt das Erfinderprinzip und die besondere Stellung von Arbeitnehmererfindungen, da der Arbeitgeber ebenfalls einen Beitrag zur Erfindung leistet (Bereitstellung von Mitteln, Vergütung, Tragen des wirtschaftlichen Risikos). Das ArbEG fungiert als Kollisionsnorm zwischen arbeitsrechtlichen und erfinderrechtlichen Grundsätzen.
Was ist der Anwendungsbereich des ArbEG?
Das ArbEG umfasst Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Arbeitnehmern im öffentlichen und privaten Dienst, sowie von Beamten und Soldaten. Sachlich beschränkt es sich auf technische Neuerungen, die patent- und gebrauchsmusterfähig sind, und schließt urheberrechtlich geschützte Werke aus.
Wie werden Diensterfindungen und freie Erfindungen unterschieden?
Diensterfindungen sind gebundene Erfindungen, die aus der Tätigkeit des Arbeitnehmers resultieren oder auf Erfahrungen/Arbeiten des Arbeitgebers beruhen. Freie Erfindungen entstehen hingegen außerhalb des Arbeitsverhältnisses. Die Arbeit erläutert den Unterschied zwischen Auftrags- und Erfahrungserfindungen und hebt die Bedeutung der Verbindung zwischen der Arbeitnehmertätigkeit und der Erfindung hervor.
Welche Regelungen enthält das ArbEG bezüglich Diensterfindungen?
Das ArbEG regelt die Erfindungsmeldung, die Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung durch den Arbeitgeber, die Schutzrechtsanmeldung und den Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das ArbEG?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Arbeitnehmererfindungen, ArbEG, Diensterfindung, freie Erfindung, Erfinderprinzip, gewerblicher Rechtsschutz, Arbeitsrecht, Vergütung, Patent, Gebrauchsmuster, Interessenkonflikt, Anwendungsbereich.
- Citar trabajo
- Stefanie Müller (Autor), 2013, Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/271206