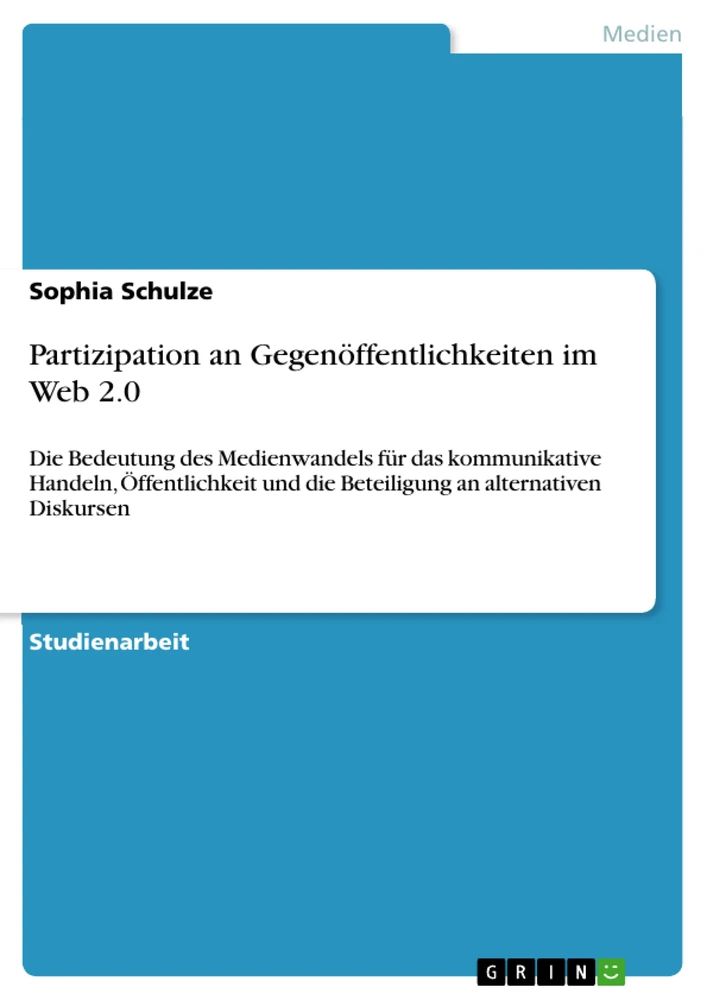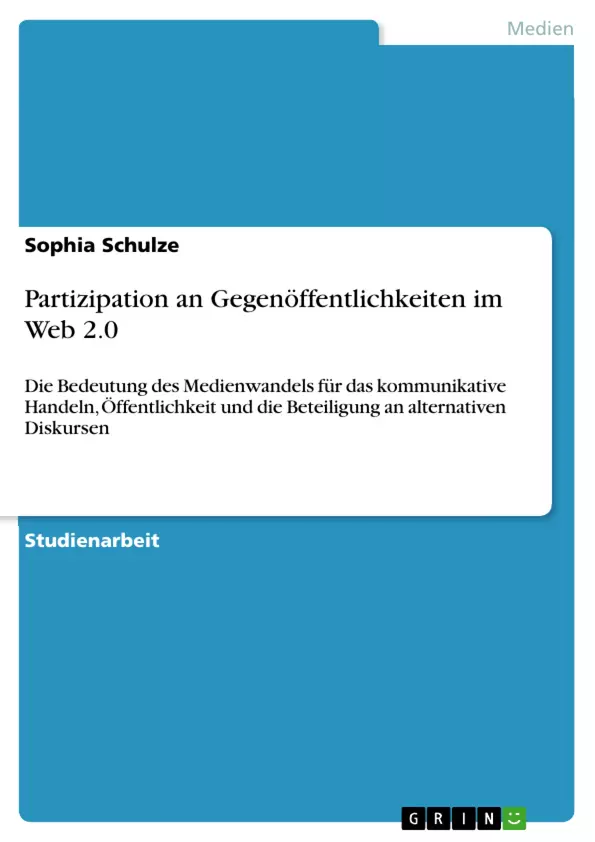"Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, d.h., er würde es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen, also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müßte demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren." (Brecht 1967 [1932]; zitiert nach Roesler/Stiegler 2005: 219)
Diese Überlegungen bezüglich des Potenzials von Rundfunk, den Hörer aktiv in die Produktion von Inhalten einzubinden, damit der Hörer auch über das Radio kommunizieren kann, um in Gespräche und Debatten einbezogen zu werden, stellte Bertolt Brecht bereits vor 80 Jahren. Er erkannte in dieser damals neuen Form der öffentlichen Kommunikation ungeahnte Möglichkeiten, dem Normalbürger in gesellschaftliche Fragestellungen einzubeziehen, statt ihn lediglich mit Inhalten zu versorgen. Heute wissen wir, dass diese Vor-stellungen utopisch waren und diese Form der Integration des Bürgers lediglich in Bürgerradios mit recht geringer Reichweite realisiert wurde. Heute wissen wir aber auch, dass sich die Medien seitdem enorm gewandelt haben und es mit dem Internet mittlerweile ein Medium gibt, mit dessen Hilfe Normalbürger mit weit weniger Aufwand ihre Positionen und Ansichten der Öffentlichkeit vermitteln können. Mit der Verbreitung digitaler Medien und der weltweiten Vernetzung durch das Internet bis hin zur Entwicklung der Sozialen Medien waren vor allem am Anhang Hoffnungen verbunden, die der Vorstellung Brechts sehr nahe kamen. Vom „Abbau von Informationsungleichheiten und der Belebung von demokratischer Diskurse“ (Schmidt 2012: 4) und von der Annahme „das Internet erweitere und erneure die politische Bildung“ (Emmer/Vowe 2004: 192) war die Rede, ebenso davon, dass die Verbreitung des Web in der Lage wäre „den Dialog der Bürger untereinander zu fördern […]. Es sollte dadurch eine Mobilisierung bislang unterrepräsentierter oder nicht engagierter Bevölkerungsteile erreich[t werden], die sich online in politische Prozesse einbringen können“ (Schmidt 2006: 140).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienwandel und Kommunikationswandel
- Mediatisierung im digitalen Zeitalter
- Vom WWW zum Web 2.0 - neue Möglichkeiten der Partizipation
- (Gegen-)Öffentlichkeitswandel
- Normatives Idealbild und Arenamodell von Öffentlichkeit im Wandel
- Gegenöffentlichkeit und Partizipation im Wandel
- Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der Beteiligung an kritischer Öffentlichkeit im Web 2.0
- Unabgeschlossenheit des Publikums
- Offenheit gegenüber Themen und Meinungen
- Gleichheit der Teilnehmer
- Diskursivität
- Fallbeispiel 1: BILDblog
- Fallbeispiel 2: Protestbewegung gegen das Bauprojekt Stuttgart 21 auf Facebook und Twitter
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Bedeutung des Medienwandels für das kommunikative Handeln, die Öffentlichkeit und die Beteiligung an alternativen Diskursen im Web 2.0. Er analysiert die Chancen und Grenzen der Partizipation an Gegenöffentlichkeiten im digitalen Zeitalter und untersucht, wie sich der Medienwandel auf das kommunikative Verhalten der Bürger, die Öffentlichkeit und die Bildung von Gegenöffentlichkeit ausgewirkt hat.
- Mediatisierung im digitalen Zeitalter und die Folgen für die Mediennutzung und das kommunikative Verhalten
- Die Entwicklung des Internets von einem Informationsmedium zu einem Interaktionsmedium und die neuen Möglichkeiten des Austausches und der Vernetzung
- Theoretische Entwürfe von Öffentlichkeit von Jürgen Habermas sowie Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt und der Wandel von Gegenöffentlichkeit im digitalen Zeitalter
- Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation an Gegenöffentlichkeiten im Web 2.0
- Chancen und Herausforderungen für die Meinungsbildung und Bürgerbeteiligung im digitalen Zeitalter
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Partizipation an kritischen Öffentlichkeiten im Web 2.0. Die Kapitel 2 und 3 widmen sich dem Medienwandel und dem (Gegen-)Öffentlichkeitswandel im digitalen Zeitalter. Kapitel 2.1 analysiert die Mediatisierung im digitalen Zeitalter und die Folgen für die Mediennutzung und das kommunikative Verhalten. Kapitel 2.2 betrachtet die Entwicklung des Internets von einem Informationsmedium zu einem Interaktionsmedium. Kapitel 3 untersucht die theoretischen Entwürfe von Öffentlichkeit von Jürgen Habermas sowie Jürgen Gerhards und Friedhelm Neidhardt und den Wandel von Gegenöffentlichkeit im digitalen Zeitalter.
Schlüsselwörter
Medienwandel, Kommunikationswandel, Web 2.0, Partizipation, Gegenöffentlichkeit, digitale Öffentlichkeit, Meinungsbildung, Bürgerbeteiligung, Mediatisierung, Interaktion, Habermas, Gerhards, Neidhardt, Diskursivität.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Gegenöffentlichkeit?
Gegenöffentlichkeit bezeichnet alternative Kommunikationsräume, in denen Themen und Meinungen verhandelt werden, die in den etablierten Massenmedien unterrepräsentiert sind oder kritisch hinterfragt werden.
Wie hat das Web 2.0 die politische Partizipation verändert?
Das Internet hat sich von einem reinen Informationsmedium zu einem Interaktionsmedium entwickelt. Bürger können nun mit geringem Aufwand eigene Inhalte produzieren, sich vernetzen und Diskurse mitgestalten (z. B. via Social Media).
Welche Rolle spielen Fallbeispiele wie der BILDblog?
Der BILDblog ist ein Beispiel für eine Medien-Gegenöffentlichkeit, die die Berichterstattung von Massenmedien kritisch kontrolliert und korrigiert, was früher in diesem Ausmaß kaum möglich war.
Was sind die Grenzen der Partizipation im Internet?
Trotz der Offenheit gibt es Hürden wie Informationsungleichheiten, die Gefahr von „Filterblasen“ und die Tatsache, dass nicht alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen online aktiv sind.
Was ist das „Arenamodell“ von Öffentlichkeit?
Das Modell nach Gerhards und Neidhardt beschreibt Öffentlichkeit als ein System verschiedener Ebenen (vom Stammtisch bis zu den Massenmedien), in dem Themen „nach oben“ wandern und dort Beachtung finden.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Sophia Schulze (Author), 2012, Partizipation an Gegenöffentlichkeiten im Web 2.0, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270975