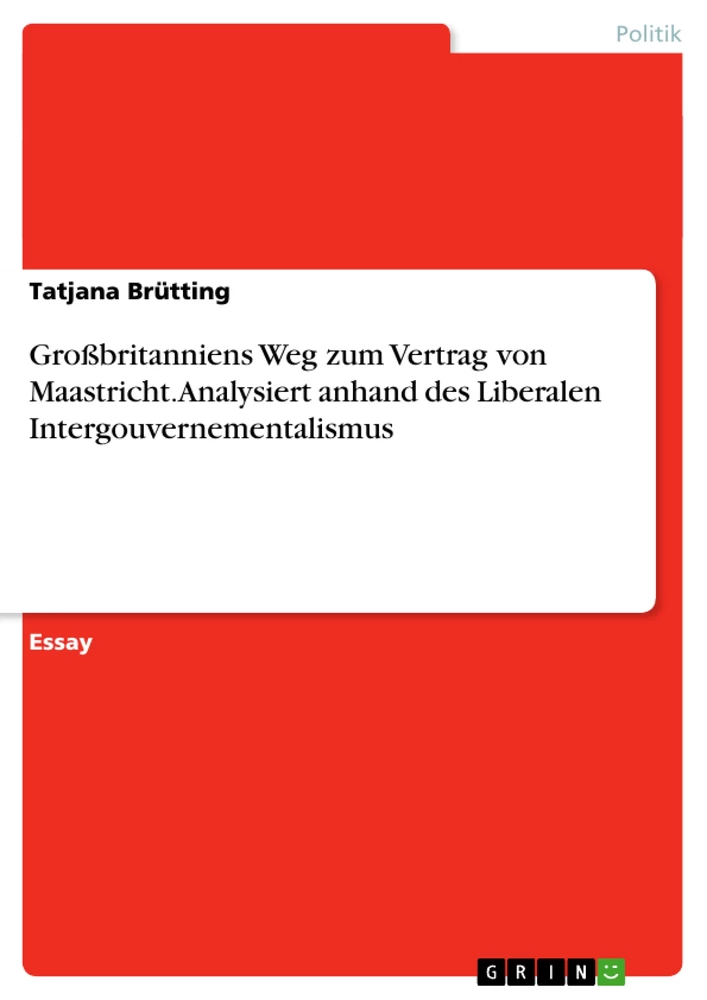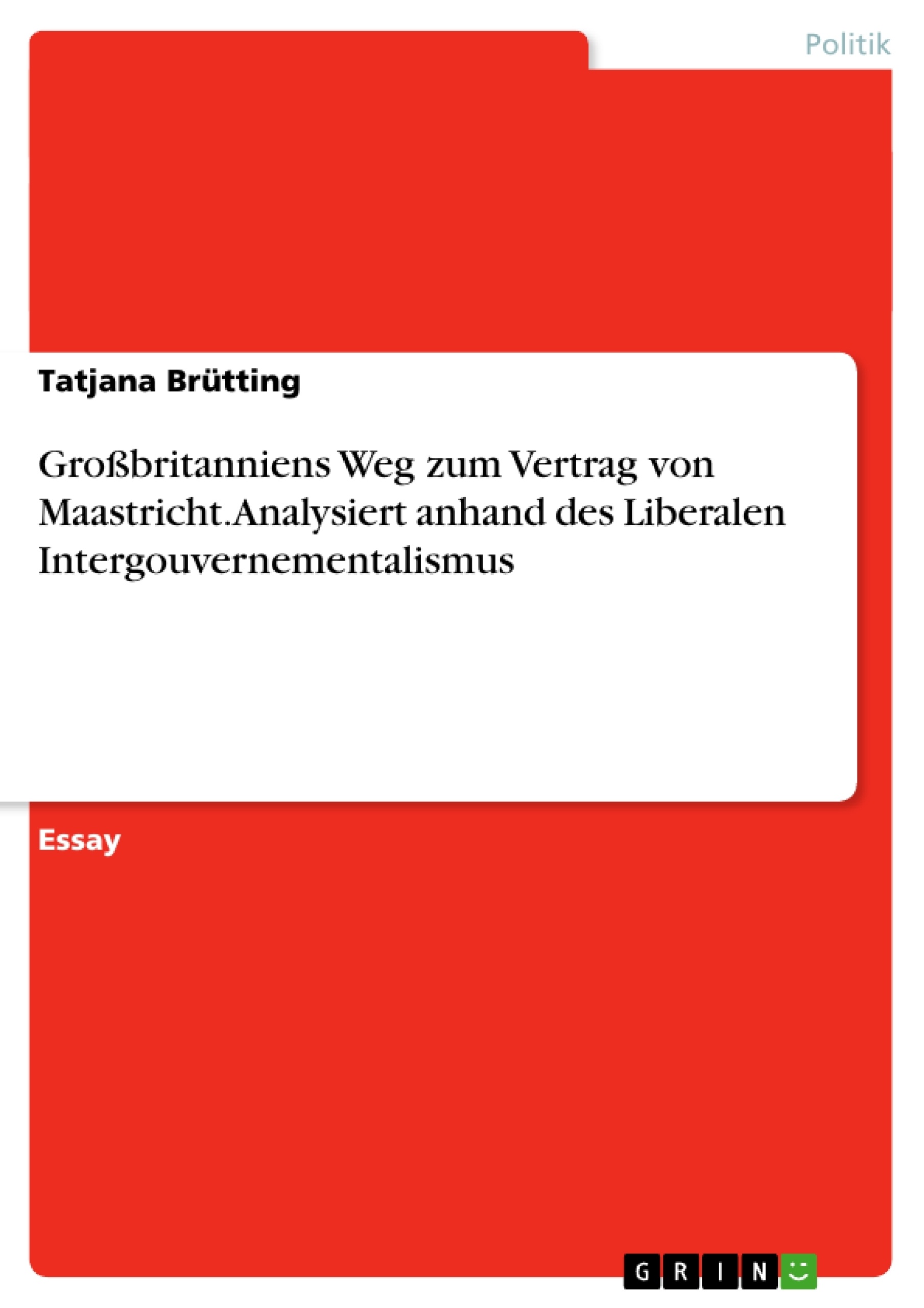Die Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht am 07. Februar 1992 gilt als offizielle Gründung der europäischen Union. Mit ihm wurden die 1957 in Rom unterschriebenen Gründungsverträge zur Schaffung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ausgeweitet. Der Unterzeichnung von zunächst 12 Mitgliedsstaaten ging ein Einigungsprozess voraus, der in diesem Essay mit Blick auf die Außenpolitik Großbritanniens betrachtet werden soll.
Im europäischen Integrationsprozess spielt Großbritannien seit jeher eine besondere Rolle. So
unterschied sich die britische Außenpolitik in Hinsicht auf eine europäische Integration von den
kontinentaleuropäischen Partnern in wesentlichen Punkten. Die besondere Auffassung des britischen Volkes und der Regierung von einem zentral organisierten Europa, zieht sich konstant durch die Integrationsgeschichte der EU. So trat die Insel zum Beispiel erst 1973 der EG bei. Deutlich werden die politischen Unterschiede Großbritanniens eben vor Allem auch bei diesem bisher größten Schritt der europäischen Integration seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft, dem Vertrag von Maastricht. So wollte Großbritannien auch am EU- Binnenmarkt zunächst nicht teilnehmen, dieser beinhaltet unter anderem die Abschaffung der Zölle und einen freien Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistung und Personen. Die aufkommende Frage bei dem Zustandekommen dieses Integrationsschrittes ist: Warum einigte sich Großbritannien trotz seiner
skeptischen politischen Einstellung gegenüber einem gemeinsamen Europa, mit den anderen Mitgliedsstaaten auf den Vertrag von Maastricht? Diese Frage soll nun anhand des Liberalen Intergouvernementalismus von Andrew Moravcsik analysiert werden. Hierfür werden im nächsten Kapitel die für uns relevanten Aspekte der Integrationstheorie des Liberalen Intergouvernementalismus herausgearbeitet und die Theorie anschließend im darauffolgenden Kapitel auf den Fall Großbritannien und den Vertrag von Maastricht angewendet.
Inhaltsverzeichnis:
1 Einleitung
2 Der Liberale Intergouvernementalismus nach Andrew Moravcsik
3 Großbritanniens Außenpolitik zur europäischen Integration - Der Vertrag von Maastricht
4 Zusammenfassung und Fazit
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht am 07. Februar 1992, gilt als offizielle Gründung der europäischen Union. Mit ihm wurden die 1957 in Rom unterschriebenen Gründungsverträge zur Schaffung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ausgeweitet. Der Unterzeichnung von zunächst 12 Mitgliedsstaaten ging ein Einigungsprozess voraus, der in diesem Essay mit Blick auf die Außenpolitik Großbritanniens betrachtet werden soll.
Im europäischen Integrationsprozess spielt Großbritannien seit jeher eine besondere Rolle. So unterschied sich die britische Außenpolitik in Hinsicht auf eine europäische Integration von den kontinentaleuropäischen Partnern in wesentlichen Punkten. Die besondere Auffassung des britischen Volkes und der Regierung von einem zentral organisierten Europa, zieht sich konstant durch die Integrationsgeschichte der EU. So trat die Insel zum Beispiel erst 1973 der EG bei. Deutlich werden die politischen Unterschiede Großbritanniens eben vor Allem auch bei diesem bisher größten Schritt der europäischen Integration seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft, dem Vertrag von Maastricht. So wollte Großbritannien auch am EU- Binnenmarkt zunächst nicht teilnehmen, dieser beinhaltet unter anderem die Abschaffung der Zölle und einen freien Verkehr von Waren, Kapital, Dienstleistung und Personen. Die aufkommende Frage bei dem Zustandekommen dieses Integrationsschrittes ist: Warum einigte sich Großbritannien trotz seiner skeptischen politischen Einstellung gegenüber einem gemeinsamen Europa, mit den anderen Mitgliedsstaaten auf den Vertrag von Maastricht? Diese Frage soll nun anhand des Liberalen Intergouvernementalismus von Andrew Moravcsik analysiert werden. Hierfür werden im nächsten Kapitel die für uns relevanten Aspekte der Integrationstheorie des Liberalen Intergouvernementalismus herausgearbeitet und die Theorie anschließend im darauffolgenden Kapitel auf den Fall Großbritannien und den Vertrag von Maastricht angewendet.
2 Der Liberale Intergouvernementalismus nach Andrew Moravcsik
Die Theorie des Liberalen Intergouvernementalismus (nachfolgend LI) nach Andrew Moravcsik stellt den internationalen europäischen Integrationsprozess von Staaten als eine Abfolge von Vertragsverhandlungen dar, denen ein Drei-Stufen-Modell zu Grunde liegt. Er berücksichtigt hierbei vor Allem die innerstaatliche Präferenzbildung im ersten Schritt des Integrationsvorgangs und sieht die Wahl oder Gründung einer supranationalen Organisation, zur Sicherung der Integrationsverhandlungen, als Ergebnis.
Moravczsik stellt Staaten hierbei als die wichtigsten Akteure im Integrationsprozess heraus, die nach außen rational handeln und ihre eigenen Interessen verfolgen. Wie dies möglich ist beschreibt er in den drei Stufen seines Integrationsmodells. Die erste Stufe beinhaltet die innerstaatliche Präferenzbildung. Vor Allem ökonomische Interdependenzen beeinflussen während dieser ersten Stufe die unterschiedlichen Präferenzen rationaler innerstaatlicher Akteure. Die sozialen Akteure (z.B. Parteien, Gewerkschaften, Interessenvertreter) liefern sich einen Wettstreit um die politische Ausrichtung der nationalen Positionen.
'By preferences, I designate not simply a particular set of policy goals but a set of underlying national objectives independent of any particular international negotiation to expand exports, to enhance security vis-à-vis a particular threat, or to realize some ideational goal.' (Moravcsik 1998: 20)
Die staatlichen Präferenzen sind laut Moravcsik auch keinesfalls fest verankert und in jedem Land gleich. Viel mehr variieren sie zwischen den unterschiedlichen Ländern oder innerhalb eines Landes während der Zeit und je nach Themengebiet (Moravcsik 2008). Vor Allem unterschiedliche Themengebiete führen dazu, dass verschiedene Gruppen, mit unterschiedlichen Präferenzen miteinander konkurrieren und sich somit, abhängig von diesem Wettbewerb auch je nach Sachverhalt, der innerstaatliche Willen bildet.
Die gebildeten innerstaatlichen Präferenzen führen nun zum zweiten Schritt des Integrationsprozesses. Auf der zweiten Stufe entwickeln Staaten Strategien und die jeweils nationalen Regierungen verhandeln miteinander um Vereinbarungen zu treffen, welche die nationalen Präferenzen effizienter realisieren als einseitige Vorgehen (Moravcsik 1998: 20). Diese Verhandlungen bezeichnet Moravcsik als Grand Bargaining. Dem liegt eine rationale Kosten-Nutzen-Analyse der Nationalstaaten zu Grunde, die durch zunehmende Interdependenz zu einer Liberalisierung ihrer Märkte gezwungen sind. Darüber hinausgehende politische Integration ist nur das Ergebnis zwischenstaatlicher Verhandlungsprozesse sowie Kompromisslösungen („package deals“ oder „side-payments“). Die Verhandlungen werden an dieser Stelle, im Bezug auf die europäische Integration, klar von ökonomischen Interessen dominiert. Diese Bargaining-Prozesse zeichnen sich durch asymmetrische Interdependenzen aus. Entscheidend hierbei ist die Bargaining- Power eines jeden Landes. Diese ist abhängig von der ungleichen Verteilung von Gütern und Informationen über Präferenzen und Vereinbarungen. Staaten müssen an dieser Stelle, laut Moravcsik, gemeinsam suboptimale Ergebnisse überwinden und Koordination oder Kooperation zum gegenseitigen Nutzen erreichen, aber gleichzeitig müssen sie entscheiden, wie die gegenseitigen Gewinne der Zusammenarbeit zwischen den Staaten verteilt sind (Moravcsik and Schimmelfennig 2009: 71). Staaten die nicht auf eine spezifische Vereinbarung angewiesen sind, können andere Staaten hier am effektivsten mit Nicht-Kooperation bedrohen und somit Zugeständnisse erzwingen. Im Gegensatz dazu, müssen Staaten, die auf die Kooperation angewiesen sind den Präferenzen der anderen nachgeben, da sie über keine attraktiven Alternativoptionen verfügen. Das Verhandlungsergebnis liegt am Ende auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Wichtig ist auch, dass supranationale Organisationen auf dieser zweiten Stufe keine Rolle spielen.
Internationale Institutionen kommen erst jetzt, bei dem dritten und letzten Schritt des Integrationsvorgangs zum Einsatz. Staaten bündeln („Pooling“) oder delegieren ihre Souveränität nun an europäische Institutionen um sich glaubhaft an ihre Kooperationsverpflichtungen zu binden („credible commitment“). Diese Bindung senkt unter anderem die Transaktionskosten und erhöht die Erwartungssicherheit der Staaten durch kontrollierte Regeln und Sanktionen. Im gleichen Zug sollen die Kosten einer kurzfristigen Defektion erhöht werden. Ferner werden vereinbarte Verträge vor dem wechselnden Einfluss innerstaatlicher Politik bewahrt. Moravcsik bezieht sich in diesem Schritt vor Allem auf die Regimetheorie: die Entscheidung von Delegation oder Pooling der Souveränität in internationalen Regimen ist analytisch getrennt von Verhandlungen über die inhaltliche Zusammenarbeit (Moravcsik 1998: 21). Beim Institutional Choice kommt es für die Staaten zu einem trade-off zwischen Delegation von Souveränität und Kontrolle. Dabei wird Delegation von innerstaatlichen Gruppen, die von einer zukünftigen Kooperation profitieren, bevorzugt.
Moravcsiks Liberaler Intergouvernementalismus erklärt anhand innerstaatlicher Präferenzbildung, zwischenstaatlicher Verhandlungen und letztendlich dem Institutional Choice, den Vorgang einer europäischen Integration. Außerdem verdeutlicht er, dass Staaten sich auf Grand Bargaining konzentrieren um ihren innerstaatlichen Willen durchzusetzen. Liegt das Ergebnis der Verhandlungen im erwünschten Rahmen, sind Staaten bereit ihre Souveränität in internationalen Institutionen zu bündeln oder sie zu delegieren. Diese Theorie soll nun an der britischen Außenpolitik auf dem Weg zum Vertrag von Maastricht getestet werden.
3 Großbritanniens Außenpolitik zur europäischen Integration - Der Vertrag von Maastricht
Nachfolgend soll Großbritanniens Außenpolitik, im Bezug auf den Vertrag von Maastricht, aus der Sicht des Liberalen Intergouvernementalismus analysiert werden. Dabei wird herausgearbeitet welche innerstaatlichen Präferenzen in Großbritannien gebildet wurden, wie die britische Regierung auf europäischer Ebene verhandelt hat und wie es letztendlich zum Vertrag von Maastricht und diesem Schritt der europäischen Integration kam.
Mit dem Vertrag von Maastricht hat der europäische Integrationsprozess eine neue Ebene erreicht. Erstmals sollen nun nationalstaatliche Kompetenzen an die Gemeinschaft abgegeben werden. Die Einführung einer gemeinsamen Währung, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, eine verstärkte Zusammenarbeit der Innen- und Rechtspolitik sowie ein EU-Binnenmarkt stehen auf dem Programm. Im Gegensatz zu anderen Staaten, die einen Ausbau der europäischen Macht als Konkurrenz für die USA und Japan ansehen, hatte Großbritannien eine tiefe Abneigung gegen den Gedanken des Föderalismus. Nationaler Souveränität ist somit aus britischer Sicht Vorrang zu geben vor europäischer Verflechtung (Volle 1994: 385). So verwundert auch der britische Widerstand gegen jegliche Ausdehnung der sozialpolitischen Komponente der Gemeinschaft und die Weigerung einer Währungsunion beizutreten, wie es die Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht anstreben, nicht.
Wie sich dieser innerstaatliche Willen im Bezug auf den Vertrag über die europäische Union gebildet hat wird nun auf der ersten Stufe des Liberalen Intergouvernementalismus analysiert. Betrachtet werden an dieser Stelle schon die Anfänge der europäischen Integration. So war es aus britischer Sicht zum Beispiel zunächst unmöglich, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beizutreten. Unter Anderem die engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Commonwealth, die Sonderbeziehungen zu den USA, die Unantastbarkeit der Souveränität des britischen Parlaments, besondere rechtliche, verfassungsmäßige, politische und soziale Traditionen sowie vor Allem der EWG- Anspruch der Supranationalität wurden als Hinderungsgründe genannt. Doch als die westeuropäischen Staaten im sozialen und wirtschaftlichen Bereich gegenüber Großbritannien Fortschritte zu verzeichnen hatten, konnte sich die Insel nicht mehr völlig von dem Integrationsprozess fernhalten. Angesichts „eines sinkenden Pfund-Kurses, wirtschaftlich rückständiger Industrien, einer verkrusteten Klassengesellschaft und veralteten Methoden war eine Anbindung an die […] EWG nur folgerichtig“ (Volle 1989: 7). Diese Punkte des britischen Integrationsgedankens änderten sich auch bis zu den Verhandlungen zum Vertrag von Maastricht, nicht grundlegend. Vor Allem die Idee der Vollendung eines gemeinsamen EU-Binnenmarktes der Wachstum, Wettbewerb und economies of scale als Ziele hat, scheint unter den Gewerkschaftern immer sympathischer zu werden. Die zu dieser Zeit in der Opposition befindlichen Labour-Party wechselte von einem euroskeptischen Wahlprogramm hin zu einer weitgehend europäischen Politik (Sturm 2009: 215). „Die EG wurde nun für die Partei und die sie tragenden Gewerkschaften zum Hoffnungsträger im Kampf gegen den Thatcherismus und für den Erhalt sozialer Rechte“ (Sturm 2009: 215). Jedoch ist dieses Vorgehen nicht als Integrationsfreundlichkeit misszuverstehen, sondern beruht mir auf einer innerpolitischen Strategie. Ziel war es jetzt, nach dem Regierungswechsel von Margaret Thatcher zu John Major, die machtpolitischen Möglichkeiten des Landes konstruktiv zu nutzen um britische Interessen durchzusetzen. „The message of the 'Heart of Europe' speech has been mispresented ever since. It was never code for a federalist agenda. It was a signal that Britain was going to play an active part in the Maastricht negotiations.“ (Hogg, Hill 1995: 79).
Zu diesen besagten Verhandlungen kommt es auf der zweiten Stufe des Liberalen Intergouvernementalismus. Der angestrebte EU-Binnenmarkt, welcher freien Verkehr von Kapital, Dienstleistung, Personen und Waren beinhaltet lag im gemeinsamen Interesse der verhandelnden Staaten. Zu diesem sind die Staaten, aus der Sicht des Liberalen Intergouvernementalismus, auf Grund zunehmender Interdependenzen gezwungen. So auch Großbritannien, da der Pfund-Kurs zu sinken droht und andere Staaten einen Vorsprung gegenüber der, wirtschaftlich und sozial zurückgeworfenen, Insel haben könnten. Andere Themen wie zum Beispiel eine gemeinsame Währungsunion waren an dieser Stelle umstrittener. Das Vereinigte Königreich verhielt sich weiterhin skeptisch. Es verhinderte die Beschlüsse zur gemeinsamen Währungsunion zwar nicht, „hielt sich aus diesem Schritt aber ebenso heraus wie aus der Europäischen Sozialcharta“ (Sturm 2009: 216). So haben lediglich Großbritannien und Dänemark eine so genannte Opting- Out- Klausel, welche ihnen die Möglichkeit offen hält an der Währungsunion teilzunehmen. Diese zahlt sich aus britischer Sicht nicht aus, trotz eines sinkenden Pfund-Kurses hat die britische Währung noch eine stärkere Stellung als eine gemeinsame europäische Währung mit sich bringt. Diese „Nichtteilnahme-Klausel war die Voraussetzung dafür, dass das Vereinigte Königreich dem Vertrag insgesamt zustimmte.“ (europa.eu 2006). Durch dieses Grand Bargaining konnte Großbritannien auf dieser Stufe den Vorteil der Opting- Out- Klausel für sich gewinnen. Nach Abschluss der Vertragsverhandlungen stand fest, dass Großbritannien unter Bedingungen dem Vertrag zur Gründung der europäischen Union zustimmt. „'Spiel, Satz und Sieg für Großbritannien', so kommentierte die britische Massenpresse John Majors Auftritt in Maastricht“ (Sturm 2009: 216). Es ist zu verzeichnen, dass Großbritannien in diesem Einigungsprozess eine große Bargaining-Power zugeschrieben wird, da die kontinentaleuropäischen Europa-Staaten sehr interessiert am Beitritt der Insel hatten. Somit können auch sie sich wirtschaftliche Vorteile durch günstigeren Ex- nund Import ziehen und das Vereinigte Königreich steht unter Beobachtung der EU. Dass man sich auch auf polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit einigte liegt dem Gedanken der package-deals zu Grunde, da ein gemeinsamer EU-Binnenmarkt mit freiem Personen- und Warenverkehr nur so Sinn gibt.
Im dritten und letzten Schritt fand ein Pooling von Souveränität der Mitgliedsstaaten statt und die
Delegation dieser Souveränität an die EU. Die drei Säulen des Vertrages von Maastricht beinhalten letztendlich die europäische Gemeinschaft, eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik sowie eine gemeinsame Innen- und Justizpolitik. Der Vertrag von Maastricht wurde also auf Basis des Liberalen Intergouvernementalismus realisiert und ein weiter Schritt europäischer Integration wurde absolviert.
4 Zusammenfassung und Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Liberale Intergouvernementalismus nach Andrew Moravcsik erklärt, warum es trotz der anfangs euroskeptischen Außenpolitik Großbritanniens zum Vertrag von Maastricht gekommen ist. In Großbritannien lief der Drei-Stufen-Prozess des LI ab. Nach dem sich der innerstaatliche Willen nach einem gemeinsamen Binnenmarkt aber keiner gemeinsamen Währung und Sozialcharta gebildet hat, verhandelte man auf zweiter Ebene international und konnte sich mit den anderen Staaten dank einer Opting-Out-Klausel auf einen gemeinsamen Vertrag einigen. Anschließend wurde Souveränität an die internationale Institution, die EU übertragen, um sich glaubhaft an die Vertragsbedingungen zu binden und Transaktionskosten zu reduzieren. Allgemein lässt sich sagen, dass die britische Regierung sehr geschickt verhandelt hat und nun selbst entscheiden kann, wann Großbritannien bereit ist einer Währungsunion beizutreten. Aktuell stellt sich wiederum die Frage inwieweit sich die EU für Großbritannien überhaupt noch lohnt. So hat Margaret Thatcher in den 80er Jahren zwar einen Rabatt heraus gehandelt, die Insel bleibt jedoch weiterhin der viertgrößte Nettozahler in die EU. Diese Kosten würden (laut umstrittenen Zahlen) den Nutzen des Binnenmarktes bereits übersteigen (spiegel.de 2013). Wohin die britische Außenpolitik in Bezug auf Europa also in Zukunft führen wird, bleibt ungewiss.
Literatur
europa.eu2006 [Online]: Vereinigtes Königreich: Klausel über die Nichtteilnahme an der WWU. Verfügbar unter:
http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/institutional_and_economi c_framework/l25060_de.htm [14.03.13]
Hogg, Sarah/Hill, Jonathan 1995: Too close to call. Power and Politics - John Major in No. 10, London: Little, Brown Book Group Limited
Sturm Roland, 2009: Politik in Großbritannien, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften
Moravcsik Andrew1991: Negotiating the Single European Act: national interests and conventional statecraft in the European Community, World Peace Foundation and the Massachusetts Institute of Technology
Moravcsik Andrew1998: The Coice for Europe. Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht, New York: Cornell University Press
Moravcsik Andrew/ Schimmelfennig Frank 2009: Liberal Intergovernmentalism, in: Diez, T., Wiener, A., (2009) European Integration Theory, Oxford: Oxford University Press
Volkery Carsten2013, London [Online]: Großbritannien und die EU: Was Brüssel den Briten wirklich bringt. Verfügbar unter:
http://www.spiegel.de/wirtschaft/grossbritannien-lohnt-sich-die-mitgliedschaft-in-der-eu-a- 881589.html [14.03.13]
Volle, Angelika 1989: Großbritannien und der europäische Einigungsprozeß (Arbeitspapiere zur internationalen Politik 51), Bonn
Volle, Angelika1994: Der mühsame Weg Großbritanniens nach Europa. In: Hans Kastendiek, Karl Rohe u. Angelika Volle (Hrsg.): Länderbericht Großbritannien. Geschichte, Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Band 327, Bonn
[...]
- Quote paper
- Tatjana Brütting (Author), 2013, Großbritanniens Weg zum Vertrag von Maastricht. Analysiert anhand des Liberalen Intergouvernementalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270841