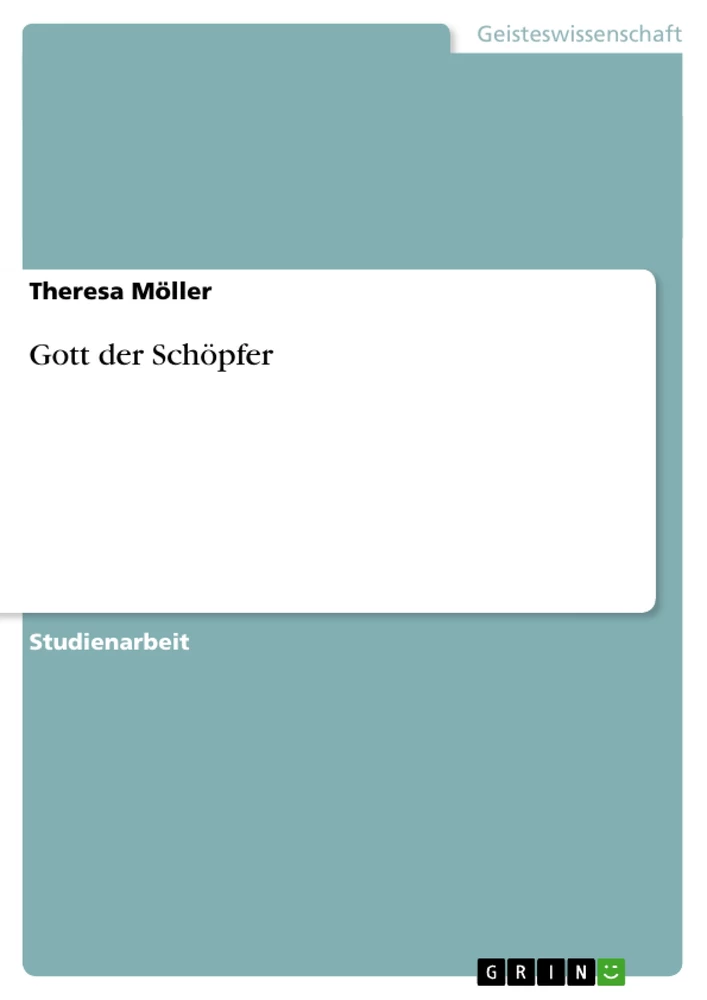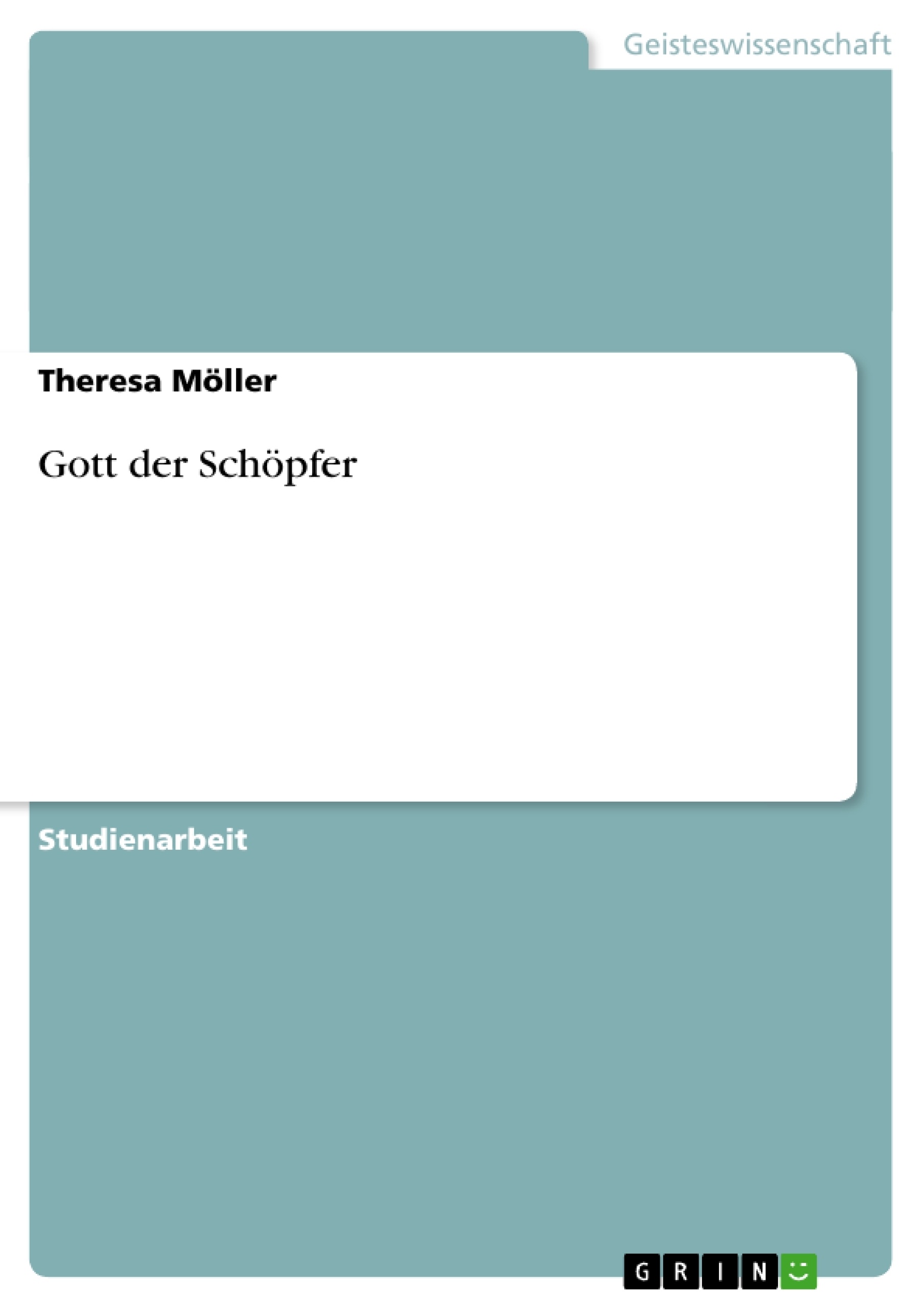Auf Grundlage der Bibel wird der christliche Glaube, insbesondere der Glaube an den Schöpfergott, in seinen Voraussetzungen, Glaubensinhalten und Konsequenzen für das menschliche Handeln aus evangelischer Sicht systematisch reflektiert.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung: Die Schöpfung in der Bibel
2 Hauptgedanken der christlichen Schöpfungslehre
2.1 Der Dreieinige Gott als Schöpfer
2.2 Die Schöpfung als freie Tat Gottes
2.3 Die Voraussetzungslosigkeit der Schöpfung
3 Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft
4 Die Providenzlehre
5 Das Theodizeeproblem
6 Schluss: Der Schöpfungsglaube heute
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung: Die Schöpfung in der Bibel
In der Bibel begegnet Gott den Menschen immer wieder als der Schöpfer: Die Welt und die Menschen wurden durch ihn geschaffen, wie in Genesis geschrieben steht. In Psalmen wird das Werk der Schöpfung gepriesen und auch in den Prophetenbüchern spielt die Schöpfung eine wesentliche Rolle. Diese Aussagen werden im Neuen Testament vorausgesetzt. Jesus spricht, unter anderem im Evangelium nach Matthäus, die erhaltende Wirkung Gottes auf die Schöpfung an und auch Paulus schreibt im Römerbrief über die Verbindung von Schöpfung und Mensch. Auf folgenden Seiten wird auf dieser Grundlage der christliche Glaube in seinen Voraussetzungen, Glaubensinhalten und Konsequenzen für das menschliche Handeln aus evangelischer Sicht systematisch reflektiert.
2 Hauptgedanken der christlichen Schöpfungslehre
2.1 Der Dreieinige Gott als Schöpfer
Die christliche Dogmatik sieht Gott als den Schöpfer der Welt an. Als erstes Werk des dreieinigen Gottes nach außen ist die Schöpfung ein Zeichen seiner Allmacht.[1] Alle drei Erscheinungsformen Gottes sind an der Schöpfung beteiligt, obwohl hauptsächlich Gott der Vater mit ihr in Verbindung gebracht wird. In den Glaubensbekenntnissen wird der Vater als Schöpfer bekannt. So beginnen das Nizäno-Konstantinopolitanum mit „Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.[…]“[2] und das Apostolikum mit „Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde.[…]“[3]. In der Bibel finden sich aber auch Stellen, an denen Jesus Christus oder der Heilige Geist als Schöpfer beschrieben werden. Ein Beispiel für Gott, der Sohn als Schöpfer ist im Kolosserbrief 1, 15f zu finden: „Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.“[4] Der Heilige Geist tritt in Hiob 33,4 „Der Geist Gottes hat mich gemacht, und der Odem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben.“[5] und in Genesis 1,2 „[…] und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser.“[6] als Schöpfer in Erscheinung.
2.2 Die Schöpfung als freie Tat Gottes
Gott beteiligt sich also als Vater, Sohn und Heiliger Geist an der Schöpfung. Die Schöpfung wäre aber nicht notwendig gewesen.[7] Gott ist nicht Gott, weil er die Welt geschaffen hat, sondern er ist ewig. Er war vor der Welt und wird auch nach der Welt sein. Also ist die Schöpfung eine freie oder freiwillige Tat Gottes. Durch die Kontingenz der Schöpfung grenzt sich die christliche Dogmatik von philosophischen Vorstellungen ab, die das gegenseitige Erfordern von Gott und der Welt lehren.
2.3 Die Voraussetzungslosigkeit der Schöpfung
Gott schuf die Welt freiwillig. Er ist die Ursache der Schöpfung und die Schöpfung ist der Handlung sowie deren Ergebnis.[8] Da Gott die Welt schuf, ist sie von ihrem Wesen verschieden zu Gott.[9] Sie ist weder gezeugt noch geboren. Dieser kategoriale Unterschied wird im Vergleich der Schöpfung mit Jesus Christus deutlicher. Jesus wurde von Gott gezeugt und geboren, nicht geschaffen, und ist somit wesensgleich mit Gott. Die Welt ist damit säkularisiert. Da der Unterschied von Gott und Welt jedoch nur kategorialer Natur ist, ist Verbundenheit möglich.
Neben der Kontingenz wird in der christlichen Dogmatik auch die Erschaffung der Welt aus dem Nichts, creatio ex nihilo, betont.[10] Mit der Lehre der creatio ex nihilo wird eine dualistische Anschauung ausgeschlossen. So gibt es im weder eine Gegengottheit noch strukturiert Gott vorhandenes Material, sondern er allein schuf die Welt und diese Tat war an keine Voraussetzung gebunden. Die creatio ex nihilo zeigt außerdem auf, dass die Welt auf Gottes Erhaltungshandeln angewiesen ist. Sie kann nicht aus sich selbst heraus dauerhaft existieren, sondern benötigt die Zuwendung Gottes.
[...]
[1] Vgl. LEONHARDT, Rochus, Grundinformation Dogmatik, 4., durchgesehene Auflage, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009, S. 240.
[2] Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Das Glaubensbekenntnis von Nizäa-Konstantinopel, Quelle: http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/nizaea_konstantinopel.html (16.06.2013).
[3] Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Das apostolische Glaubensbekenntnis, Quelle: http://www.ekd.de/glauben/bekenntnisse/apostolisches_glaubensbekenntnis.html (16.06.2013).
[4] Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Die Bibel, nach der Übersetzung Martin Luthers, Bibeltext in der revidierten Fassung von 1984, durchgesehene Ausgabe in neuer Rechtschreibung, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1999, Kol 1, 15-16.
[5] Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Die Bibel, 1999, Hi 33,4.
[6] Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Die Bibel, 1999, Gen 1,2.
[7] Vgl. zum ganzen Abschnitt LEONHARDT, Grundinformation Dogmatik, 2009, S. 241.
[8] Vgl. HÄRLE, Wilfried, Dogmatik, 3., überarbeitete Auflage, Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2007, S. 409.
[9] Vgl. hierzu und zum Folgenden HÄRLE, Dogmatik, 2007, S. 412f.
[10] Vgl. zum ganzen Abschnitt LEONHARDT, Grundinformation Dogmatik, 2009, S. 242.
- Quote paper
- Theresa Möller (Author), 2013, Gott der Schöpfer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270818