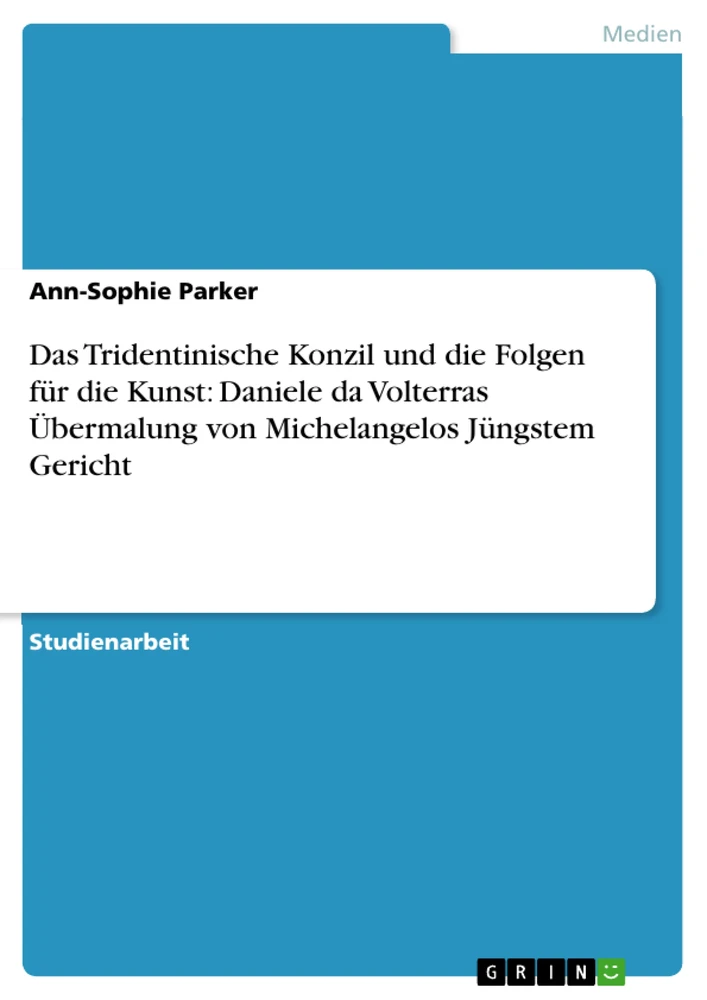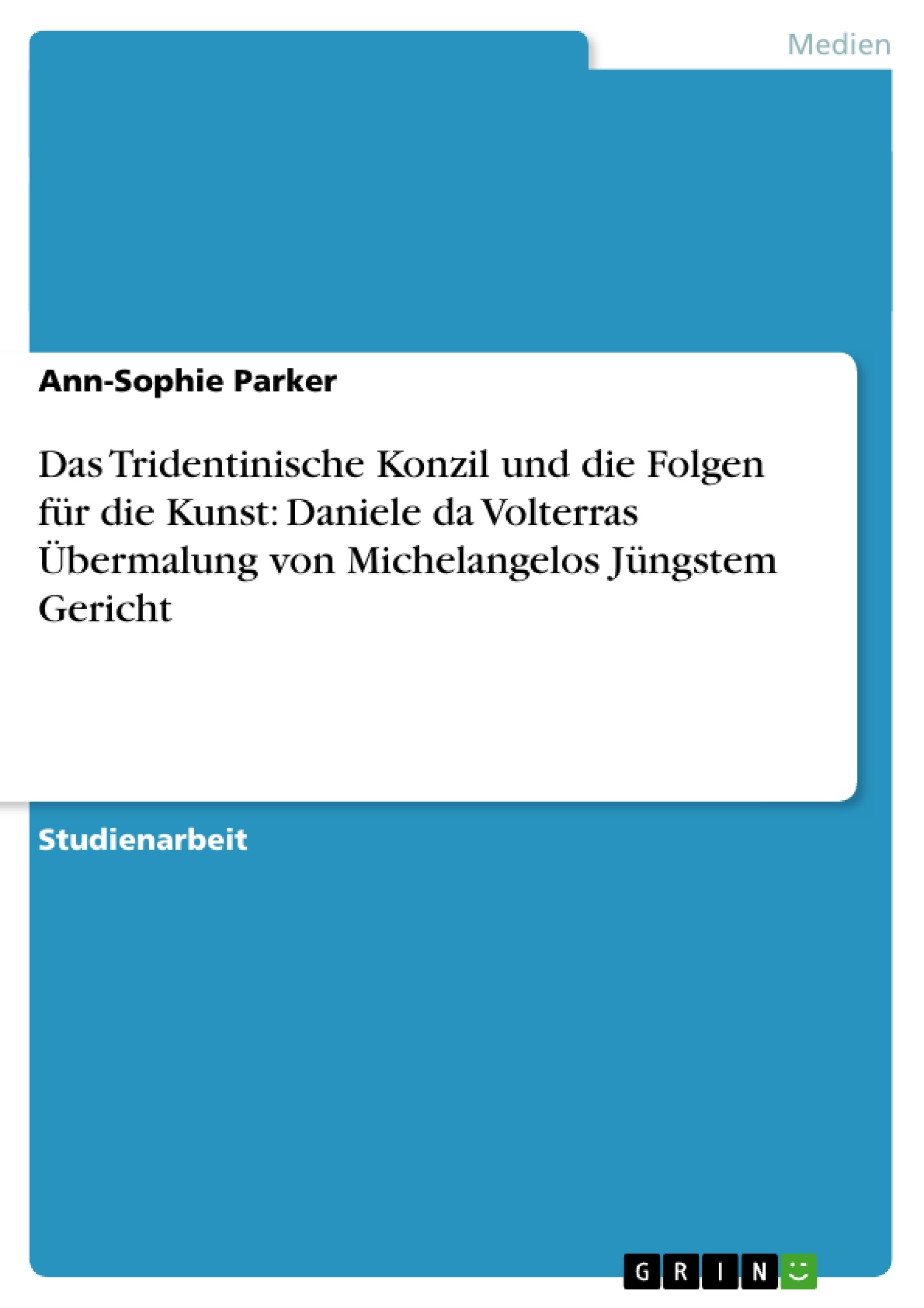Am 31.10.1517 schlug Martin Luther die 95 Ablassthesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dies hatte weitreichende Folgen. Es entbrannte ein sich ausbreitender Streit und der Zerfall der Universalkirche begann.
Es kam zu einer Einberufung des Konzils von Trient durch Papst Paul III, mit drei Sitzungsperioden in der Zeit vom 13.12.1554 bis zum 4.12.1563. Das Ziel war die katholische Glaubenslehre neu zu formieren und sie gegen die reformatorische Lehre abzusetzen.
Die wichtigsten, vom Papst verurteilten Positionen Luthers, waren zum einen die Rechtfertigungslehre. Es entstehe Rechtfertigung allein aus dem Glauben und nicht durch die Verdienstlichkeit der Werke. Zum anderen wurde auch die Negierung der Vorstellung vom Fegefeuer, welche biblisch nicht begründet ist, abgelehnt. Außerdem befand er die Mittlerschaft der Heiligen und deren Verehrung unnütz. Das Papsttums beurteilte er als unsinnig, da es nicht auf göttlichem Recht gründete.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung:
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund
- Reformation & Gegenreformation
- Das Tridentinische Konzil
- 2. Michelangelos „Jüngstes Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle
- 3. Kurze Bildbeschreibung
- 4. Argumentationen
- 4.1 für einen ikonoklastischen Akt
- 4.2 gegen einen ikonoklastischen Akt
- 5. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Übermalung von Michelangelos Jüngstem Gericht durch Daniele da Volterra im Kontext des Tridentinischen Konzils. Ziel ist es, die These zu überprüfen, ob diese Übermalung als ikonoklastischer Akt zu betrachten ist.
- Das Tridentinische Konzil und seine Auswirkungen auf die Kunst
- Michelangelos „Jüngstes Gericht“ als Kunstwerk und seine Ikonographie
- Die Argumentation für und gegen eine ikonoklastische Interpretation der Übermalung
- Die Rolle der Biografie und der Beziehung zwischen Michelangelo und Daniele da Volterra
- Die Definition von Ikonoklasmus im Kontext der frühen Neuzeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung liefert den zeitgeschichtlichen Hintergrund, indem sie die Reformation und Gegenreformation sowie das Tridentinische Konzil und dessen Bedeutung für die katholische Kirche detailliert beschreibt. Sie beleuchtet die zentralen Konflikte und die Notwendigkeit einer Neuformierung der katholischen Glaubenslehre als Reaktion auf die reformatorischen Lehren Luthers. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den vom Papst verurteilten Positionen Luthers, wie der Rechtfertigungslehre und der Ablehnung des Fegefeuers, sowie die Auswirkungen dieser Auseinandersetzung auf die Kunst und deren Darstellung.
2. Michelangelos „Jüngstes Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung von Michelangelos „Jüngstem Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle. Es beleuchtet die zeitlichen und künstlerischen Zusammenhänge, Michelangelos vorherige Arbeiten und die Umstände, unter denen er den Auftrag für das Fresko erhielt. Der Fokus liegt auf der künstlerischen Leistung Michelangelos und der Bedeutung dieses Werkes im Kontext der damaligen Zeit. Die Darstellung von Papst Clemens VII. und seiner Rolle bei der Auftragsvergabe wird ebenfalls eingehend betrachtet.
Schlüsselwörter
Tridentinisches Konzil, Gegenreformation, Michelangelo, Jüngstes Gericht, Daniele da Volterra, Ikonoklasmus, Kunstzensur, Reformation, katholische Glaubenslehre, Bildinterpretation.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Übermalung von Michelangelos Jüngstem Gericht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Übermalung von Michelangelos Jüngstem Gericht in der Sixtinischen Kapelle durch Daniele da Volterra im Kontext des Tridentinischen Konzils. Der zentrale Forschungsfrage ist, ob diese Übermalung als ikonoklastischer Akt zu betrachten ist.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, die den historischen Hintergrund beleuchtet (Reformation, Gegenreformation, Tridentinisches Konzil); ein Kapitel über Michelangelos Jüngstes Gericht; eine kurze Bildbeschreibung; eine Argumentation für und gegen eine ikonoklastische Interpretation der Übermalung; und ein Schlusswort.
Was sind die Hauptthemen der Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit dem Tridentinischen Konzil und seinen Auswirkungen auf die Kunst, Michelangelos „Jüngstem Gericht“ als Kunstwerk und seine Ikonographie, der Argumentation für und gegen eine ikonoklastische Interpretation der Übermalung, der Rolle der Biografie und der Beziehung zwischen Michelangelo und Daniele da Volterra, sowie der Definition von Ikonoklasmus in der frühen Neuzeit.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Die Einleitung beschreibt den historischen Kontext, Kapitel 2 fokussiert auf die Entstehung und Bedeutung von Michelangelos Werk, und Kapitel 4 präsentiert die Argumentation für und gegen die ikonoklastische Interpretation der Übermalung.
Welche Schlüsselwörter werden verwendet?
Schlüsselwörter umfassen: Tridentinisches Konzil, Gegenreformation, Michelangelo, Jüngstes Gericht, Daniele da Volterra, Ikonoklasmus, Kunstzensur, Reformation, katholische Glaubenslehre, und Bildinterpretation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die These zu überprüfen, ob die Übermalung des Jüngsten Gerichts als ikonoklastischer Akt zu werten ist. Sie untersucht die Zusammenhänge zwischen dem Tridentinischen Konzil, den künstlerischen Entscheidungen und der religiösen und politischen Situation der Zeit.
- Quote paper
- Ann-Sophie Parker (Author), 2012, Das Tridentinische Konzil und die Folgen für die Kunst: Daniele da Volterras Übermalung von Michelangelos Jüngstem Gericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270735