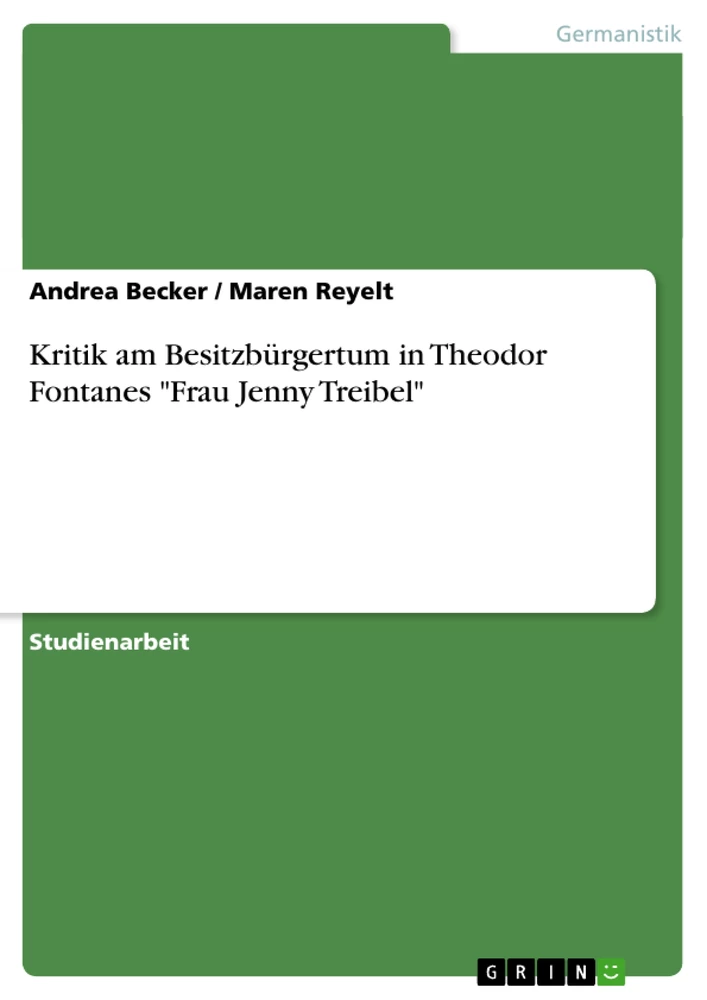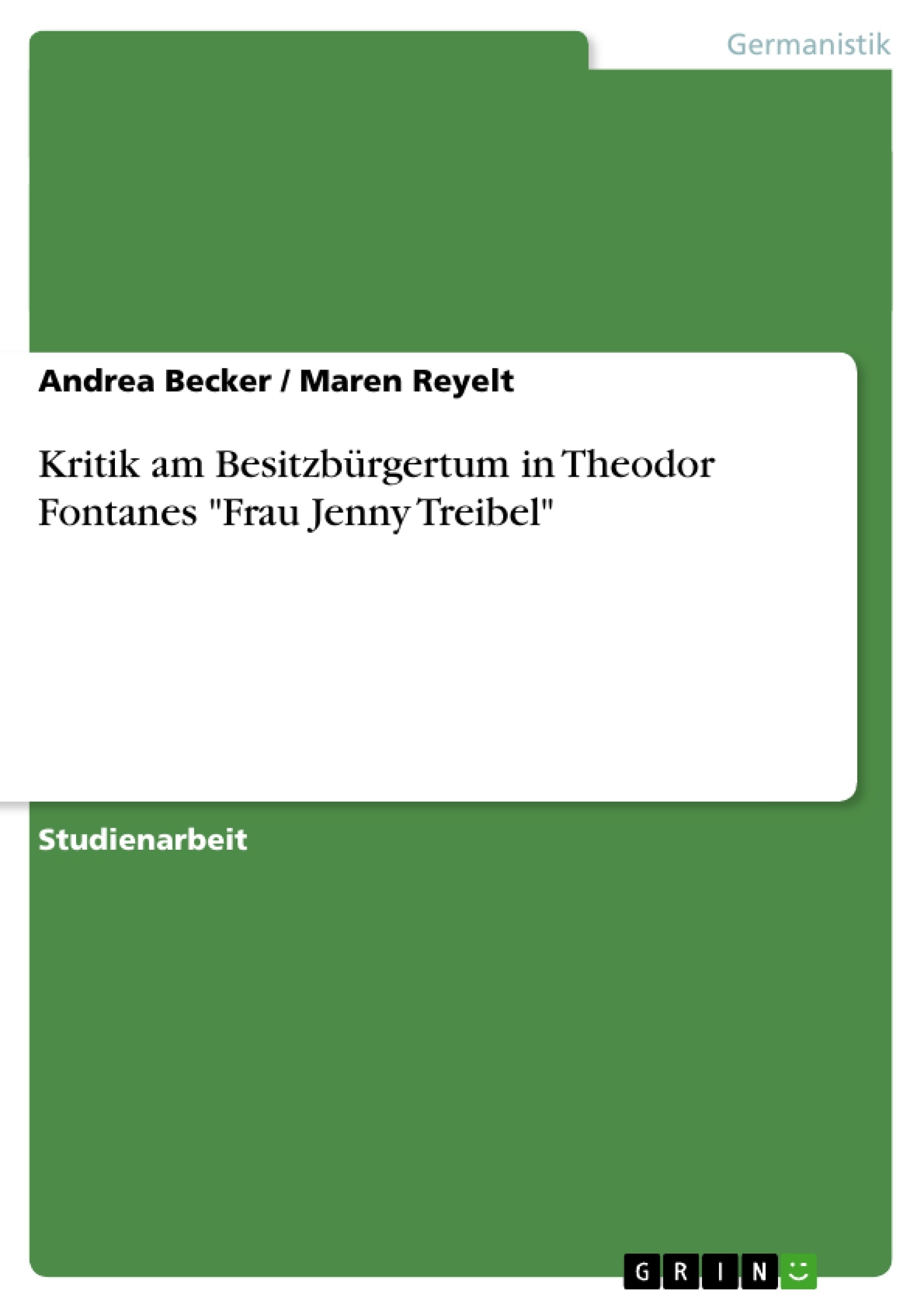1. Einleitung
Theodor Fontane hat im Laufe der Jahre in vielen Briefen seine Abneigung gegen die Bourgeoisie bekundet, die er als „protzig, engherzig und ungebildet“ bezeichnet hat. Diese Charakterisierung hat er literarisch verarbeitet: besonders in seinem Roman Frau Jenny Treibel (1892) findet sich dieser harte Ton wieder. So läßt er denn auch Professor Wilibald Schmidt über die Besitzbürger Treibel feststellen: „Sie liberalisieren und sentimentalisieren beständig, aber das alles ist Farce; wenn es gilt, Farbe zu bekennen, dann heißt es: >Gold ist Trumpf<, und weiter nichts.“
In diesen Zitaten finden sich all die für Fontane kritikwürdigen Facetten wieder, die er seiner Protagonistin, der Kommerzienrätin Jenny Treibel, auf den Leib geschrieben hat: Prestigegewinn siegt dabei über Bildung und Wissen, Geldbesessenheit über Liebesheirat und Herzensbildung; Sentimentalität stellt die Verbindung zwischen den Facetten her. Das hier beschr iebene Bild und damit Fontanes Kritik speziell am Besitzbürgertum stellt den Schwerpunkt dieser Hausarbeit dar. Dabei wollen wir der Fragestellung nachgehen, wie Fontane seine Kritik im Text umsetzt. Dies soll exemplarisch anhand der Titelfigur untersucht werden. An ihr wird die Diskrepanz zwischen ideellem Schein (der Hang zum „Höheren“) und materiellen Sein (die Geldmentalität), die Fontane für zeittypisch hielt, herausgearbeitet. Zwar hat Fontane auch den Rückzug des Bildungsbürgertums aus dem gesellscha ftlichen Leben in die egozentrische Bildungsidylle aufgedeckt und kritisiert. Dieser Aspekt bleibt hier aber unberücksichtigt, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen. Nur an ausgewählten Stellen werden wir auf darauf eingehen. Im folgenden soll kurz unsere Gliederung vorgestellt werden: an erster Stelle steht eine kurze Erläuterung von Fontanes Realismuskonzept, um ein Grundverständnis für seinen Schreibstil herzustellen. Im Anschluß wird zum besseren Verständnis der Lektüre ein Abriß über den gesellschaftshistorischen Hintergrund in seiner Relevanz für den Roman wiedergegeben. Der Hauptteil befaßt sich dezidiert mit der Figur Jenny Treibel. Zum einen geht es um ihr Repräsentationsgehabe und ihre damit verbundene eingebildete Bildung, zum anderen um ihre Sentimentalität und Selbsttäuschung. In der Schlußbemerkung sollen alle aufgeführten Aspekte, die sich in der Titelfigur wiederspiegeln, beleuchtet werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Fontanes poetisches Realismuskonzept
- 3. Gesellschaftshistorischer Hintergrund
- 4. Fontanes Kritik am Besitzbürgertum
- 4.1 „Ein Musterstück von einer Bourgeoise\": Geltungsdrang und eingebildete Bildung
- 4.2 „Wo sich Herz zum Herzen find’t“: Sentimentalität und Selbsttäuschung
- 5. Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Theodor Fontanes Kritik am Besitzbürgertum in seinem Roman „Frau Jenny Treibel“. Die zentrale Fragestellung lautet, wie Fontane seine Kritik literarisch umsetzt, exemplarisch analysiert an der Titelfigur. Dabei wird die Diskrepanz zwischen dem ideellen Schein (Streben nach „Höherem“) und dem materiellen Sein (Geldmentalität) beleuchtet.
- Fontanes poetisches Realismuskonzept und seine Methode der „Verklärung“
- Der gesellschaftshistorische Kontext des Romans
- Jenny Treibels Geltungsdrang und eingebildete Bildung
- Jenny Treibels Sentimentalität und Selbsttäuschung
- Fontanes differenzierte Darstellung des Bürgertums
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt Fontanes Kritik am Besitzbürgertum als zentralen Fokus der Arbeit heraus. Sie erwähnt Fontanes negative Einschätzung der Bourgeoisie in seinen Briefen und führt ein Zitat aus „Frau Jenny Treibel“ an, das die oberflächliche Moral der Besitzbürger aufzeigt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Titelfigur Jenny Treibel, um die Diskrepanz zwischen Schein und Sein aufzuzeigen, die Fontane als zeittypisch erachtet. Der Fokus liegt dabei auf der Titelfigur, während die Kritik am Bildungsbürgertum nur am Rande behandelt wird.
2. Fontanes poetisches Realismuskonzept: Dieses Kapitel erläutert Fontanes Realismusverständnis. Fontane strebte danach, die zeittypischen gesellschaftlichen Strukturen der preußischen Gesellschaft realistisch darzustellen, wobei er sowohl das Besitz- als auch das Bildungsbürgertum kritisierte. Sein Realismus beinhaltet nicht nur die Abbildung der empirischen Wirklichkeit, sondern auch die Darstellung der dahinterliegenden Wahrheit. Ein wichtiges Stilmittel ist die „Verklärung“, die das Häßliche des Lebens nicht einfach wiedergibt, sondern durch humorvolle Umformung aufzeigt und den Leser zum Nachdenken anregt. Fontane zeichnet keine Figuren ausschließlich positiv oder negativ, sondern betont die Vielschichtigkeit des menschlichen Charakters.
3. Gesellschaftshistorischer Hintergrund: (Annahme: Kapitel beschreibt den historischen Kontext, der Fontanes Kritik beeinflusste). Dieses Kapitel (angenommener Inhalt) würde den sozio-ökonomischen und politischen Kontext des späten 19. Jahrhunderts in Preußen beleuchten. Es würde die Entwicklung des Bürgertums, seine sozialen Strukturen und seine Rolle in der Gesellschaft beschreiben. Dieser Abschnitt würde die Grundlage für das Verständnis von Fontanes Kritik an den dargestellten gesellschaftlichen Verhältnissen liefern und den Kontext für die im Roman dargestellten Konflikte schaffen. Die Bedeutung des aufstrebenden Bürgertums und seine Auswirkungen auf die bestehende Gesellschaftsordnung würden detailliert betrachtet werden.
4. Fontanes Kritik am Besitzbürgertum: (Annahme: Kapitel behandelt die Kritik an der Titelfigur und weiteren Besitzbürgern im Roman). Dieses Kapitel (angenommener Inhalt) analysiert Fontanes Kritik an der Besitzbürgerlichen Klasse durch die Darstellung der Figur Jenny Treibel und weiterer Charaktere. Es würde die in Unterkapiteln 4.1 und 4.2 behandelten Aspekte detailliert ausführen: 4.1 würde den Geltungsdrang und die eingebildete Bildung der Besitzbürger untersuchen und mit Beispielen aus dem Roman belegen. 4.2 würde die Sentimentalität und Selbsttäuschung dieser Klasse als Mechanismen zur Aufrechterhaltung ihres Status quo beleuchten. Die Analyse würde zeigen, wie Fontane durch die Darstellung dieser Charaktere die moralischen und gesellschaftlichen Mängel des Besitzbürgertums offenbart. Der Zusammenhang zwischen den einzelnen Aspekten und ihre Bedeutung für die Gesamtinterpretation des Romans würde herausgearbeitet werden.
Schlüsselwörter
Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel, Realismus, Besitzbürgertum, Kritik, Verklärung, Sentimentalität, Geltungsdrang, Bildung, Gesellschaft, Preußen, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen zu: Theodor Fontanes Kritik am Besitzbürgertum in "Frau Jenny Treibel"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Theodor Fontanes Kritik am Besitzbürgertum in seinem Roman "Frau Jenny Treibel". Der Fokus liegt auf der Darstellung der Titelfigur und der literarischen Umsetzung von Fontanes Kritik, insbesondere der Diskrepanz zwischen Schein und Sein.
Welche zentralen Fragestellungen werden behandelt?
Die zentrale Frage lautet: Wie setzt Fontane seine Kritik am Besitzbürgertum literarisch um, exemplarisch analysiert an der Figur Jenny Treibel? Es wird untersucht, wie die Diskrepanz zwischen dem ideellen Schein (Streben nach „Höherem“) und dem materiellen Sein (Geldmentalität) dargestellt wird.
Welche Themenschwerpunkte werden untersucht?
Die Arbeit behandelt Fontanes poetisches Realismuskonzept und seine Methode der „Verklärung“, den gesellschaftshistorischen Kontext des Romans, Jenny Treibels Geltungsdrang und eingebildete Bildung, ihre Sentimentalität und Selbsttäuschung, sowie Fontanes differenzierte Darstellung des Bürgertums.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Fontanes Realismuskonzept, ein Kapitel zum gesellschaftshistorischen Hintergrund, ein Kapitel zu Fontanes Kritik am Besitzbürgertum (mit Unterkapiteln zu Geltungsdrang/Bildung und Sentimentalität/Selbsttäuschung) und eine Schlussbemerkung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was ist Fontanes poetisches Realismuskonzept und wie spielt es eine Rolle in der Analyse?
Fontanes Realismus zeichnet sich durch die realistische Darstellung zeittypischer gesellschaftlicher Strukturen aus, inklusive der Kritik am Besitz- und Bildungsbürgertum. Die „Verklärung“ als Stilmittel wird erläutert, die das Hässliche nicht einfach abbildet, sondern durch humorvolle Umformung aufzeigt und zum Nachdenken anregt. Die Vielschichtigkeit menschlicher Charaktere wird betont.
Welche Rolle spielt der gesellschaftshistorische Kontext?
Der sozio-ökonomische und politische Kontext des späten 19. Jahrhunderts in Preußen wird beleuchtet, um Fontanes Kritik zu verstehen. Die Entwicklung des Bürgertums, seine sozialen Strukturen und seine Rolle in der Gesellschaft bilden den Hintergrund für die im Roman dargestellten Konflikte.
Wie wird Fontanes Kritik am Besitzbürgertum analysiert?
Die Analyse konzentriert sich auf die Figur Jenny Treibel und weitere Charaktere. Es werden ihr Geltungsdrang und ihre eingebildete Bildung sowie ihre Sentimentalität und Selbsttäuschung untersucht, um die moralischen und gesellschaftlichen Mängel des Besitzbürgertums aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Theodor Fontane, Frau Jenny Treibel, Realismus, Besitzbürgertum, Kritik, Verklärung, Sentimentalität, Geltungsdrang, Bildung, Gesellschaft, Preußen, 19. Jahrhundert.
- Citar trabajo
- Andrea Becker (Autor), Maren Reyelt (Autor), 2002, Kritik am Besitzbürgertum in Theodor Fontanes "Frau Jenny Treibel", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/27069