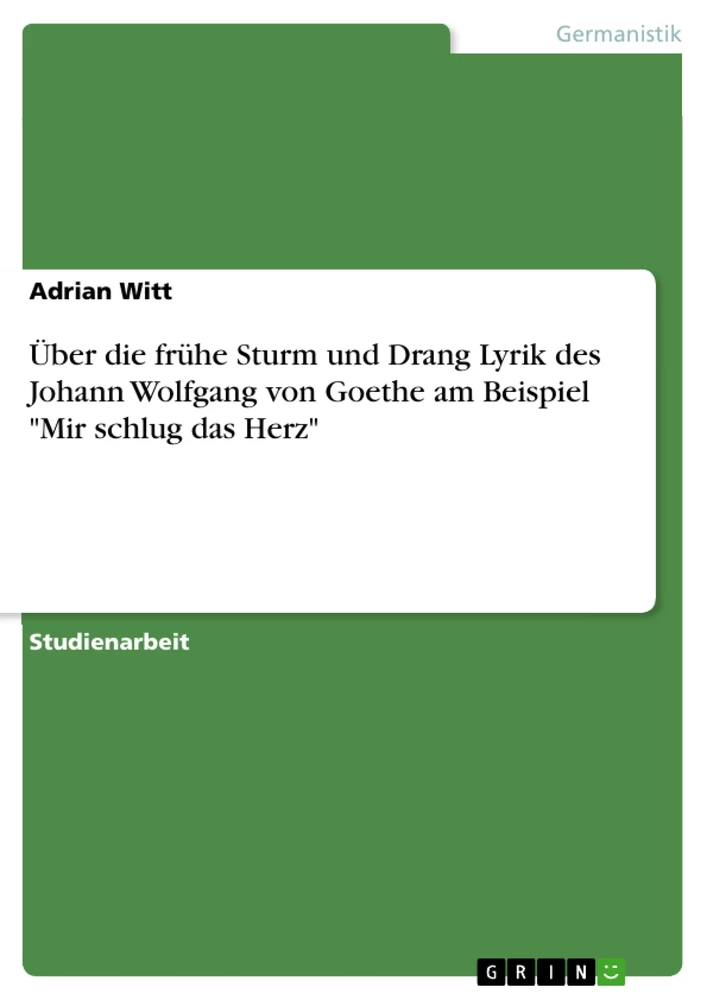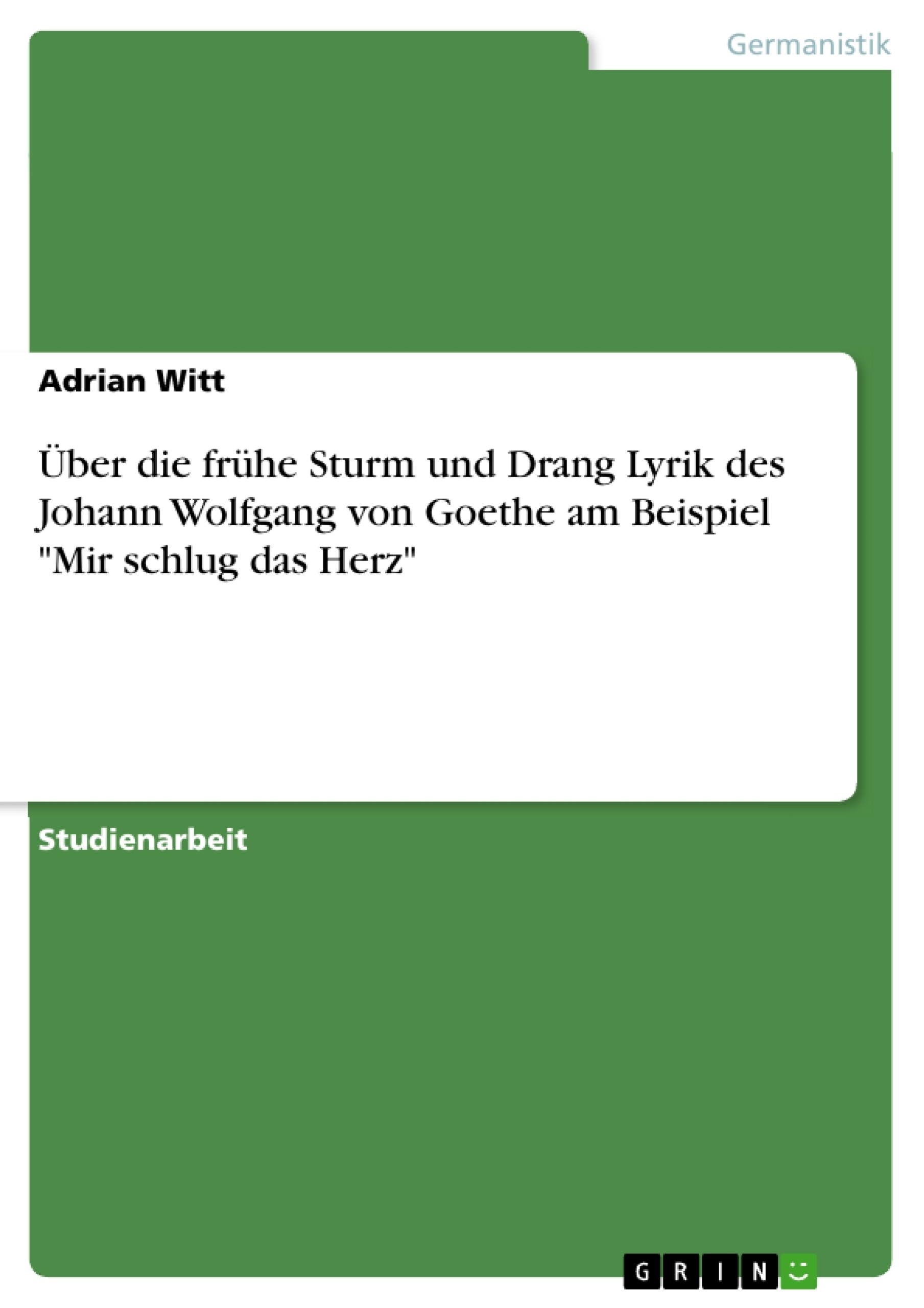Die gesellschaftliche Thematisierung der zwischenmenschlichen Liebe darf nicht gänzlich als neuzeitliches Phänomen verstanden werden. Vielmehr hat dieses Motiv auf Grund ihrer vielseitigen Darstellungsmöglichkeiten im Laufe der Geschichte Einfluss auf die unterschiedlichsten Künste genommen oder fand durch ihren inspirierenden Charakter immer wieder als Themenstoff eine schriftbezogene Verwendung. Insbesondere für die Dichtung nimmt das Motiv der Liebe eine zentrale Rolle ein, da es nicht nur zu denen am häufigsten auf lyrische Weise gestalteten Motiven zählt, sondern gleichzeitig auch zu den ältesten Urstoffen menschlicher Kreativität gehört. Dabei erscheint die Liebesthematik innerhalb der Dichtung zumeist als Liebeserklärung, als individueller Ausdruck unstillbarer Sehnsucht sowie als Form der Trauer über den Verlust des Partners und hat ihrerseits im Laufe der Jahrhunderte eine grundlegende Veränderung vollzogen. Besonders die literarischen Zeugnisse der Aufklärung zeugen in ihren Grundzügen von einem Spannungsverhältnis zwischen körperlich begehrendem Eros und unkörperliche empfindsamer Liebe, zwischen sinnlicher Lust und sublimierter Entsagungsbereitschaft. Doch erst die Veränderungen, die die literarische Bewegung des Sturm und Drang auf dem Gebiet der Lyrik bewirkte, gehören zu den grundlegenden innerhalb der deutschen Literaturgeschichte, da „die heute […] verbreite Auffassung von Lyrik als Ausdruck subjektiver Empfindung […] durch die theoretischen Konzeptionen und durch die poetische Produktion dieser […] literarisch-ästhetischen Revolte entscheidend geprägt“ ist. Dies gilt insbesondere für die sogenannte Erlebnislyrik, mit der in den frühen 1770er Jahren ein völlig neuartiger Typus innerhalb der deutschen Lyrik ihren Anfang nimmt und sich im Wesentlichen durch die textuelle Inszenierung subjektiven Wahrnehmens und Erlebens auszeichnet. Als eines der frühesten und gleichzeitig auch bekanntesten Dokumente der Erlebnislyrik des Sturm und Drang kann exemplarisch das Gedicht Mir schlug das Herz des Johann Wolfgang von Goethe genannt werden, das die Vielsichtigkeit von Gefühlsäußerungen jener Zeit im Bereich des literarischen Liebeserlebens auf beeindruckender Weise veranschaulicht. Denn in diesem Gedicht „erscheinen sprechendes Ich, Geliebte, Liebe und Natur in einer bisher nicht bekannten sprachlichen Intensität“, welche noch den dichterischen Werdegang des jungen Goethe nachhaltig beeinflussen sollte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die epochale Zuordnung
- 2.1. Die Epoche der Aufklärung
- 2.2. Die Sturm und Drang Strömung
- 2.2.1. Der Geniegedanke des Sturm und Drang
- 2.2.2. Das neue Selbstverständnis des Dichters
- 2.2.3. Das zentrale Begriffspaar - Nachahmung und Schöpfung
- 3. Begriffsklärung Erlebnislyrik
- 4. Kurz zur Entstehungsgeschichte des Gedichts Mir schlug das Herz
- 5. Die Dichtung Mir schlug das Herz von Johann Wolfgang von Goethe
- 5.1. Die formale Gestaltung der Dichtung im Zeichen des Sturm und Drang
- 5.2. Interpretation der Dichtung im Kontext des Sturm und Drang
- 6. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Mir schlug das Herz“ im Kontext der Sturm und Drang-Bewegung. Ziel ist es, die spezifischen Merkmale des Gedichts herauszuarbeiten, die eine Zuordnung zum Sturm und Drang ermöglichen und dessen Bedeutung für diese literarische Strömung zu beleuchten. Die Analyse betrachtet die Epoche der Aufklärung als Vorläufer und untersucht die Entwicklung des Geniegedankens und des neuen Selbstverständnisses des Dichters innerhalb der Sturm und Drang-Bewegung.
- Die Epoche der Aufklärung und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Literatur.
- Der Sturm und Drang als literarische Strömung und seine zentralen Merkmale.
- Das neue Selbstverständnis des Dichters im Sturm und Drang.
- Die Erlebnislyrik und ihre Darstellung in Goethes Gedicht „Mir schlug das Herz“.
- Interpretation von „Mir schlug das Herz“ im Kontext der Sturm und Drang-Lyrik.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der zwischenmenschlichen Liebe in der Literatur ein und hebt deren historische Bedeutung hervor. Sie betont die zentrale Rolle des Liebesmotivs in der Lyrik und dessen Wandel im Laufe der Jahrhunderte. Besonders wird das Spannungsverhältnis zwischen körperlichem Eros und unkörperlicher Liebe in der Aufklärungsliteratur hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert sich auf Goethes „Mir schlug das Herz“ als frühes und bedeutendes Beispiel der Erlebnislyrik des Sturm und Drang, um dessen Merkmale und Bedeutung für die Strömung zu untersuchen.
2. Die epochale Zuordnung: Dieses Kapitel liefert einen historischen Überblick über die Literatur des 18. Jahrhunderts, beginnend mit der Aufklärung. Es beschreibt die Aufklärung als gesamteuropäische Bewegung, die einen gesellschaftlichen Wandel mit gravierenden Auswirkungen auf Philosophie und Schrifttum einleitete. Der Abschnitt betont die Herausforderungen der Einordnung der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts unter den Oberbegriff „Aufklärung“, da diese vielfältige Strömungen und ästhetische Programme umfasst. Das Kapitel führt dann zur Sturm und Drang-Bewegung über, positioniert sie innerhalb der Aufklärung und beschreibt ihren Einfluss auf die Lyrik.
2.1. Die Epoche der Aufklärung: Dieser Abschnitt definiert die Aufklärung als eine gesamteuropäische Bewegung, die den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit kennzeichnet. Er beschreibt den gesellschaftlichen Wandel, der durch die Infragestellung der institutionalisierten Religion und die Betonung der menschlichen Vernunft eingeleitet wurde. Die damit verbundene Säkularisierung und die Emanzipation des Bürgertums werden als wichtige Folgen der Aufklärung dargestellt. Der Abschnitt zeigt, wie sich diese Veränderungen in der Literatur niederschlugen: eine Loslösung von der konventionellen Regelpoetik und ein neuartiger, revolutionärer Sprachgestus.
2.2. Die Sturm und Drang Strömung: Im Gegensatz zur gesamteuropäischen Ausrichtung der Aufklärung wird der Sturm und Drang als vorwiegend deutschsprachige literarische Strömung innerhalb der Aufklärung positioniert. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen bei der zeitlichen Einordnung des Sturm und Drang, da sich keine klaren Grenzen ziehen lassen. Es beschreibt den Sturm und Drang als geistigen Aufstand junger, bürgerlicher Autoren und datiert seinen Wirkungszeitraum mehrheitlich zwischen 1770 und 1785. Der Abschnitt hebt hervor, dass die Autoren selbst kein Bewusstsein für die Begründung einer eigenständigen literarischen Strömung hatten.
Schlüsselwörter
Aufklärung, Sturm und Drang, Erlebnislyrik, Johann Wolfgang von Goethe, Mir schlug das Herz, Geniegedanke, Subjektivität, Gefühlsäußerung, Liebeslyrik, deutsche Literaturgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu „Mir schlug das Herz“: Goethes Gedicht im Kontext des Sturm und Drang
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Johann Wolfgang von Goethes Gedicht „Mir schlug das Herz“ im Kontext der Sturm und Drang-Bewegung. Sie untersucht die Merkmale des Gedichts, die seine Zuordnung zum Sturm und Drang ermöglichen, und beleuchtet dessen Bedeutung für diese literarische Strömung. Die Analyse betrachtet die Aufklärung als Vorläufer und untersucht die Entwicklung des Geniegedankens und des neuen Selbstverständnisses des Dichters innerhalb des Sturm und Drang.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Epoche der Aufklärung und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Literatur; den Sturm und Drang als literarische Strömung und seine zentralen Merkmale; das neue Selbstverständnis des Dichters im Sturm und Drang; die Erlebnislyrik und ihre Darstellung in Goethes Gedicht „Mir schlug das Herz“; und die Interpretation von „Mir schlug das Herz“ im Kontext der Sturm und Drang-Lyrik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: eine Einleitung, ein Kapitel zur epochalen Zuordnung (inkl. Aufklärung und Sturm und Drang), ein Kapitel zur Begriffsklärung „Erlebnislyrik“, ein Kapitel zur Entstehungsgeschichte des Gedichts, ein Kapitel zur Analyse des Gedichts „Mir schlug das Herz“ (formale Gestaltung und Interpretation im Kontext des Sturm und Drang) und einen Schluss.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik der zwischenmenschlichen Liebe in der Literatur ein und hebt deren historische Bedeutung hervor. Sie betont die zentrale Rolle des Liebesmotivs in der Lyrik und dessen Wandel im Laufe der Jahrhunderte. Besonders wird das Spannungsverhältnis zwischen körperlichem Eros und unkörperlicher Liebe in der Aufklärungsliteratur hervorgehoben. Die Arbeit fokussiert sich auf Goethes „Mir schlug das Herz“ als frühes und bedeutendes Beispiel der Erlebnislyrik des Sturm und Drang.
Was wird im Kapitel zur epochalen Zuordnung behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Literatur des 18. Jahrhunderts, beginnend mit der Aufklärung und ihrer Einordnung der deutschen Literatur. Es führt dann zur Sturm und Drang-Bewegung über, positioniert sie innerhalb der Aufklärung und beschreibt ihren Einfluss auf die Lyrik. Es werden die Herausforderungen der Einordnung und die zeitliche Einordnung des Sturm und Drang diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Aufklärung, Sturm und Drang, Erlebnislyrik, Johann Wolfgang von Goethe, Mir schlug das Herz, Geniegedanke, Subjektivität, Gefühlsäußerung, Liebeslyrik, deutsche Literaturgeschichte.
Wie wird Goethes Gedicht „Mir schlug das Herz“ interpretiert?
Die Interpretation des Gedichts erfolgt im Kontext der Sturm und Drang-Lyrik. Die Arbeit analysiert die formale Gestaltung des Gedichts und untersucht seine Merkmale im Hinblick auf die zentrale Strömung. Die Analyse beleuchtet Aspekte wie das neue Selbstverständnis des Dichters und die Darstellung der Erlebnislyrik.
Welche Rolle spielt die Aufklärung in der Analyse?
Die Aufklärung wird als wichtiger Vorläufer des Sturm und Drang betrachtet. Die Arbeit untersucht, wie die Veränderungen der Aufklärung (Säkularisierung, Emanzipation des Bürgertums etc.) die Literatur beeinflussten und den Weg für den Sturm und Drang ebneten.
- Quote paper
- B.A. Adrian Witt (Author), 2013, Über die frühe Sturm und Drang Lyrik des Johann Wolfgang von Goethe am Beispiel "Mir schlug das Herz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270656