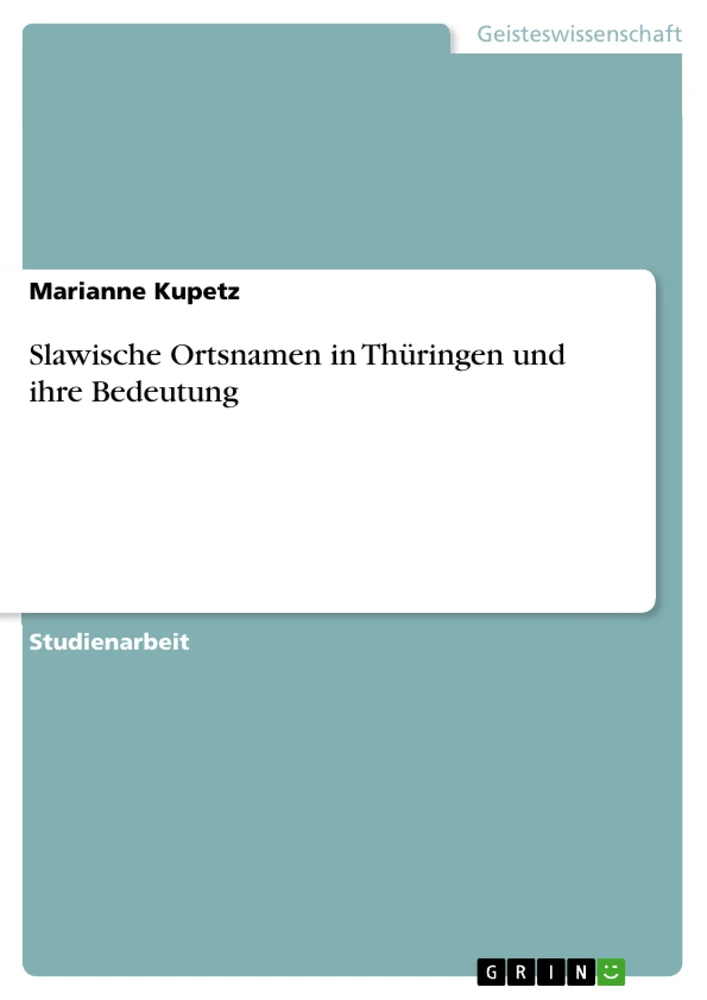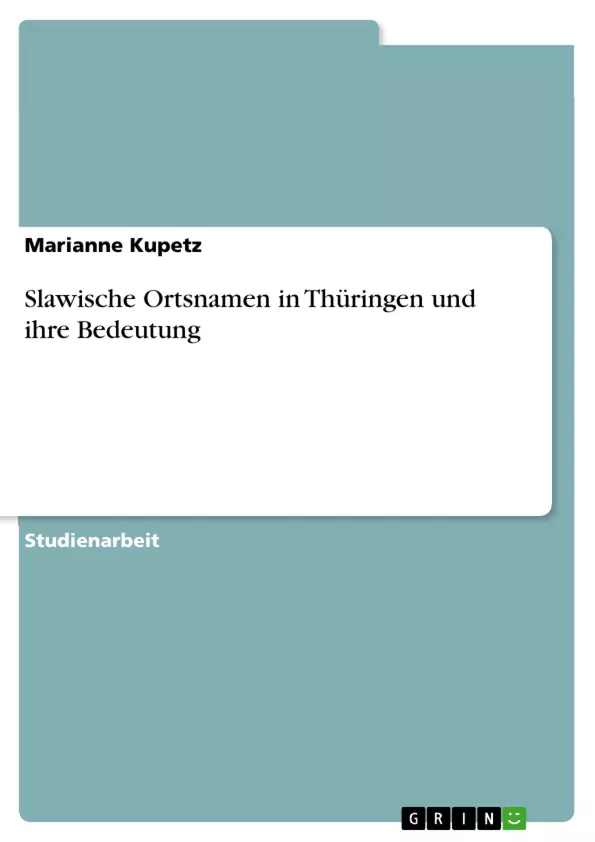Mit Sicherheit hat sich ein jeder schon einmal gefragt, woher dieser oder jener Ortsname aus seiner Heimat stammt. Manch einer fragt es sich nur im Stillen und ein anderer versucht seine Fragen anhand von Literatur zu beantworten. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts beschäftigen sich vermehrt Forschergruppen mit dem Thema der Namensforschung- und Bedeutung.
Die vorliegende Arbeit soll einen kurzen Einblick in das Gebiet der slawischen Ortsnamenforschung anhand von Beispielen aus dem Thüringer Raum geben und aufzeigen, wie schwierig es oftmals sein kann, den ursprünglichen Namen einer Siedlung oder Stadt herauszufinden, wenn diese bereits über einen längeren Zeitraum besteht und mehrere Wandel in der Schreibweise durchlebt hat. Dabei muss man unbedingt beachten, dass es kaum gesicherte Angaben zur Entstehungsgeschichte gibt und viele Interpretationen lediglich auf den Übersetzungen oder Namensableitungen basieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Bildungsmuster slawischer Ortsnamen im Thüringer Raum
- 2.1. Ortsnamen aus slawischen Vollnamen mit dem Suffix „-j“ und „-ici“
- 2.2. Ortsnamen aus slawischen Kurznamen mit dem Suffix „-j-“, „-ici“, „-ov“ und „-in“
- 2.3. Pluralische slawische Bewohnernamen (Tätigkeitsnamen)
- 2.4. slawische Bewohnernamen mit Endung auf „-jane“
- 2.5. mit slawischen Sachwörtern gebildete Ortsnamen mit dem Suffix „-ica“ und „-ina“
- 2.6. slawische Einzelnamen
- 2.7. sorbische Personennamen mit deutschem Ortsnamen-Grundwort
- 2.8. deutsches Lehnwort mit sorbischem Ortsnamen-Suffix
- 2.9. deutsche Ortsnamen für sorbische Siedlungen
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Einblick in die slawische Ortsnamenforschung in Thüringen. Sie untersucht die Herausforderungen bei der Bestimmung der ursprünglichen Namen von Siedlungen aufgrund von Schreibweisenänderungen über die Zeit und der Knappheit gesicherter Quellen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Forschungsprojekten wie „Germania Slavica“ und die Rolle von Linguisten wie Ernst Eichler in diesem Feld.
- Die Herausforderungen bei der Rekonstruktion ursprünglicher slawischer Ortsnamen in Thüringen.
- Die verschiedenen Bildungsmuster slawischer Ortsnamen und ihre sprachlichen Hintergründe.
- Der Einfluss slawischer und deutscher Sprachentwicklung auf die Ortsnamengebung.
- Die Bedeutung von Forschungsprojekten zur deutsch-slawischen Onomastik.
- Die Rolle von Toponyme und Anthroponyme in der Namensgebung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der slawischen Ortsnamenforschung ein und beschreibt die Schwierigkeiten bei der Rekonstruktion ursprünglicher Namen aufgrund von Schreibweisenänderungen und der Mangel an gesicherten historischen Angaben. Sie hebt die Bedeutung der Forschungsgruppe „Germania Slavica“ und die Arbeiten von Wolfgang Hermann Fritze und Ernst Eichler hervor, die maßgeblich zur Erforschung der deutsch-slawischen Onomastik beigetragen haben. Die Einleitung betont, dass viele Interpretationen auf Übersetzungen und Namensableitungen basieren und die Zusammenarbeit von Deutschen und Slawen - ob friedlich oder kriegerisch - durch Quellen nur unzureichend dokumentiert ist. Die Vielfalt an deutsch-slawischen Ortsnamen im ostdeutschen Raum verdeutlicht den Einfluss der slawischen Sprachen auf die Namensgebung.
2. Bildungsmuster slawischer Ortsnamen im Thüringer Raum: Dieses Kapitel untersucht die Bildungsmuster slawischer Ortsnamen im Thüringer Raum. Es erklärt, dass toponymische Suffixe aus appellativischen Suffixen hervorgegangen sind, und beschreibt häufige Endungen wie „-ic“, „-ov“, „-in“, „-ovice“, „-ovici“, „-nik“, „-sk“, „-icha“ und „-sko“, und deren Bedeutung im Kontext der Namensgebung. Es wird der Unterschied zwischen der Wortbildung im Deutschen (Komposita) und im Slawischen (Derivate) hervorgehoben und anhand von Beispielen wie „Dresdjane“ und „Droganici“ verdeutlicht. Das Kapitel diskutiert die Schwierigkeiten bei der Bestimmung der ursprünglichen Bedeutung der Namen aufgrund von Sprachwandel und fehlenden Rechtschreibregeln, insbesondere in Regionen, wo slawische Sprachen wie Sorbisch erhalten geblieben sind. Die Bedeutung von Gewässernamen (Hydronymen) und deren vorslawischer Herkunft wird ebenfalls betrachtet.
Schlüsselwörter
Slawische Ortsnamen, Thüringen, Namensforschung, Onomastik, Germania Slavica, Ernst Eichler, Wolfgang Hermann Fritze, Toponyme, Anthroponyme, Sprachwandel, Siedlungsgeschichte, Deutsch-slawische Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Slawische Ortsnamen in Thüringen
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die slawische Ortsnamenforschung in Thüringen. Er beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung der Bildungsmuster slawischer Ortsnamen, den Schwierigkeiten bei ihrer Rekonstruktion aufgrund von Sprachwandel und Quellenmangel, sowie der Bedeutung von Forschungsprojekten wie „Germania Slavica“ und der Arbeit von Linguisten wie Ernst Eichler und Wolfgang Hermann Fritze.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Herausforderungen der Rekonstruktion slawischer Ortsnamen in Thüringen, die verschiedenen Bildungsmuster dieser Namen (inklusive Suffixe wie „-ic“, „-ov“, „-in“ etc.), den Einfluss slawischer und deutscher Sprachentwicklung auf die Namensgebung, die Rolle von Forschungsprojekten und die Bedeutung von Toponymen und Anthroponymen. Es wird auch der Unterschied zwischen deutscher und slawischer Wortbildung beleuchtet, sowie der Einfluss von Schreibweisenänderungen und die Bedeutung von Gewässernamen (Hydronymen).
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel über die Bildungsmuster slawischer Ortsnamen im Thüringer Raum (unterteilt in mehrere Unterkapitel zu verschiedenen Namensbildungsmustern), und eine Zusammenfassung. Die Einleitung skizziert die Problematik der Forschung und nennt wichtige Wissenschaftler. Das Hauptkapitel analysiert detailliert verschiedene Typen slawischer Ortsnamen und deren sprachliche Hintergründe. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Erforschung slawischer Ortsnamen in Thüringen beschrieben?
Der Text beschreibt mehrere Schwierigkeiten: Schreibweisenänderungen über die Zeit, die Knappheit an gesicherten Quellen, der Sprachwandel, fehlende Rechtschreibregeln in der Vergangenheit und die Herausforderung, die ursprüngliche Bedeutung von Namen aufgrund dieser Faktoren zu rekonstruieren. Auch die unzureichende Dokumentation deutsch-slawischer Beziehungen in historischen Quellen wird thematisiert.
Welche Wissenschaftler und Forschungsprojekte werden erwähnt?
Der Text nennt explizit die Forschungsgruppe „Germania Slavica“, sowie die Wissenschaftler Ernst Eichler und Wolfgang Hermann Fritze als wichtige Akteure in der deutsch-slawischen Onomastik. Ihre Arbeiten haben maßgeblich zur Erforschung dieses Gebiets beigetragen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Die Schlüsselwörter des Textes sind: Slawische Ortsnamen, Thüringen, Namensforschung, Onomastik, Germania Slavica, Ernst Eichler, Wolfgang Hermann Fritze, Toponyme, Anthroponyme, Sprachwandel, Siedlungsgeschichte, Deutsch-slawische Beziehungen.
Welche Bildungsmuster slawischer Ortsnamen werden im Detail betrachtet?
Das Hauptkapitel untersucht detailliert verschiedene Bildungsmuster, darunter Ortsnamen aus slawischen Voll- und Kurznamen mit unterschiedlichen Suffixen (z.B. „-j“, „-ici“, „-ov“, „-in“), pluralische Bewohnernamen, Namen mit Endungen wie „-jane“, Namen aus slawischen Sachwörtern mit Suffixen wie „-ica“ und „-ina“, sorbische Personennamen mit deutschen Grundwörtern, deutsche Lehnwörter mit sorbischen Suffixen und deutsche Ortsnamen für sorbische Siedlungen.
- Arbeit zitieren
- Marianne Kupetz (Autor:in), 2013, Slawische Ortsnamen in Thüringen und ihre Bedeutung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/270425