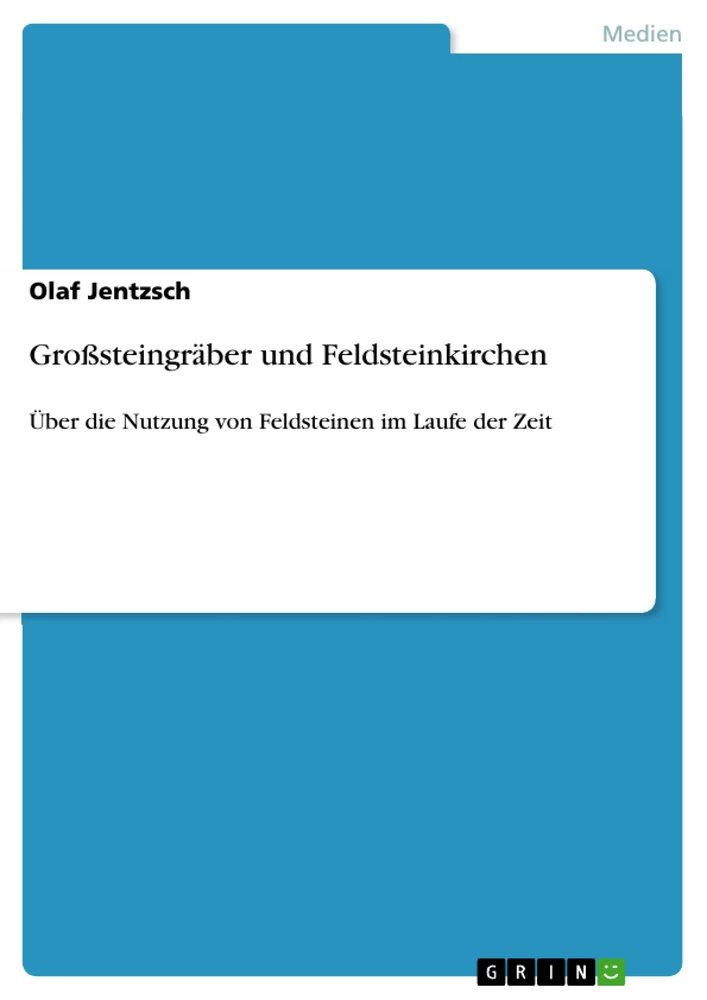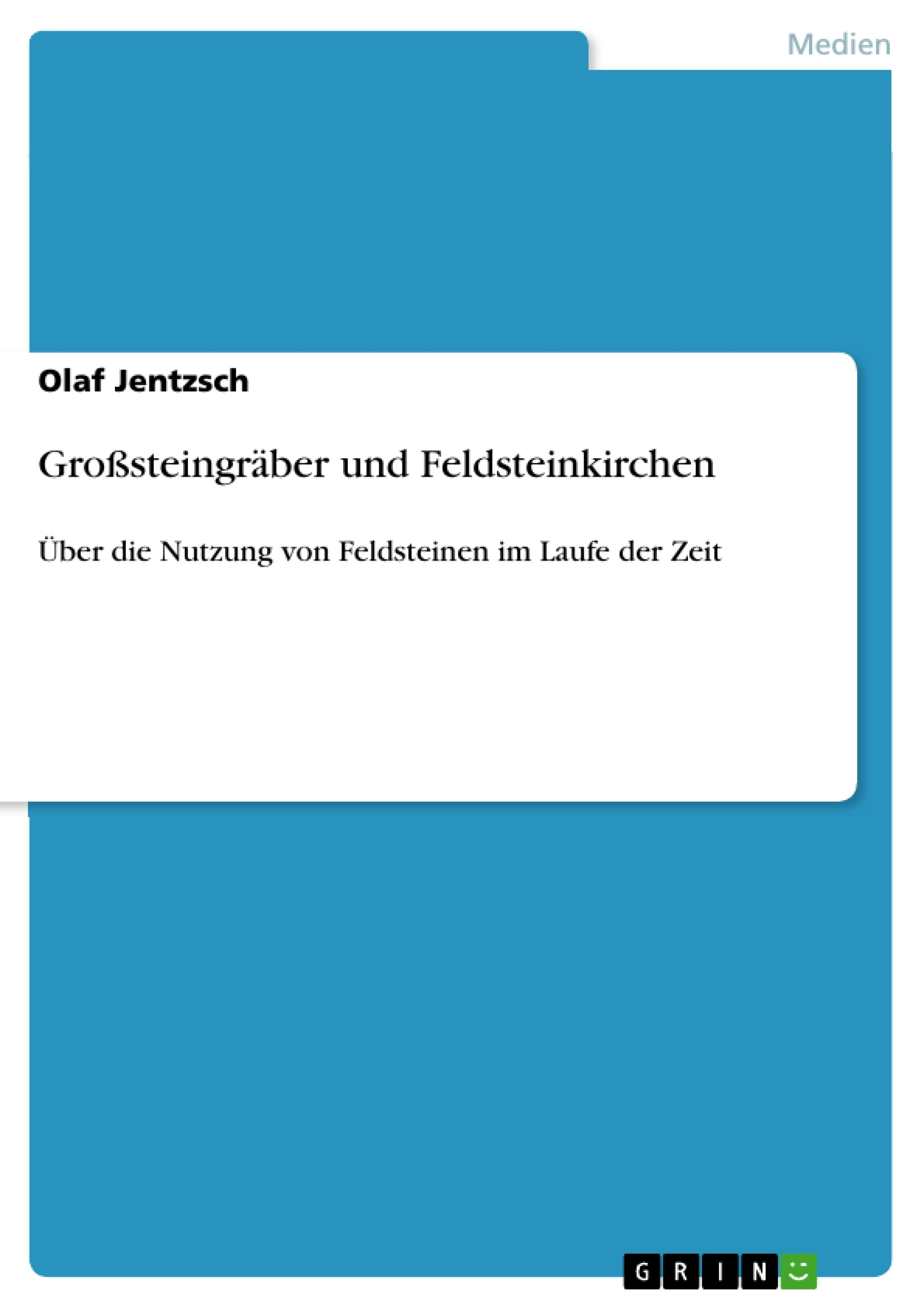In diesem Buch unternehmen wir eine Exkursion durch die Geschichte der Feldsteinnutzung. Wir schauen uns an, welche Bedeutung die Feldsteine in der Ur- und Frühgeschichte für die Menschen hatten und welche Werkzeuge sie benutzten. Den Großsteingräbern wird dabei ein eigenes Kapitel gewidmet. Über die Nutzung als Baumaterial im Mittelalter und in der Neuzeit kommen wir zum Abschluss auch auf die heutigen Nutzungsmöglichkeiten von Feldsteinen zu sprechen. Es wird dargestellt und an ausgewählten Beispielen illustriert, wie die Menschen im Laufe der Zeit die Verarbeitung der Feldsteine verbesserten und neue Möglichkeiten der Nutzung fanden.Ich möchte interessierte Menschen anregen, mit offenen Augen durch die Natur zu gehen und sich an den wunderschönen Feldsteinbauten in der Uckermark zu erfreuen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriff und Herkunft der Feldsteine
- Nutzung von Feldsteinen in der Ur- und Frühgeschichte
- Steingräber in der Uckermark
- Die Nutzung von Feldsteinen im Mittelalter
- Feldsteinkirchen
- Wehranlagen aus Feldsteinen
- Die Renaissance des Feldsteinbaus
- Weitere Nutzungsfelder von Feldsteinen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte der Feldsteinnutzung in der Uckermark, beginnend mit der Ur- und Frühgeschichte bis zur Neuzeit. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Feldsteine als Rohstoff und Baumaterial, sowie auf der Entwicklung der Verarbeitungstechniken im Laufe der Zeit.
- Die Herkunft und der geologische Kontext der Feldsteine in der Uckermark.
- Die Verwendung von Feldsteinen in der Steinzeit, insbesondere als Werkzeug und in der Herstellung von Großsteingräbern.
- Die Rolle der Feldsteine im mittelalterlichen Kirchenbau und bei der Errichtung von Wehranlagen.
- Die Renaissance des Feldsteinbaus in der Neuzeit, insbesondere im ländlichen Bereich.
- Die vielseitigen modernen Nutzungsweisen von Feldsteinen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die omnipräsente Präsenz von Feldsteinen in der Landschaft der Uckermark. Sie hebt deren Bedeutung als Baumaterial und als Gegenstand der menschlichen Phantasie hervor und skizziert den Inhalt der folgenden Kapitel, die sich mit der historischen Nutzung der Feldsteine befassen, wobei der Fokus auf der Uckermark liegt. Der Text betont den nicht-abschließenden Charakter der Arbeit und regt zur eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema an.
Begriff und Herkunft der Feldsteine: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Feldstein“ und beleuchtet dessen Entstehung im Kontext der Eiszeiten. Es erklärt den glazialen Transport der Steine aus Skandinavien und deren Ablagerung in der Uckermark. Die unterschiedliche Verteilung der Steine, abhängig von geologischen Formationen wie Grund- und Endmoränen, wird erläutert. Die Unterscheidung zwischen Feldsteinen und Findlingen wird ebenfalls thematisiert.
Nutzung von Feldsteinen in der Ur- und Frühgeschichte: Das Kapitel beschreibt die Nutzung von Feldsteinen durch die Menschen der Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit in der Uckermark. Es werden die verschiedenen Steinwerkzeuge und ihre Herstellungstechniken detailliert dargestellt, angefangen von Faustkeilen bis hin zu polierten Äxten und Beilen. Der Übergang von der Jäger- und Sammler- zur bäuerlichen Lebensweise wird im Zusammenhang mit dem Bedarf an Steinwerkzeugen zur Waldrodung und Bearbeitung von Holz beschrieben. Der Feuerstein wird als besonders wichtiger Rohstoff hervorgehoben.
Steingräber in der Uckermark: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Megalithkultur und die Großsteingräber der Uckermark. Es erläutert den Ursprung und die Verbreitung dieser Grabformen in Nordeuropa und beschreibt die verschiedenen Typen von Großsteingräbern (Urdolmen, erweiterte Dolmen, Ganggräber, Steinkisten) anhand ihrer architektonischen Merkmale. Anhand von Beispielen aus der Uckermark (Trebenow, Brüssow-Hammelstall, Mürow) werden die Bauweisen und Ausgrabungsfunde detailliert beschrieben und deren Bedeutung für die Erforschung der Jungsteinzeit erläutert.
Die Nutzung von Feldsteinen im Mittelalter: Dieses Kapitel behandelt die Nutzung von Feldsteinen im Mittelalter, insbesondere im Zusammenhang mit der Ostkolonisation und der Christianisierung der Uckermark. Es wird die Bedeutung der Feldsteine für den Bau von Kirchen und Wehranlagen hervorgehoben. Die Organisation des mittelalterlichen Kirchenbaus durch Bauhütten und die Entwicklung der Mauerwerkstechniken werden beschrieben. Die Kapitel beschreiben auch den Bau von Stadtmauern und -toren sowie die Entwicklung und den Nutzen der Wiekhäuser.
Die Renaissance des Feldsteinbaus: Das Kapitel beschreibt die Wiederbelebung des Feldsteinbaus im 18. und 19. Jahrhundert, insbesondere im ländlichen Raum. Die Gründe für die erneute Verwendung von Feldsteinen (Brandschutz, Kostenersparnis) werden erläutert. Es wird zwischen verschiedenen Bautechniken unterschieden (Zyklopenmauerwerk in Zwickeltechnik, gemischte Mauerwerke) und an Beispielen aus der Uckermark illustriert. Der zunehmende Einsatz von Ziegeln und der Rückgang der Feldsteinnutzung werden ebenfalls thematisiert.
Weitere Nutzungsfelder von Feldsteinen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene weitere Verwendungszwecke von Feldsteinen, von der Errichtung von Gedenk- und Grabsteinen bis hin zur Verwendung in der Kunst. Es werden Beispiele für die künstlerische Gestaltung von Feldsteinen in der Uckermark gezeigt.
Schlüsselwörter
Feldsteine, Uckermark, Eiszeit, Megalithkultur, Großsteingräber, Kirchenbau, Wehranlagen, Mittelalter, Ostkolonisation, Bauhütten, Zyklopenmauerwerk, Steinwerkzeuge, Neolithikum, Findlinge, Baugeschichte, Regionale Geschichte, Archäologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Feldsteine in der Uckermark"
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Feldsteinnutzung in der Uckermark, von der Ur- und Frühgeschichte bis in die Gegenwart. Er behandelt die Herkunft der Feldsteine, ihre Verwendung als Werkzeug und Baumaterial in verschiedenen Epochen, die Bauweise von Großsteingräbern, Kirchen, Wehranlagen und weiteren Bauwerken sowie die Entwicklung der Bautechniken. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Woher stammen die Feldsteine der Uckermark?
Die Feldsteine der Uckermark stammen aus Skandinavien und wurden während der Eiszeiten durch Gletscher transportiert und in der Region abgelagert. Die Verteilung der Steine hängt von geologischen Formationen wie Grund- und Endmoränen ab. Der Text unterscheidet zwischen Feldsteinen und Findlingen.
Wie wurden Feldsteine in der Ur- und Frühgeschichte genutzt?
In der Steinzeit wurden Feldsteine als Rohmaterial für die Herstellung verschiedener Steinwerkzeuge verwendet, von Faustkeilen bis hin zu polierten Äxten und Beilen. Der Text beschreibt den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Steinwerkzeuge und dem Übergang von der Jäger- und Sammler- zur bäuerlichen Lebensweise. Feuerstein wird als besonders wichtiger Rohstoff hervorgehoben.
Welche Rolle spielten Feldsteine im Bau von Großsteingräbern?
Der Text behandelt die Megalithkultur und die Großsteingräber der Uckermark ausführlich. Er beschreibt verschiedene Typen von Großsteingräbern (Urdolmen, erweiterte Dolmen, Ganggräber, Steinkisten) und deren architektonische Merkmale. Anhand von Beispielen aus der Uckermark werden Bauweisen und Ausgrabungsfunde detailliert beschrieben und deren Bedeutung für die Erforschung der Jungsteinzeit erläutert.
Wie wurden Feldsteine im Mittelalter verwendet?
Im Mittelalter waren Feldsteine ein wichtiges Baumaterial für Kirchen und Wehranlagen. Der Text beschreibt die Organisation des mittelalterlichen Kirchenbaus durch Bauhütten, die Entwicklung der Mauerwerkstechniken und den Bau von Stadtmauern und -toren sowie Wiekhäusern. Die Ostkolonisation und Christianisierung der Uckermark werden im Zusammenhang mit der Feldsteinnutzung betrachtet.
Gab es eine Renaissance des Feldsteinbaus?
Ja, im 18. und 19. Jahrhundert erlebte der Feldsteinbau eine Wiederbelebung, vor allem im ländlichen Raum. Der Text nennt Gründe wie Brandschutz und Kostenersparnis und beschreibt verschiedene Bautechniken (Zyklopenmauerwerk in Zwickeltechnik, gemischte Mauerwerke). Der zunehmende Einsatz von Ziegeln und der darauf folgende Rückgang der Feldsteinnutzung werden ebenfalls thematisiert.
Welche weiteren Verwendungszwecke hatten Feldsteine?
Neben dem Bauwesen wurden Feldsteine auch für die Errichtung von Gedenk- und Grabsteinen sowie in der Kunst verwendet. Der Text zeigt Beispiele für die künstlerische Gestaltung von Feldsteinen in der Uckermark.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Text?
Schlüsselwörter sind: Feldsteine, Uckermark, Eiszeit, Megalithkultur, Großsteingräber, Kirchenbau, Wehranlagen, Mittelalter, Ostkolonisation, Bauhütten, Zyklopenmauerwerk, Steinwerkzeuge, Neolithikum, Findlinge, Baugeschichte, Regionale Geschichte, Archäologie.
- Quote paper
- Dipl.-Ing. Olaf Jentzsch (Author), 2014, Großsteingräber und Feldsteinkirchen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/269776